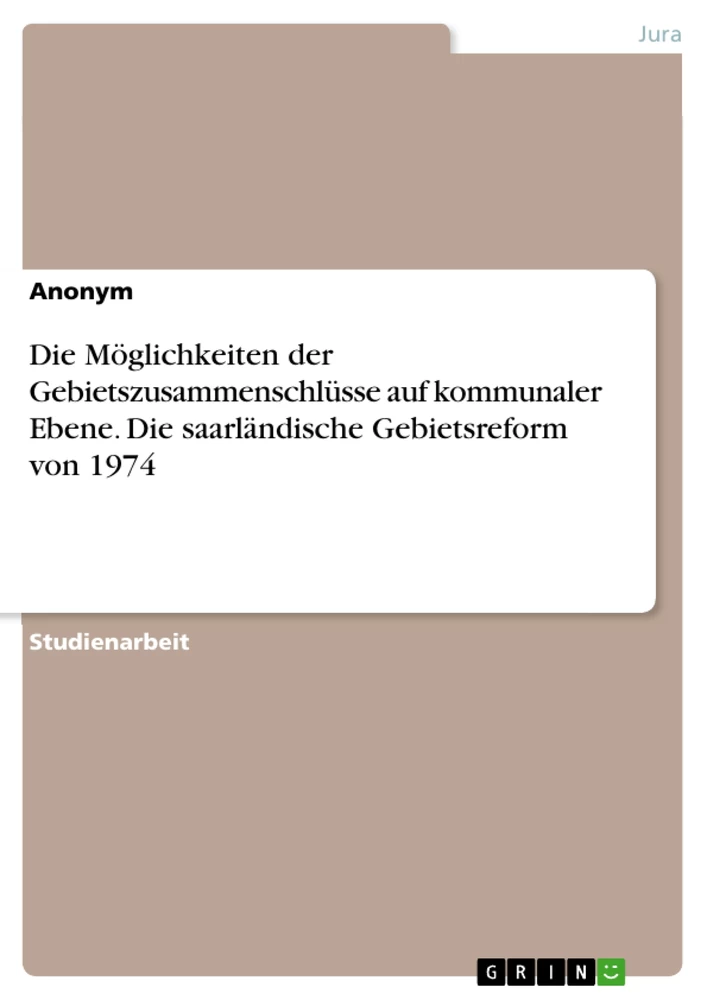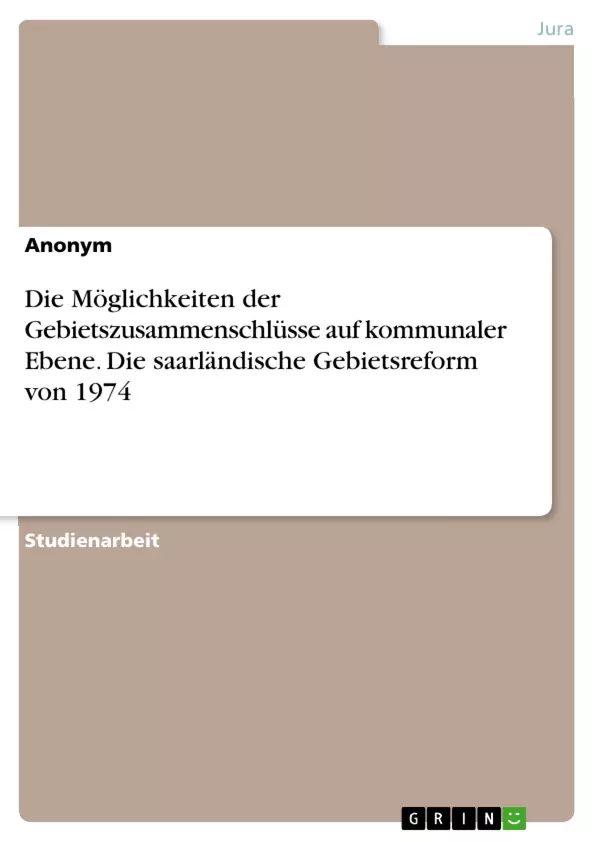Dieser Leistungsnachweis befasst sich im Folgenden mit den gesetzlichen Möglichkeiten von Gebietsänderungen innerhalb des Saarlandes. Das Ziel hierbei soll sein, die rechtlichen Grundlagen näher zu betrachten und zu erläutern. Zur Veranschaulichung dient die im Jahr 1974 durchgeführte Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland.
Im Jahr 1973 wurde im Amtsblatt des Saarlandes Nr. 48 das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Landkreise des Saarlandes (Neugliederungsgesetz - NGG) vom 19. Dezember 1973 verkündet, welches mit Wirkung vom 1. Januar 1974 in Kraft trat. Damit jährt sich die kommunale Neugliederung des Saarlandes in diesem Jahr bereits zum einundvierzigsten Mal. Mit dem Gesetz zur Vorbereitung der kommunalen Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland vom 17. Dezember 1970 (Amtsbl. S. 949) konnte die erste Grundlage für eine Gebietsreform geschaffen werden.
Zusammen mit dem NGG wurden die Gebietsänderungen der Landkreise, Städte und Gemeinden nun fest verankert. Die Landkreise wurden von sieben auf fünf reduziert. Weiterhin wurde der Stadtverband Saarbrücken geschaffen. Die bis dahin kreisfreie Landeshauptstadt Saarbrücken war fortan eine stadtverbandsangehörige Gemeinde bzw. Stadt, allerdings mit Sonder- zuständigkeiten. Es wurden alle bis dato bestehenden 345 Gemeinden - mit Ausnahme der Städte Saarlouis, Dillingen, Friedrichsthal und Sulzbach/Saar - aufgelöst und zunächst zu insgesamt 50 Gemeinden zusammengeschlossen. Im Jahr 1981 fand eine Überprüfung der 1974 vollzogenen Gebietsreform statt. Hierbei wurden die ehemaligen Gemeindebezirke Bous und Ensdorf aus der Gemeinde Schwalbach herausgelöst und wurden zu eigenständigen Gemeinden. So änderte sich die Anzahl der Gemeinden auf 52, welche heute noch Bestand haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Gebietsreform im Saarland von 1974 und ihre Hintergründe
- 2 Kommunale Selbstverwaltung und Gebietshoheit
- 2.1 Kommunale Selbstverwaltung
- 2.2 Gebietshoheit
- 3 Gebiets- und Grenzänderungen von Gemeinden
- 3.1 Gründe und Voraussetzungen für die Änderung von Gemeindegrenzen
- 3.2 Arten von Gebietsänderungen und Verfahren
- 3.2.1 Freiwillige Grenzänderung
- 3.2.2 Unfreiwillige Grenzänderung
- 3.2.3 Auflösung und Neubildung von Gemeinden
- 3.2.4 Andere Möglichkeiten
- 4 Ausblick - Gestaltung des Saarlandes in der Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Leistungsnachweis befasst sich mit den gesetzlichen Möglichkeiten von Gebietsänderungen innerhalb des Saarlandes. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen näher zu betrachten und zu erläutern. Zur Veranschaulichung dient die im Jahr 1974 durchgeführte Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland.
- Die Gebietsreform im Saarland von 1974 und ihre Hintergründe
- Kommunale Selbstverwaltung und Gebietshoheit
- Gründe und Voraussetzungen für die Änderung von Gemeindegrenzen
- Arten von Gebietsänderungen und Verfahren
- Ausblick auf die Gestaltung des Saarlandes in der Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die kommunale Neugliederung des Saarlandes im Jahr 1974 und ihre historische Entwicklung. Kapitel 1 analysiert die Hintergründe der Gebietsreform, insbesondere die Ziele der saarländischen Landesregierung und die rechtlichen Grundlagen. Kapitel 2 erläutert die Prinzipien der kommunalen Selbstverwaltung und die Bedeutung der Gebietshoheit für Gemeinden. Kapitel 3 behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Gebiets- und Grenzänderungen, einschließlich der Gründe und Voraussetzungen für solche Veränderungen sowie der verschiedenen Arten von Verfahren. Der Ausblick in Kapitel 4 beschäftigt sich mit der zukünftigen Gestaltung des Saarlandes im Hinblick auf die kommunale Struktur.
Schlüsselwörter
Gebietsreform, Saarland, Kommunale Selbstverwaltung, Gebietshoheit, Gemeindegrenzen, Rechtsgrundlagen, öffentliche Wohl, Neugliederungsgesetz, Verwaltungsreform, Ortsrecht, Liegenschaftskataster, Gemeindegebiet, Gesetz zur Vorbereitung der kommunalen Gebiets- und Verwaltungsreform, Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Landkreise des Saarlandes, Gesetz über die Funktionalreform, Gemeindeverband, Stadtverband Saarbrücken.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der saarländischen Gebietsreform von 1974?
Ziel war eine Neugliederung der Gemeinden und Landkreise zur Steigerung der Verwaltungseffizienz. Die Anzahl der Gemeinden wurde von 345 auf zunächst 50 reduziert.
Wie veränderte sich die Anzahl der Landkreise?
Durch das Neugliederungsgesetz (NGG) wurde die Anzahl der Landkreise im Saarland von sieben auf fünf reduziert.
Was ist die Besonderheit des Stadtverbands Saarbrücken?
Mit der Reform wurde die kreisfreie Landeshauptstadt Saarbrücken in den neu geschaffenen Stadtverband eingegliedert, behielt jedoch Sonderzuständigkeiten.
Was unterscheidet freiwillige von unfreiwilligen Grenzänderungen?
Freiwillige Änderungen basieren auf Vereinbarungen zwischen Gemeinden, während unfreiwillige Änderungen durch Landesgesetze zum Wohle des öffentlichen Wohls verordnet werden.
Warum gibt es heute 52 Gemeinden im Saarland?
Nach einer Überprüfung im Jahr 1981 wurden die Ortsteile Bous und Ensdorf wieder aus der Gemeinde Schwalbach herausgelöst und zu eigenständigen Gemeinden, was die Gesamtzahl von 50 auf 52 erhöhte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Die Möglichkeiten der Gebietszusammenschlüsse auf kommunaler Ebene. Die saarländische Gebietsreform von 1974, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315916