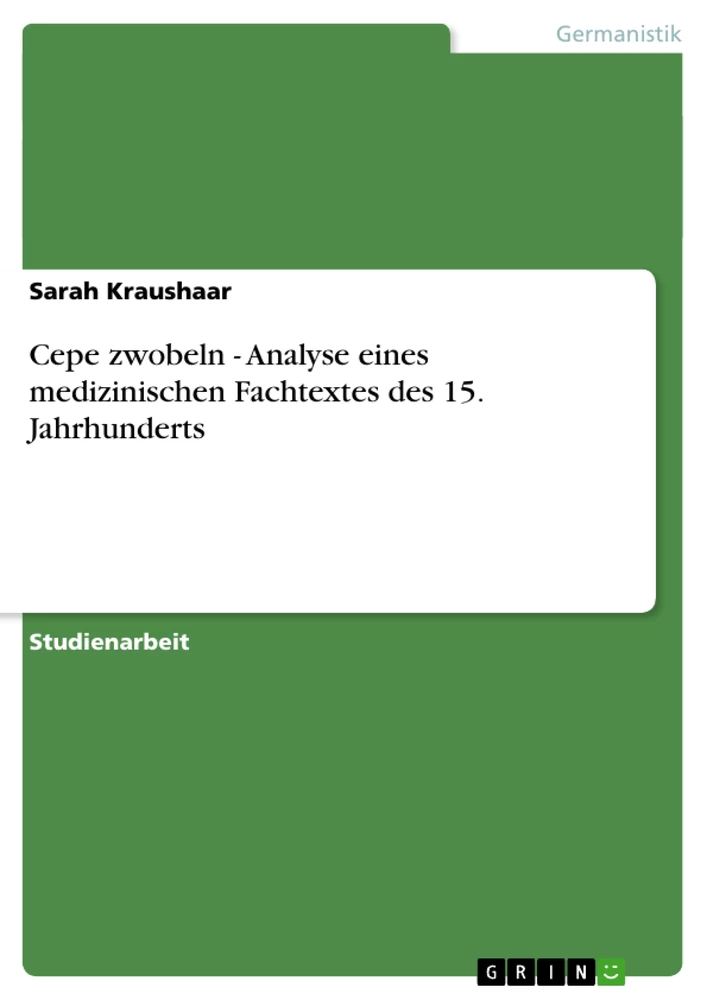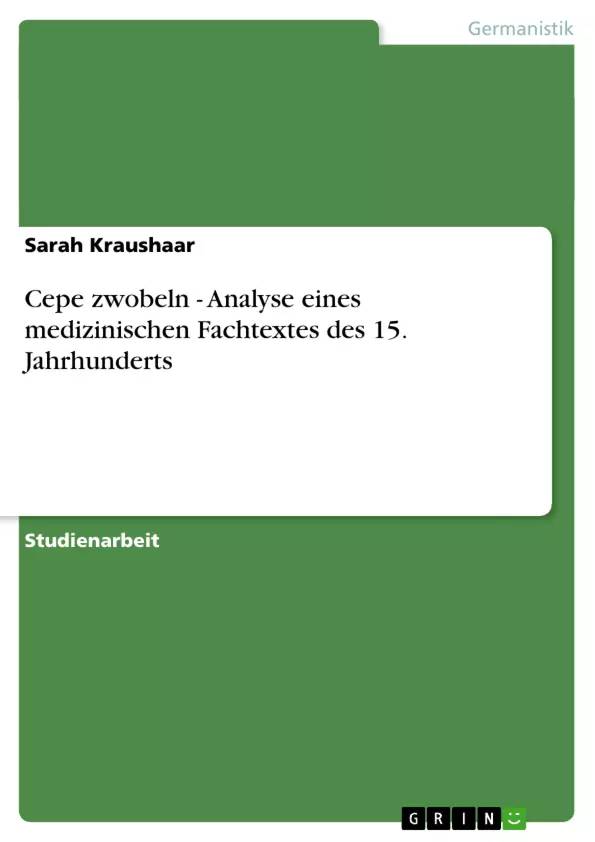[...] Die Texte sind überwiegend informierend und enthalten nur gelegentlich kleinere anleitende Passagen. Im ersten Teil meiner Arbeit steht die Übersetzung und sprachliche Analyse des historischen Textdokuments. Im zweiten Teil beschreibe ich die Entwicklung von fachsprachlichen Texten aus dem Bereich Medizin und die Miterfindung und Weiterentwicklung des Buchdruckes durch Peter Schöffer, der als Drucker des vorliegenden Textes überliefert ist und dem eine wichtige Bedeutung in der Zusammenarbeit mit Gutenberg zukommt. Das 15.Jahrhundert ist für die Entwicklung von Fachsprachen besonders wichtig, da der auch in Deutschland um sich greifende Humanismus eine ganz neue Sicht von Natur, Geist und Wissen mit sich brachte, und so die damals entstandenen wissenschaftlichen und technischen Schriften weiter in die Nähe neuzeitlicher Auffassungen zum Beispiel über Theorie und Methode rückte. Symptome sind eine langsame Abkehr vom Traditionalismus und die erste Entwicklung einer privaten städtischen Buchkultur, ein Zeichen zudem für einen veränderten Teilnehmerkreis an Wissenschaft und Technik. Mit dem Bereich der medizinischen Fachtexte des Mittelalters im allgemeinen und den im vorliegenden Text angegeben Bezügen auf Galen, einer der wichtigsten Quellen mittelalterlicher Medizin, setzt sich der zweite Teil meiner Arbeit auseinander. Der Hintergrund für diese Buchkultur war aber die Erfindung des Buchdrucks, der etwa 1445 mit dem überlieferten Fragment vom Weltgericht erste technische Erfolge hatte. Zunächst wurden literarische Massenartikel gedruckt aber auch schon in Richtung fachsprachlicher Kommunikation gehende Werke: 1457 ein Aderlass- und Laxierkalender aus der Werkstatt Gutenbergs, 1474 Bartholomäus Metlingers "wie die kind in gesuntheit und in krankheiten gehalten werden sollen". dessen lateinische Fassung nur ein Jahr zuvor ebenfalls, und zwar bei Schöffer in Mainz, gedruckt worden war. Der „Gart der Gesundheit“ – zuerst 1484 in lateinischer Fassung, dann 1485 in deutscher Übersetzung in Mainz bei Peter Schöffer erschienen– erfuhr bis zum Ende des 15. Jahrhunderts 15 Nachdrucke. Auf die entstehende Technik des Buchdrucks um 1445 und das damit verbundene Verlagswesen gehe ich in der Erweiterung der Textumfeldanalyse ein, die sich im Besonderen auf den Drucker des vorliegenden historischen Textes, Peter Schöffer aus Gernsheim, und seinen Beitrag zur Gutenbergschen Entwicklung der beweglichen Lettern bezieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Teil: Textinterne Analyse
- I.1. Übersetzung
- I.2. Graphemik
- I.3 Phonologie
- I.4 Syntax und Wortschatz
- Ergebnis der textinternen Analyse
- II. Teil: Textumfeldanalyse
- II.1.1 Zur Entstehung von medizinischen Fachtexten
- II.1.2 Die wichtigsten Quellen mittelalterlicher medizinischer Fachliteratur
- II.2 Der Drucker Peter Schöffer aus Gernsheim am Rhein
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit analysiert einen Text aus dem „Hortus sanitatis“ (dt. „Gart der Gesundheit“), einem frühen fachsprachlichen Text aus dem westmitteldeutschen Sprachraum, der 1485 erschien. Die Arbeit untersucht die Übersetzung und sprachliche Analyse des historischen Textdokuments sowie die Entwicklung von fachsprachlichen Texten im Bereich der Medizin und die Rolle des Druckers Peter Schöffer bei der Erfindung und Weiterentwicklung des Buchdrucks.
- Sprachliche Analyse eines medizinischen Fachtextes aus dem 15. Jahrhundert
- Entwicklung von Fachsprachen im Bereich der Medizin im 15. Jahrhundert
- Die Rolle des Buchdrucks in der Verbreitung von Fachwissen
- Die Bedeutung von Peter Schöffer für die Entwicklung des Buchdrucks
- Die Rezeption antiker medizinischer Quellen im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den „Hortus sanitatis“ und seinen Verfasser, Johann Wonnecke von Kaub, vor und erläutert die Struktur der Arbeit. Sie beschreibt die Wichtigkeit des 15. Jahrhunderts für die Entwicklung von Fachsprachen im Zusammenhang mit dem Humanismus und der Entstehung einer privaten städtischen Buchkultur.
I. Teil: Textinterne Analyse
Dieser Teil befasst sich mit der sprachlichen Analyse des Textes, insbesondere mit der Übersetzung und der Untersuchung sprachlicher Besonderheiten im Vergleich zu Neuhochdeutsch und Mittelhochdeutsch.
I.1. Übersetzung
Die Übersetzung des Kapitels 103 aus dem „Gart der Gesundheit“ wird präsentiert und erläutert, wobei der Fokus auf den lateinischen und arabischen Begriffen für „Zwiebel“ liegt. Der Text beleuchtet die verschiedenen medizinischen Anwendungen von Zwiebeln und bezieht sich auf antike Mediziner wie Galen und Serapio.
II. Teil: Textumfeldanalyse
Dieser Teil beleuchtet die Entstehung und Entwicklung medizinischer Fachtexte sowie die Bedeutung des Buchdrucks in diesem Zusammenhang. Er behandelt die wichtigsten Quellen mittelalterlicher Medizin und die Rolle von Peter Schöffer bei der Entwicklung der beweglichen Lettern.
Schlüsselwörter
Historische Textlinguistik, Medizin, Fachsprachen, Buchdruck, Peter Schöffer, Gutenberg, „Hortus sanitatis“, Mittelalter, Galen, Serapio, Sprachwandel
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Gart der Gesundheit“?
Es handelt sich um einen bedeutenden medizinischen Fachtext des 15. Jahrhunderts (1485), der als einer der ersten Kräuterbücher in deutscher Sprache gedruckt wurde.
Welche Rolle spielte Peter Schöffer für dieses Werk?
Peter Schöffer war der Drucker des Werkes in Mainz und trug wesentlich zur Weiterentwicklung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern bei.
Warum ist das 15. Jahrhundert wichtig für die Fachsprache?
Der aufkommende Humanismus veränderte die Sicht auf Natur und Wissen, was zur Entstehung neuzeitlicher wissenschaftlicher Schriften und einer privaten Buchkultur führte.
Welche antiken Quellen werden im Text zitiert?
Der Text bezieht sich auf wichtige Quellen der mittelalterlichen Medizin, insbesondere auf Galen und arabische Mediziner wie Serapio.
Was wird im Kapitel über „Cepe“ (Zwiebel) beschrieben?
Es werden die medizinischen Anwendungen und Wirkungsweisen der Zwiebel basierend auf antiken und mittelalterlichen Lehren analysiert.
Welche sprachlichen Aspekte werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit umfasst eine detaillierte Analyse der Graphemik, Phonologie, Syntax und des Wortschatzes des historischen Textdokuments.
- Arbeit zitieren
- Sarah Kraushaar (Autor:in), 2003, Cepe zwobeln - Analyse eines medizinischen Fachtextes des 15. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31606