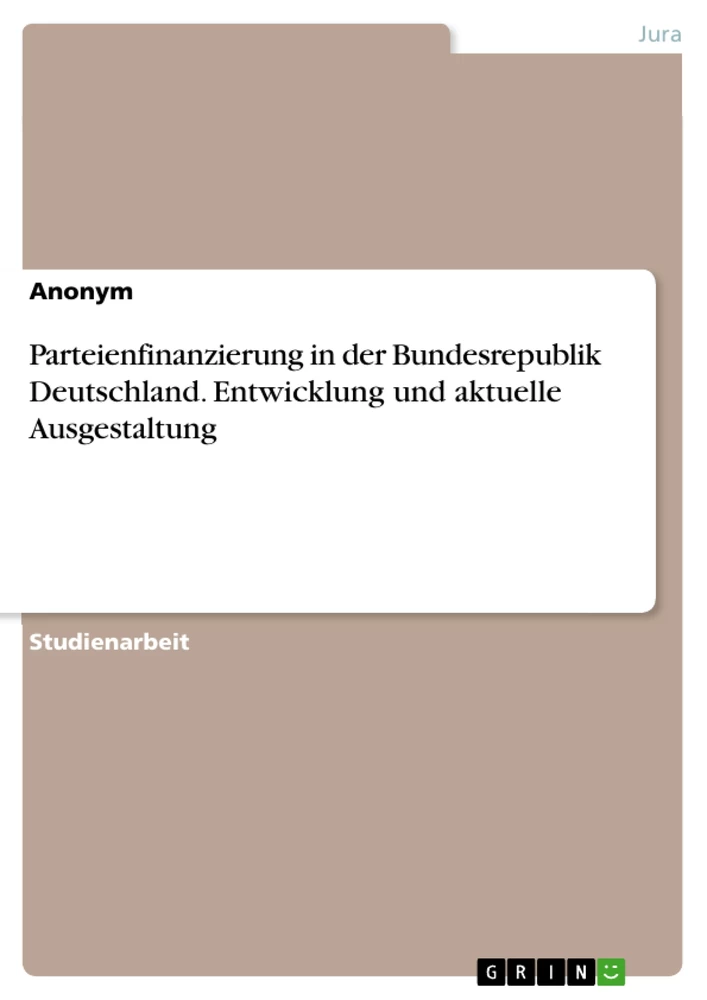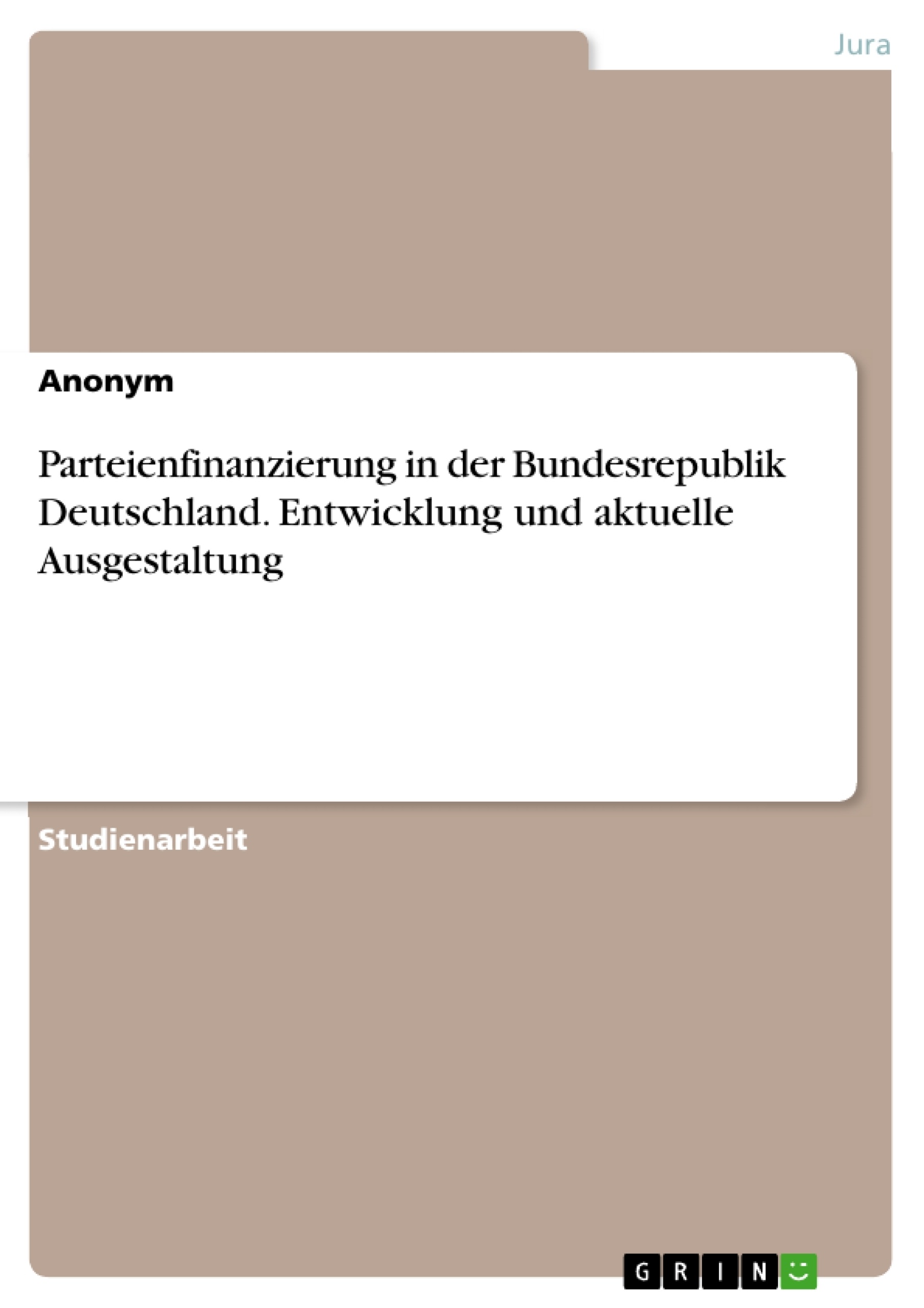Eine Demokratie ohne politische Parteien für die Verwirklichung eines parlamentarischen Regierungssystems ist nicht möglich. Die Parteien beeinflussen maßgeblich die Willensbildung der Bürger. Durch sie wird den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit der Partizipation an Politik eingeräumt. Die Volkssouveränität sowie der Schutz der Parteien werden durch die Aufnahme des Parteibegriffs in Art. 21 GG gewährleistet. Ohne finanzielle Mittel sind politische Tätigkeiten nicht erbringbar, was zur Notwendigkeit einer Finanzierung der politischen Parteien führt.
„Die Regelung der Parteienfinanzierung kann den Ausgang von Wahlen und damit die Verteilung der Macht im Staat beeinflussen.“
Dieser Aussage des deutschen Parteienkritikers und Verfassungsrechtlers Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim lässt sich entnehmen, dass die Ausgestaltung der Parteienfinanzierung von essenzieller Bedeutung sein kann, um Machtverhältnisse in einer Gesellschaft zu formen. Die Parteienfinanzierung sollte besonders in einem demokratisch organisierten Staat fair und angemessen ausgestaltet sein. Die Vertretung von Eigeninteressen und das Interesse, politische Entscheidungen in eigener Sache entscheiden zu wollen, stellen die Ausgestaltung der Parteienfinanzierung in einen durch die Einflussnahme machthabender Politiker gefährdeten Bereich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Arbeit und Zielsetzung
- 2. Begriffliche Grundlagen
- 2.1 Begriff der Partei
- 2.2 Begriff der Finanzierung
- 2.3 Begriff der Parteienfinanzierung
- 3. Entwicklung der Parteienfinanzierung in Deutschland
- 3.1 1949 bis 1967
- 3.2 1967 bis 1983
- 3.3 1982 bis 1999
- 3.4 1999 bis heute
- 4. Aktuelle Ausgestaltung der Parteienfinanzierung in Deutschland
- 4.1 Unmittelbare staatliche Parteienfinanzierung
- 4.2 Mittelbare staatliche Parteienfinanzierung
- 4.3 Nichtstaatliche Einnahmen der Parteien
- 5. Finanzieller Rahmen der Parteien
- 5.1 Zusammensetzung der Einnahmen
- 5.2 Verteilung der staatlichen Mittel von 2003 bis 2012
- 6. Rechenschaftspflicht der Parteien
- 7. Verstöße gegen das Parteiengesetz und Sanktionsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die rechtliche Ausgestaltung der Parteienfinanzierung in Deutschland. Sie verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und die aktuelle Situation der Parteienfinanzierung zu gewinnen und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
- Entwicklung der Parteienfinanzierung in Deutschland seit 1949
- Aktuelle Ausgestaltung der Parteienfinanzierung, einschließlich staatlicher und nichtstaatlicher Finanzierungsquellen
- Rechenschaftspflicht der Parteien und Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen das Parteiengesetz
- Mögliche Verbesserungspotenziale für die Parteienfinanzierung in Deutschland
- Bedeutung der Parteienfinanzierung für die Chancengleichheit und die Partizipationsmöglichkeiten der Bürger
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Parteienfinanzierung ein und beleuchtet die Bedeutung politischer Parteien für eine Demokratie. Es werden die Herausforderungen und Problemfelder der Parteienfinanzierung in Deutschland dargelegt. Im zweiten Kapitel werden die Kernbegriffe Partei, Finanzierung und Parteienfinanzierung definiert. Das dritte Kapitel schildert die historische Entwicklung der Parteienfinanzierung in Deutschland von 1949 bis heute, indem es wichtige Meilensteine und Reformen beleuchtet. Das vierte Kapitel befasst sich mit der aktuellen Ausgestaltung der Parteienfinanzierung, wobei die staatliche und nichtstaatliche Finanzierung sowie die Einnahmen der Parteien betrachtet werden. Das fünfte Kapitel analysiert den finanziellen Rahmen der Parteien, indem es die Zusammensetzung der Einnahmen und die Verteilung der staatlichen Mittel von 2003 bis 2012 untersucht. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Rechenschaftspflicht der Parteien und den damit verbundenen Verpflichtungen. Das siebte Kapitel widmet sich Verstößen gegen das Parteiengesetz und möglichen Sanktionsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Parteienfinanzierung, Parteienrecht, Demokratie, politische Parteien, staatliche Finanzierung, nichtstaatliche Finanzierung, Spendengelder, Rechenschaftspflicht, Verstöße, Sanktionen, Chancengleichheit, Partizipationsmöglichkeiten, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden politische Parteien in Deutschland finanziert?
Die Finanzierung erfolgt aus staatlichen Mitteln (unmittelbare und mittelbare Finanzierung) sowie aus nichtstaatlichen Einnahmen wie Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Was regelt Artikel 21 des Grundgesetzes?
Art. 21 GG garantiert die verfassungsrechtliche Stellung der Parteien, ihre Mitwirkung an der politischen Willensbildung und verpflichtet sie zur öffentlichen Rechenschaft über ihre Mittel.
Warum gibt es eine staatliche Teilfinanzierung für Parteien?
Sie soll sicherstellen, dass Parteien ihre Aufgaben unabhängig von Großspendern erfüllen können und die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb gewahrt bleibt.
Was passiert bei Verstößen gegen das Parteiengesetz?
Das Gesetz sieht verschiedene Sanktionsmöglichkeiten vor, wie etwa den Abzug von staatlichen Mitteln oder hohe Bußgelder bei fehlerhaften Rechenschaftsberichten.
Was ist die Rechenschaftspflicht der Parteien?
Parteien müssen jährlich einen Rechenschaftsbericht vorlegen, der ihre Einnahmen, Ausgaben sowie ihr Vermögen offenlegt, um Transparenz für den Bürger zu schaffen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung und aktuelle Ausgestaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316108