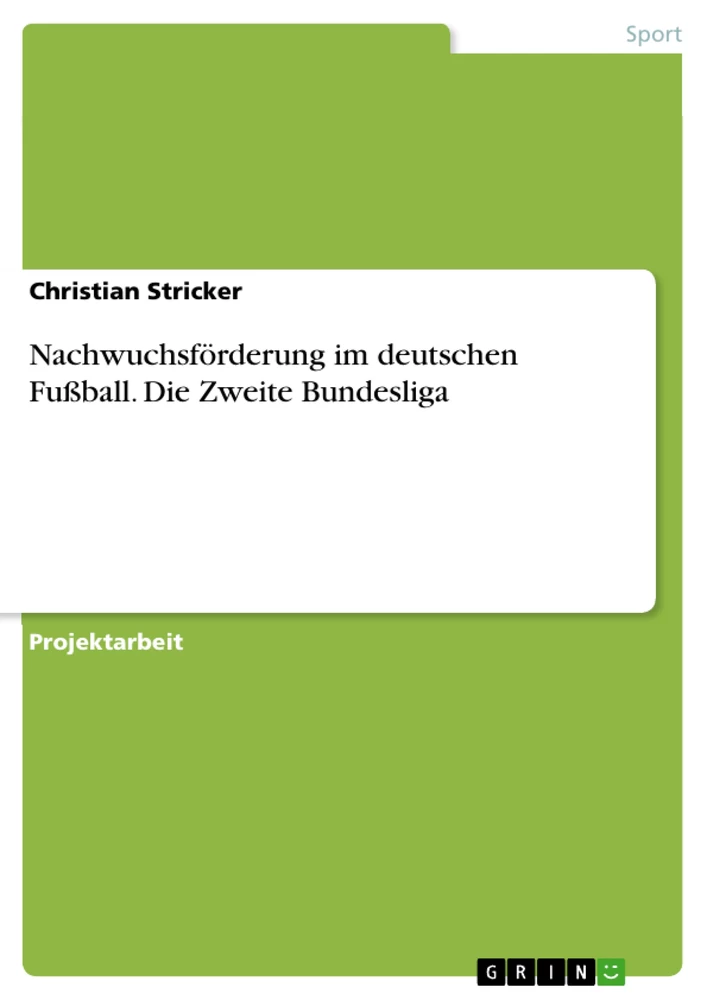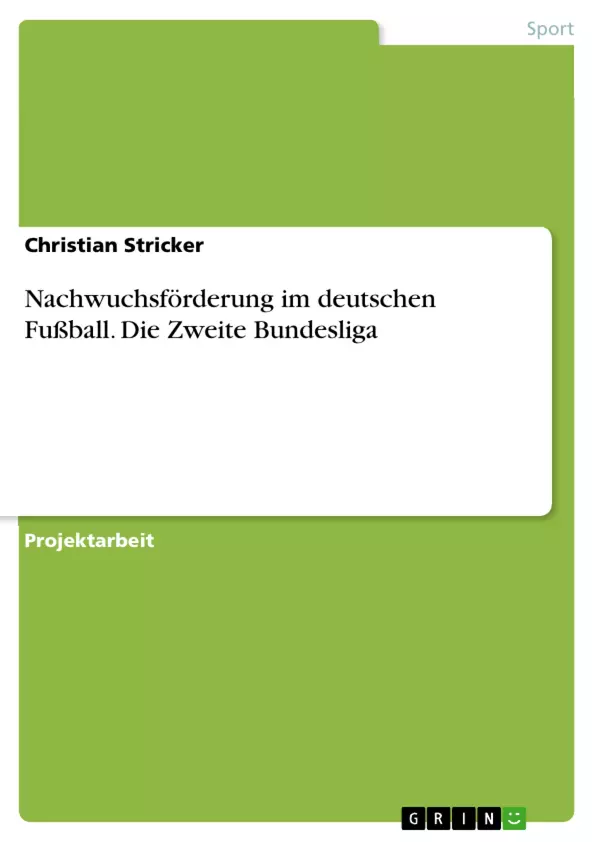In folgender Arbeit „Nachwuchsförderung im deutschen Fußball. Die Zweite Bundesliga“ werden die Strukturen und Konzeptionen der Nachwuchsförderung im deutschen Fußball seit der Jahrtausendwende erläutert. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Umstrukturierung der Nachwuchsförderung beim DFB durch den damaligen Präsidenten Gerhard-Mayer Vorfelder gelegt.
Das in der Folge initiierte Talentförderprogramm wird in Ziele, Ausbildungsstruktur sowie der Basis-, Talent und Eliteförderung aufgespalten, um die Maßnahmen für die Nachwuchsförderung seitens des DFB darzustellen. Ferner wird die Lizenzierung der Leistungszentren im Rahmen der DFL vorgestellt, die unterschiedliche Voraussetzungen für Erst- und Zweitligisten beinhalten. Die Zertifizierung der Nachwuchsleistungszentren von der Firma Double PASS wird im Anschluss vorgestellt. Dabei werden die einzelnen Qualitätsdimensionen, die Punktevergabe und -bewertung sowie die finanziellen Vorteile für die Vereine thematisiert. Abschließend erfolgen ausgewählte Praxisbeispiele des Zweitligisten VfR Aalen hinsichtlich der vorgestellten Lizenzierung und der Zertifizierung, so dass im Fazit dazu, zu der Nachwuchsförderung in Deutschland und im Speziellen in der Zweiten Bundesliga Stellung genommen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutscher-Fußball-Bund
- Historie der Nachwuchsförderung
- DFB-Talentförderprogramm
- Ziele
- Ausbildungsstruktur
- Basisförderung
- Talentförderung
- Eliteförderung
- Deutsche-Fußball-Liga
- Leistungszentren
- Richtlinien für die Errichtung und Unterhaltung der Leistungszentren
- Allgemeine strukturelle Voraussetzungen für alle Leistungszentren
- Unterschiede der strukturellen Bedingungen für Leistungszentren von Zweitligisten
- Double PASS
- Zertifizierung der Nachwuchsleistungszentren
- Qualitätsdimensionen
- Punktebewertung und -vergabe
- Finanzielle Vorteile
- Gesamtergebnis Zweite Bundesliga
- Zertifizierung der Nachwuchsleistungszentren
- Praxisbeispiel des Zweitligisten VfR Aalen
- Lizenzierung
- Zertifizierung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Nachwuchsförderung im deutschen Profifußball. Ziel ist es, die Strukturen und Prozesse der Nachwuchsförderung im Deutschen-Fußball-Bund (DFB) und in der Deutschen-Fußball-Liga (DFL) zu analysieren und zu bewerten. Dabei wird der Fokus auf die Entwicklung und Implementierung des DFB-Talentförderprogramms sowie auf die Zertifizierung von Nachwuchsleistungszentren durch Double PASS gelegt.
- Die Entwicklung der Nachwuchsförderung im deutschen Fußball
- Das DFB-Talentförderprogramm und seine Ziele
- Die strukturellen Voraussetzungen von Leistungszentren in der DFL
- Das Double PASS-Zertifizierungssystem für Nachwuchsleistungszentren
- Die Praxis der Nachwuchsförderung am Beispiel des VfR Aalen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Nachwuchsförderung im deutschen Profifußball dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Deutschen-Fußball-Bund und dessen Rolle in der Nachwuchsförderung. Hier werden die Historie der Nachwuchsförderung sowie das DFB-Talentförderprogramm mit seinen Zielen und der Ausbildungsstruktur im Detail beleuchtet.
Kapitel 3 behandelt die Deutsche-Fußball-Liga und deren Leistungszentren. Dabei werden die strukturellen Voraussetzungen und Unterschiede zwischen Leistungszentren von Erst- und Zweitligisten analysiert.
Kapitel 4 widmet sich dem Double PASS-Zertifizierungssystem für Nachwuchsleistungszentren. Die Qualitätsdimensionen, die Punktebewertung und die finanziellen Vorteile der Zertifizierung werden erläutert.
Kapitel 5 präsentiert ein Praxisbeispiel der Nachwuchsförderung am Beispiel des Zweitligisten VfR Aalen. Die Lizenzierung und Zertifizierung des Vereins werden im Detail dargestellt.
Schlüsselwörter
Nachwuchsförderung, Deutscher-Fußball-Bund (DFB), Deutsche-Fußball-Liga (DFL), DFB-Talentförderprogramm, Leistungszentren, Double PASS, Zertifizierung, Qualitätsdimensionen, Lizenzierung, Praxisbeispiel, VfR Aalen.
- Quote paper
- Christian Stricker (Author), 2013, Nachwuchsförderung im deutschen Fußball. Die Zweite Bundesliga, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316408