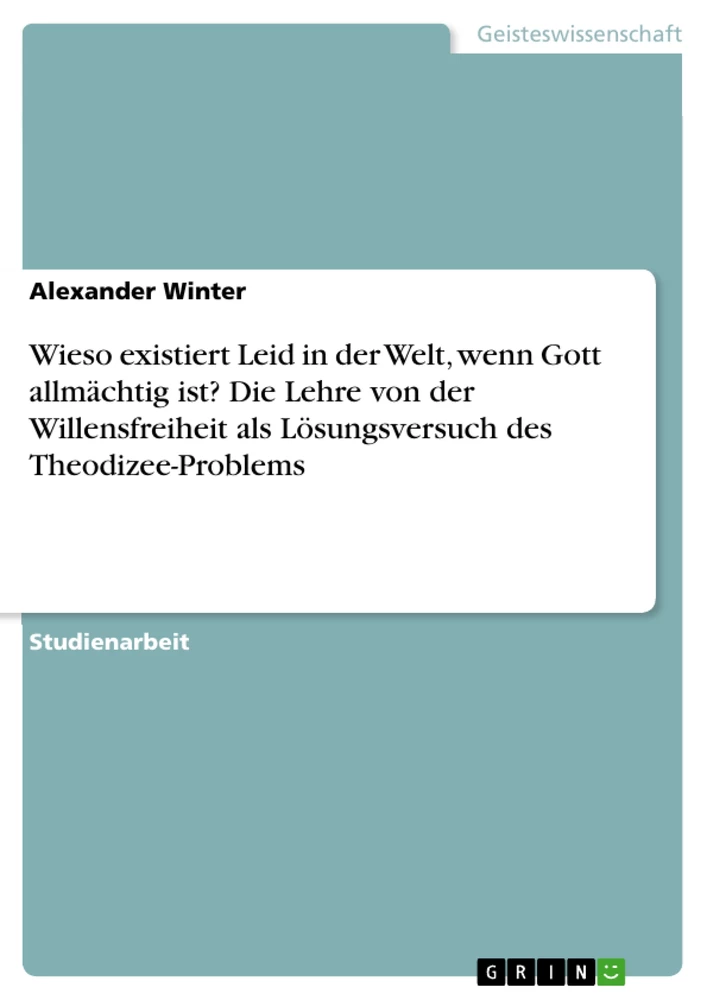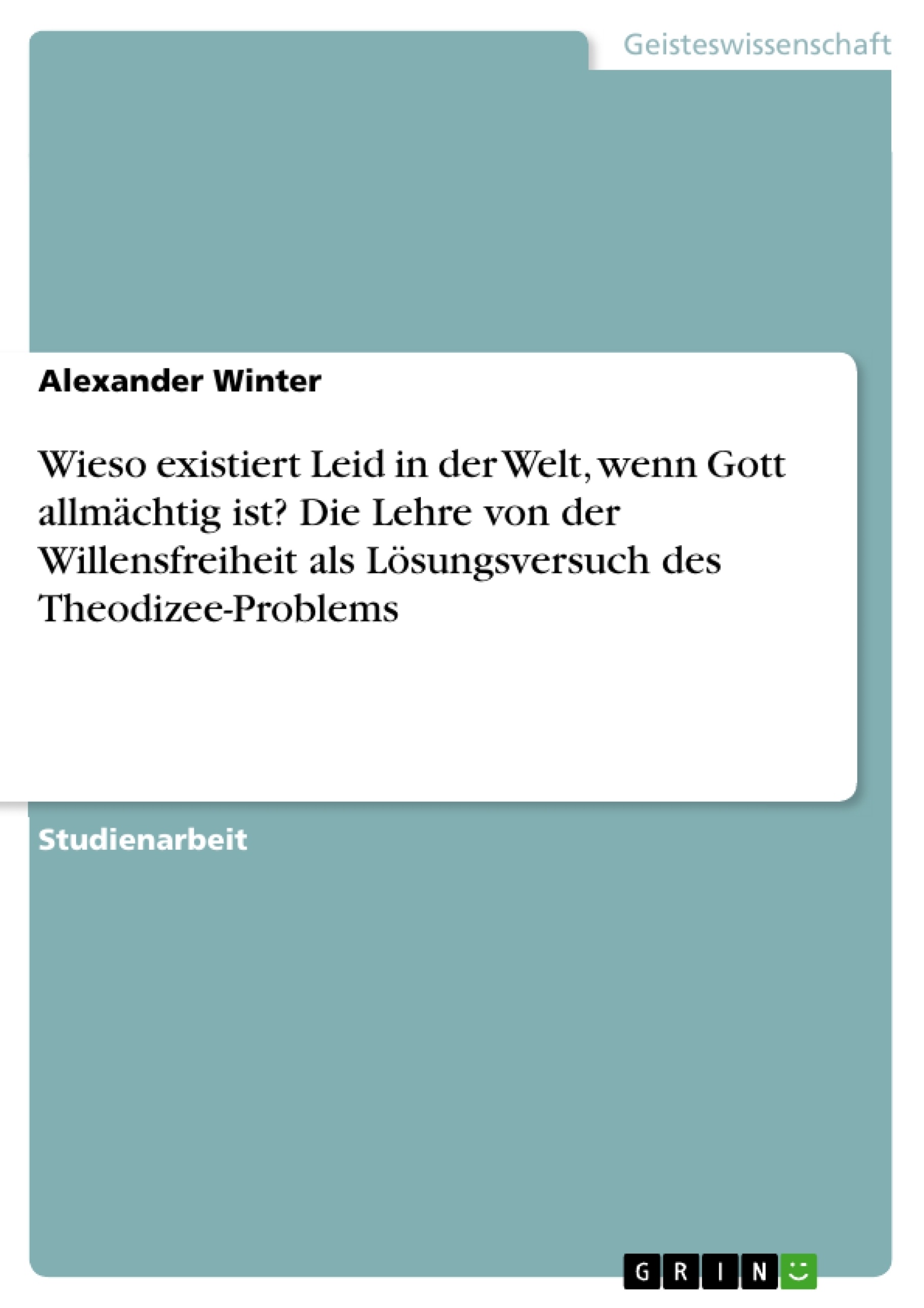Wieso existiert Leid in der Welt, wenn Gott allmächtig ist? Die Frage nach dem Leid in der Welt ist der Stachel im Fleisch der Theologie, des Glaubens an einen guten und allmächtigen Gott, denn es stellt beides in Frage.
Die vorliegende Arbeit will zeigen, dass unser Bild von einem allgütigen und allmächtigen Gott sich sehr wohl mit der Existenz von Leid in der Welt verträgt. Dabei wird auch ein geschichtlicher Abriss des Theodizee-Problems von der Antike bis in die Gegenwart dargestellt.
Als am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 das Unglück über Indonesien, Thailand und andere Länder Südostasiens in Gestalt eines gewaltigen Tsunamis hereinbricht, kommt die Frage auf: Wie kann Gott zulassen, dass Hundertausende sterben, Millionen obdachlos und ganze Städte ausradiert werden?
Diese Katastrophe erinnert an das gewaltige Erdbeben in Lissabon 1755, das schon den Kinderglauben von Johann Wolfgang von Goethe in Frage stellte: ,,Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubens-Artikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen.“
Doch es ist nicht die Allmacht Gottes, die hier eine Grenze findet, sondern unsere Vorstellungen von dieser. Die Allmacht Gottes besteht nämlich nicht darin, dass er alles Schlechte und alle Gefahren, also das Leiden von uns fern hält.
Die folgende Arbeit soll zeigen, dass Gott dem Menschen nichts Böses will, sondern sich in Liebe dem Menschen zuwendet. Diese Liebe drückt sich in der Freiheit aus, die Gott dem Menschen lässt, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Freiheit aus Liebe ist das alles bestimmende Prinzip der Schöpfung und in diesem Zusammenhang muss auch das Leiden, das Bestandteil dieser Schöpfung ist, betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- II) Das Problem der Theodizee
- 1) Die Wirklichkeit des Leidens
- 2) Die Eigenschaften Gottes – Allmacht und Allgüte
- III) Das Argument der Willensfreiheit
- 1) Das formale Argument der Willensfreiheit
- 2) Die Willensfreiheit
- a) Das Anderskönnen
- b) Die Intelligibilität
- c) Die Urheberschaft
- 3) Das Übel/Leid
- 4) Der logische Zusammenhang zwischen Willensfreiheit und Leid
- 5) Der moralische Zusammenhang zwischen Willensfreiheit und Leid
- 6) Willensfreiheit und Erbsünde
- 7) Die Willensfreiheit und die „Seelenbildung“
- IV) Die Kritik des Argumentes der Willensfreiheit
- 1) Praescientia und Praedeterminatio
- 2) Das Bestreiten der Willensfreiheit
- 3) Das Bestreiten der Werthaftigkeit der Freiheit
- 4) Die Willensfreiheit und das natürliche Übel
- V) Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lehre von der Willensfreiheit als Lösungsversuch des Theodizee-Problems. Sie analysiert, ob die göttliche Liebe und die Freiheit des Menschen das Problem des Leidens in der Welt erklären können. Die Arbeit hinterfragt die Vereinbarkeit von Gottes Allmacht und Allgüte mit der Existenz von Leid.
- Das Theodizee-Problem: Die Schwierigkeit, das Leid in der Welt mit der Existenz eines allmächtigen und allgütigen Gottes zu vereinbaren.
- Die Rolle der Willensfreiheit: Die Argumentation, dass Gottes Gewährung der Willensfreiheit den Menschen Leid ermöglicht, aber auch die Möglichkeit zu moralischem Wachstum und einer freien Beziehung zu Gott bietet.
- Kritik des Arguments der Willensfreiheit: Auseinandersetzung mit Einwänden gegen die These, dass Willensfreiheit das Problem des Leidens löst.
- Alternative Lösungsansätze: Untersuchung verschiedener Perspektiven zur Lösung des Theodizee-Problems.
- Das Verhältnis von Gott, Mensch und Leid: Die Analyse der Beziehung zwischen göttlicher Macht, menschlicher Freiheit und der Realität des Leidens.
Zusammenfassung der Kapitel
I) Einleitung: Die Einleitung präsentiert das Theodizee-Problem anhand des Tsunamis von 2004 und des Lissabonner Erdbebens von 1755. Sie stellt die Frage nach Gottes Zulassen von Leid und kündigt die Argumentation an, dass Gottes Liebe sich in der Gewährung menschlicher Freiheit zeigt, wodurch Leid zwar möglich, aber nicht von Gott gewollt ist.
II) Das Problem der Theodizee: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Theodizee“ und beleuchtet das Problem historisch, beginnend mit Epikur. Es werden zwei grundsätzliche Lösungsansätze vorgestellt: die Modifikation der Wirklichkeit des Leidens und die Modifikation der Eigenschaften Gottes (Allmacht).
III) Das Argument der Willensfreiheit: Dieses Kapitel entwickelt das Argument der Willensfreiheit als Lösungsansatz für das Theodizee-Problem. Es wird argumentiert, dass die menschliche Willensfreiheit, als Ausdruck göttlicher Liebe und Allmacht, das Risiko von Leid beinhaltet, aber gleichzeitig die Möglichkeit zu einer freien Beziehung zu Gott und moralischem Wachstum ermöglicht. Die verschiedenen Aspekte der Willensfreiheit (Anderskönnen, Intelligibilität, Urheberschaft) werden erörtert, um deren Rolle im Zusammenhang mit dem Leiden zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Theodizee, Leid, Willensfreiheit, Allmacht, Allgüte, Gott, Güte, Liebe, Moral, Schöpfung, Freiheit, Seelenbildung, Praescientia, Praedeterminatio, natürliches Übel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theodizee und Willensfreiheit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Lehre von der Willensfreiheit als Lösungsversuch des Theodizee-Problems. Sie analysiert, ob die göttliche Liebe und die Freiheit des Menschen das Problem des Leidens in der Welt erklären können und hinterfragt die Vereinbarkeit von Gottes Allmacht und Allgüte mit der Existenz von Leid.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Theodizee-Problem, die Rolle der Willensfreiheit als Lösungsansatz, Kritik an diesem Ansatz, alternative Lösungsansätze und das Verhältnis von Gott, Mensch und Leid. Konkret werden Aspekte wie Gottes Allmacht und Allgüte, menschliches Leid, Willensfreiheit (inkl. Anderskönnen, Intelligibilität und Urheberschaft), Praescientia und Praedeterminatio, sowie das natürliche Übel diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Theodizee-Problem, ein Kapitel zum Argument der Willensfreiheit, ein Kapitel zur Kritik dieses Arguments und abschließende Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit der Definition des Problems und der historischen Einordnung, über die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Argument der Willensfreiheit und seinen Einwänden bis hin zu einer zusammenfassenden Bewertung.
Was ist das Theodizee-Problem?
Das Theodizee-Problem beschreibt die Schwierigkeit, das Leid in der Welt mit der Existenz eines allmächtigen und allgütigen Gottes zu vereinbaren. Die Arbeit illustriert dieses Problem anhand historischer Beispiele wie dem Tsunami von 2004 und dem Lissabonner Erdbeben von 1755.
Wie wird das Argument der Willensfreiheit dargestellt?
Das Argument der Willensfreiheit besagt, dass Gottes Gewährung der Willensfreiheit den Menschen Leid ermöglicht, aber gleichzeitig die Möglichkeit zu moralischem Wachstum und einer freien Beziehung zu Gott bietet. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Aspekte der Willensfreiheit, um deren Rolle im Zusammenhang mit dem Leiden zu verdeutlichen.
Welche Kritikpunkte werden an dem Argument der Willensfreiheit geübt?
Die Arbeit untersucht Einwände gegen die These, dass Willensfreiheit das Problem des Leidens löst. Dazu gehören die Fragen nach Praescientia und Praedeterminatio, das Bestreiten der Willensfreiheit selbst, das Hinterfragen der Werthaftigkeit der Freiheit und die Beziehung zwischen Willensfreiheit und natürlichem Übel.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Theodizee, Leid, Willensfreiheit, Allmacht, Allgüte, Gott, Güte, Liebe, Moral, Schöpfung, Freiheit, Seelenbildung, Praescientia, Praedeterminatio und natürliches Übel.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die behandelten Inhalte. Die Einleitung präsentiert das Problem, Kapitel II definiert die Theodizee und Lösungsansätze, Kapitel III entwickelt das Argument der Willensfreiheit, und Kapitel IV kritisiert dieses Argument.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit philosophischen Fragen der Theodizee und der Willensfreiheit auseinandersetzt.
- Quote paper
- Alexander Winter (Author), 2010, Wieso existiert Leid in der Welt, wenn Gott allmächtig ist? Die Lehre von der Willensfreiheit als Lösungsversuch des Theodizee-Problems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316416