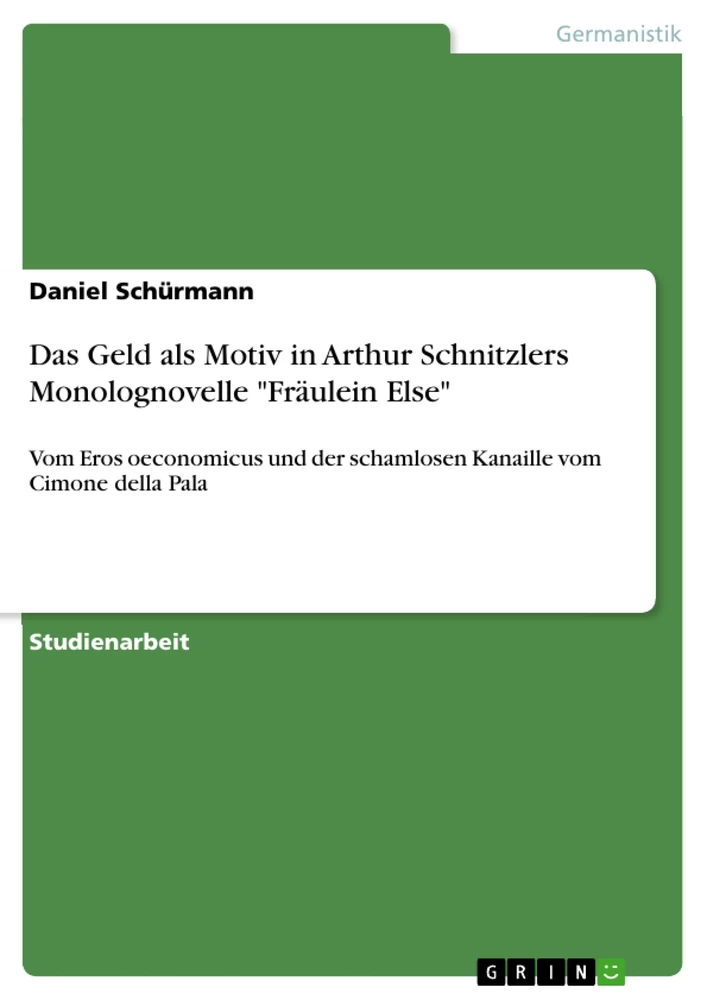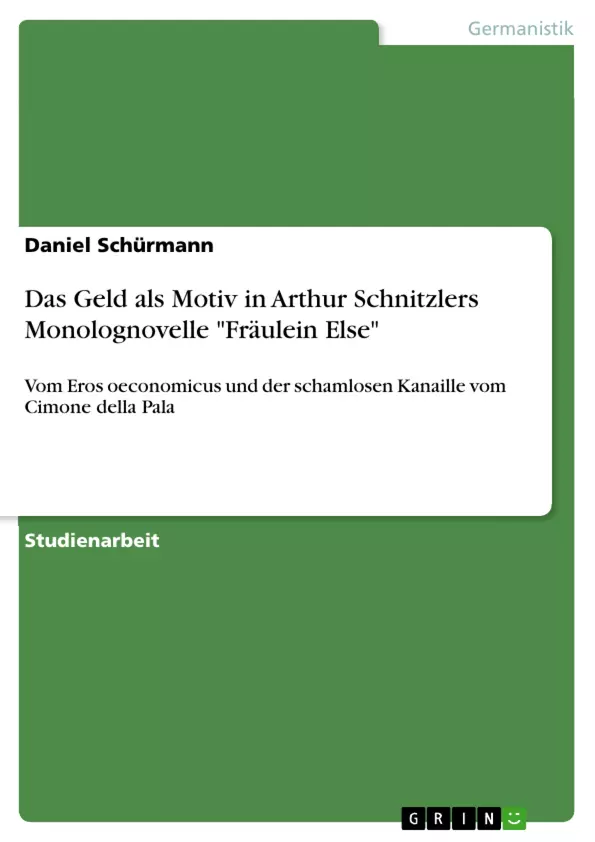Wenn Arthur Schnitzlers Monolognovelle Fräulein Else im Rahmen einer literaturwissenschaftlichen Arbeit unter dem Gesichtspunkt eines Geldmotivs zu interpretieren ist, rekurrieren die Begriffe des Interpretaments auf zumindest dreierlei Problemkomplexe, die sich mit folgenden Fragestellungen kennzeichnen lassen: was ist Geld; was ist ein Motiv; wie oder als was ist ein Geldmotiv in der sogenannte 'Monolognovelle' Fräulein Else zu denken?
Die folgenden Ausführungen stellen den Versuch dar, in der dritten Frage eine Konkretisierung zu leisten, wobei die Gegenstände der beiden ersten nur insoweit theoretisch fundiert werden, als es sie geeignet macht, sich in der Darstellung des Themas als heuristisches Mittel umzusetzen. Die Darstellungsmethode beruht auf der Annahme, dass das Ich seinem inneren Antrieb nach im Geld ein Objekt zur Identifizierung vorfindet. Als Motiv wird zunächst die Quelle eines Drangs und als Geld ein dem subjektiven Drang vorstehendes Bild aufgefasst. Der Motivbegriff kommt zum Tragen, insofern von ihm her die Handlungsstruktur der Novelle aufgrund von Widersprüchen zu beschreiben ist, die im Geldbegriff angelegt sind. Dass das Geldmotiv aber in dieser Weise als Chiffre der Umsetzung eines inneren Drangs aufgefasst wird, trägt dem Umstand Rechnung, der im Begriff von der Monolognovelle enthalten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Monolognovelle und ihr heuristisches Bezugssystem
- A. Der intertextuelle Bezug der Novelle
- B. Zur Technik des inneren Monologs
- C. Zur Novellengattung
- II. Inhaltsangabe
- III. Hauptteil
- A. Erster Teil
- 1. Entwurf des Geldmotivs
- 2. Von der galvanochemischen Kraft der Gesellschaft
- 3. Vom Eros oeconomicus
- B. Zweiter Teil
- 1. Im verlebten Filou das Luder in spe
- 2. Karneval am Schindacker
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Arthur Schnitzlers Monolognovelle „Fräulein Else“ unter dem Aspekt des Geldmotivs zu interpretieren. Dabei werden die Begriffe des Interpretaments auf die Fragestellungen „Was ist Geld?“, „Was ist ein Motiv?“ und „Wie oder als was ist ein Geldmotiv in der Monolognovelle „Fräulein Else“ zu denken?“ bezogen.
- Der intertextuelle Bezug der Novelle zu Freuds psychoanalytischen Schriften, insbesondere „Jenseits des Lustprinzips“ und „Massenpsychologie und Ich-Analyse“.
- Die Technik des inneren Monologs in der Novelle als Mittel der Darstellung von Else Dorsdays innerem Konflikt.
- Die Funktion des Geldmotivs als Chiffre für den inneren Drang und die widersprüchliche Handlungsstruktur der Novelle.
- Die Beziehung zwischen Geld und dem Eros oeconomicus in der Novelle.
- Die Darstellung von Else Dorsdays Rolle als „Luder in spe“ und ihre Verführung durch den Filou.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse, indem sie die Fragestellung der Arbeit umreißt und die heuristische Methode der Interpretation erläutert. Der erste Teil widmet sich dem intertextuellen Bezug der Novelle zu Freuds Schriften, der Technik des inneren Monologs und der Gattung der Novelle. Der zweite Teil analysiert das Geldmotiv in der Novelle und zeigt auf, wie Else Dorsdays Bedingung erfüllt und zugleich von ihr abweicht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Monolognovelle, das Geldmotiv, der innere Monolog, die intertextuelle Bezugnahme auf Freuds Schriften, die Hysterieforschung, der Eros oeconomicus, und die Darstellung von Else Dorsdays „Luder in spe“-Rolle.
- Quote paper
- Daniel Schürmann (Author), 2016, Das Geld als Motiv in Arthur Schnitzlers Monolognovelle "Fräulein Else", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316426