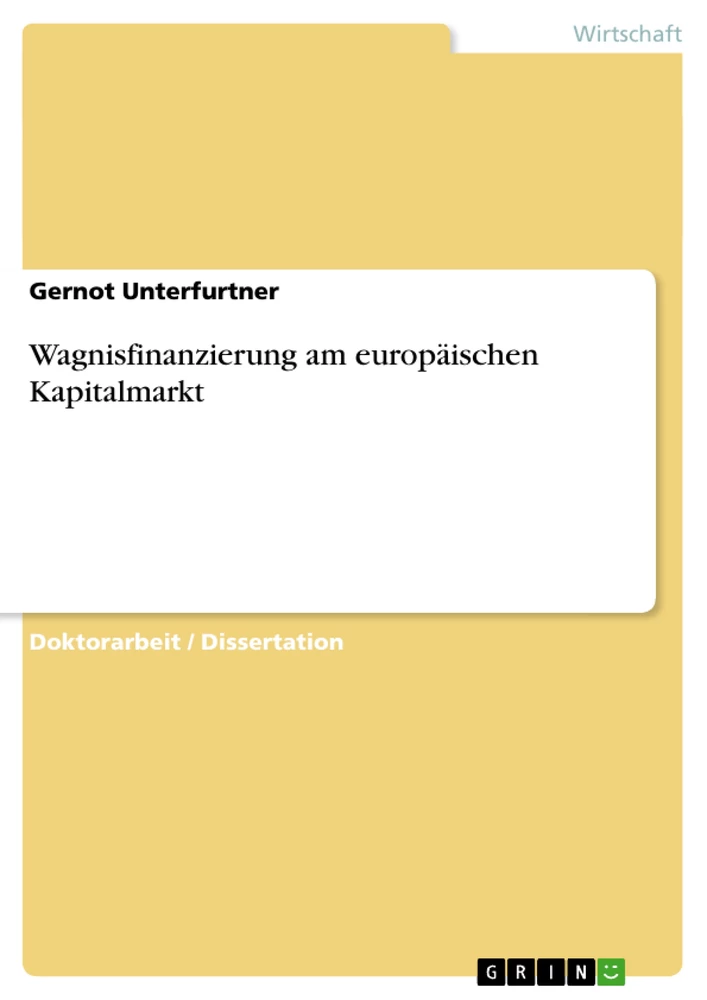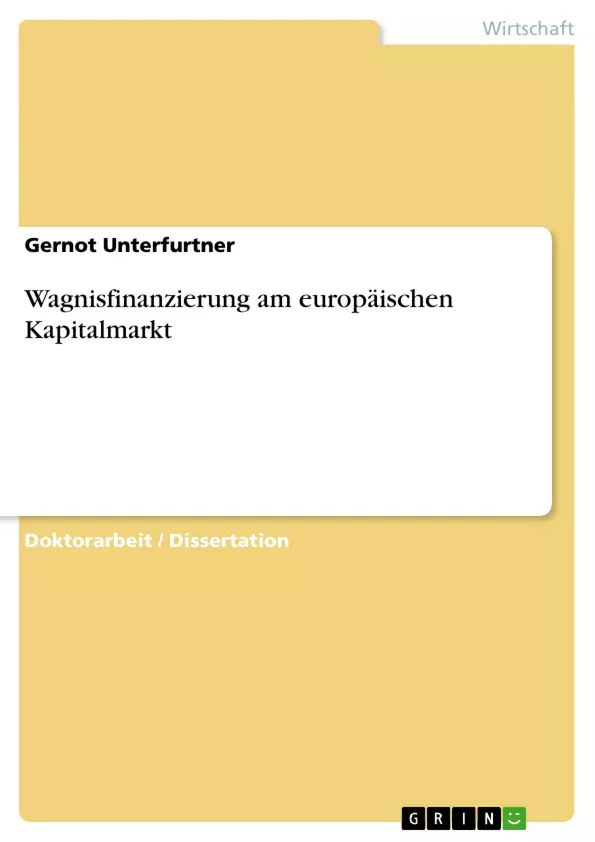Der bis Mitte des Jahres 2000 anhaltende Boom an den Börsen und Märkten endete mit dem Platzen der „New Economy“- Blase. Viele Anleger hatten bis zu diesem Zeitpunkt von - eigentlich gegen jede Logik – stark ansteigenden Kursen profitiert und die großteils technologieorientierten Aktien in schwindende Höhen steigen sehen. Wer aber den richtigen Zeitpunkt zur Gewinnmitnahme übersehen hat und nicht rechtzeitig verkaufte, der musste massive Verluste hinnehmen. Die „New Economy“ wird mit innovativen Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Internet, Biotechnologie, Genforschung, usw. assoziiert. Meist haben sie hohe F&E-Aufwendungen und wachsen schnell, was natürlich einen entsprechenden Kapitalbedarf mit sich bringt. Diese in der Regel oft jungen Betriebe haben es oft schwer entsprechende Finanzmittel von Banken zu erhalten. Vielfach sind daher derartige Unternehmen auch die Nachfrager für „Wagniskapital“. Wagnisfinanzierungsgesellschaften spezialisieren sich auf die Finanzierung solcher junger Unternehmen. Sie engagieren sich am ehesten in einer Branche, in der sie den Markt gut kennen, in dem ihnen die angewandte Technologie bekannt ist und in dem sie in der Lage sind die Konkurrenz einzuschätzen. Die Wagniskapitalgesellschaft verfolgt die Entwicklung des Unternehmens intensiv und ist in wichtige Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Geschäftsführung des finanzierten Unternehmens hat regelmäßige Berichtspflicht an den Beteiligungskapitalgeber. Die erste VC-Gesellschaft dürfte die 1946 von Georges Doriot, einem Harvard Professor, und Ralph E. Flanders, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank in Boston, gegründete American Research and Development Corp. (ARD) gewesen sein, die Kapital für junge Technologieunternehmen im Raum Boston zur Verfügung stellte. Ihren größten Erfolg hatte die ARD mit ihrer Beteiligung an der 1957 von vier Studenten des M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) gegründeten Digital Equipment Corp.; das Investment von US $ 70 000 war 1969 bereits stolze US $ 555 Mio. wert. Die Urheberschaft am Begriff „Venture Capital“ beansprucht Arthur Rock für sich. Rock war es, der sich 1957 für eine Gruppe von Ingenieuren der Shockley Semiconductor Laboratoires in Palo Alto auf die Suche nach Kapitalgebern machte, um sich bei der Vermarktung ihrer „Idee“, des Silicon Transistor, zu unterstützen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gliederung der Arbeit und Problemstellung
- Teil A
- 1. Die Eigenkapitalausstattung eines Unternehmens als kritische Größe
- 1. 1 Österreich
- 1.2 Europäische Union
- 1.3 International / Basel II
- 1.4 Grafik: Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme
- 1.5 Eigenkapital durch Beteiligungsgesellschaften
- 1. 6 Wagniskapital am Beispiel USA
- 2. Finanzierungsstruktur: Kapitalmarkt- versus Kreditmarktorientierung
- 2. 1 Österreichische Finanzierungskultur
- 2. 2 Kapitalmarktorientierung in Österreich
- 3. Einflussfaktoren auf die künftige Entwicklung d. Unternehmensfinanzierung
- 4. Vom Kredit zum Venture Capital
- 5. Risikokapital-Aktionsplan (RCAP) der EU
- 6. Europäische Investitionsbank und europäischer Investitionsfond
- 6. 1 Europäische Investitionsbank (EIB)
- 6. 2 Europäischer Investitionsfond (EIF)
- 7. Herkunft und Aufbringung von Risikokapital
- 7. 1 Aufbringung von Risikokapital in Europa
- 7.2 Wie funktionieren Beteiligungskapitalfonds in der Praxis
- 7.3 Wandelanleihen (Convertible Securities)
- 7.4 Wer stellt Risikokapital zu Verfügung?
- 8. Der Umgang“ mit Risikokapital
- 9. Definitionen
- 9. 1 Private Equity, Venture Capital
- 9. 2 Management Buy-out, Management Buy-in, Leveraged Buy out
- 9. 3 Mezzaninkapital
- 10. Finanzierungsphasen einer PE- bzw. einer VC- Finanzierung
- 10. 1. Early Stages
- 10. 2. Expansions/Later Stages
- 11. Desinvestition oder Exit (Ausstiegsphase)
- 11. 1 Die fünf Exitmöglichkeiten
- 11.2 Pre-IPO-Finanzierungen
- 11.3 Exitvorbereitung und Exitphase
- 11.4 Der Gang an die Börse
- 11.5 Exit-Phantasie versus Exit-Realität
- 11.6 Aktuelle Situation für IPO`s
- 11.7 Zu erfüllende Kriterien vor einem IPO
- 12. Die „neuen Märkte\" und Wachstumsbörsen
- 13. Business Angels als Partner in der „Early Stage\"-Phase
- 14. Risikokapital in der Unternehmensnachfolge
- 14. 1 Unternehmensnachfolge in Österreich
- 14.2 Unternehmensnachfolge in Deutschland
- 14.3 Unternehmensnachfolge in der Schweiz
- 14.4 Vergleich Unternehmensnachfolge und -gründung in Europa
- 15. Risikokapital und Unternehmensgründung
- 15.1 Unternehmensgründung in Österreich
- 15.2 Unternehmensgründung in Deutschland
- 16. Risikokapital in der Unternehmenssanierung
- 17. Idealtypischer Ablauf einer Venture Capital Finanzierung
- 18. Renditeerwartungen bei der Risikokapitalfinanzierung
- Teil B
- 1. Risikokapital in Europa
- 1. 1 Die Anfänge von VC in Europa
- 1. 2 Wirtschaftliche Situation ab 1999
- 1. 3 Die 5 europäischen Länder mit dem größten VC-Volumen
- 1. 4 Private Equity-Investitionen in Europa
- 1. 5 Aufgebrachtes Private Equity-Kapital in Europa
- 1. 6 Private Equity-Investments in Prozent des BIP in Europa
- 1. 7 VC-Investments in Prozent des BIP je Finanzierungsphase
- 1. 8 Aufgebrachtes und investiertes Kapital in Europa (1995-2002)
- 1. 9 Aktuelle Situation der PE- und VC-Branche
- 1.10 Die volkswirtschaftliche Relevanz von Risikokapital
- 2. Aktuelle Situation des europäischen Risikokapitalmarktes
- 3. Der Markt für Risikokapital in Großbritannien
- 4. Der Markt für Risikokapital in Frankreich
- 5. Der Markt für Risikokapital in Italien
- 6. Der Markt für Risikokapital in Deutschland
- 7. Der Markt für Risikokapital in den Niederlanden
- 8. Der Markt für Risikokapital in Österreich
- 8. 1 Initiative zur Förderung der Kapitalmarktes
- 8. 2 Wichtige Kennzahlen des österreichischen Kapitalmarktes
- 8.3 Tabelle der wesentlichen Aktienmarktindikatoren
- 8. 4 Zukunftsvorsorge-Modell
- 8.5 Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft (MFG)
- 8.6 Staatliche Fördermaßnahmen
- a) Gewinnwertpapier
- b) Technologiefinanzierungsprogramm
- c) Double-Equity-Garantiefonds
- d) Eigenkapitalgarantie
- e) Gründungssparen
- f) 12-die Börse für Businessangles
- g) Kapitalgarantie
- h) Preseed-Finanzierung
- i) Seedfinancing
- j) uni venture fonds
- 8.7 Steuerliche Maßnahmen
- Teil C
- 1. Maßnahmen zur Belebung des Risikokapitalmarktes in Österreich
- 2. Ergebnisse einer Befragung per E-Mail
- 3. EVCA Benchmark-Studie
- Eigenkapitalausstattung von Unternehmen
- Finanzierungsstruktur und -kultur in Europa
- Einflussfaktoren auf die Unternehmensfinanzierung
- Rolle von Venture Capital und Private Equity
- Initiativen zur Förderung des Risikokapitalmarktes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation "Wagnisfinanzierung am europäischen Kapitalmarkt" zielt darauf ab, die Bedeutung und die Funktionsweise von Wagniskapital am europäischen Kapitalmarkt zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Finanzierung von jungen, innovativen Unternehmen im europäischen Kontext verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Dissertation legt die Problemstellung und die Gliederung der Arbeit dar. Teil A der Arbeit widmet sich den Grundlagen der Wagnisfinanzierung, einschließlich der Eigenkapitalausstattung von Unternehmen, der Finanzierungsstruktur, dem Einfluss von Risikokapital und der Funktionsweise von Venture Capital Fonds.
Teil B analysiert die aktuelle Situation des europäischen Risikokapitalmarktes, wobei die Schwerpunkte auf den Märkten in Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden und Österreich liegen.
Teil C der Arbeit beleuchtet Maßnahmen zur Belebung des Risikokapitalmarktes in Österreich, basierend auf einer E-Mail-Befragung und einer EVCA Benchmark-Studie.
Schlüsselwörter
Die Dissertation behandelt Themen wie Wagnisfinanzierung, Venture Capital, Private Equity, Unternehmensfinanzierung, Kapitalmarkt, Risikokapital, IPO, Unternehmensgründung, Unternehmensnachfolge, Unternehmenssanierung, europäischer Kapitalmarkt, Finanzierungslandschaft, Förderung von Startups, staatliche Förderprogramme, und Investitionslandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Wagniskapital (Venture Capital)?
Venture Capital ist Beteiligungskapital für junge, innovative Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die oft keinen Zugang zu klassischen Bankkrediten haben.
Wie funktioniert der Exit bei einer VC-Finanzierung?
Es gibt verschiedene Exitmöglichkeiten wie den Börsengang (IPO), den Verkauf an ein anderes Unternehmen (Trade Sale) oder den Rückkauf durch die Gründer.
Welche Rolle spielen Business Angels in der Early-Stage-Phase?
Business Angels stellen in sehr frühen Phasen nicht nur Kapital, sondern auch Know-how und Kontakte zur Verfügung, um Startups beim Aufbau zu unterstützen.
Was ist der Unterschied zwischen Private Equity und Venture Capital?
Venture Capital konzentriert sich auf junge Startups, während Private Equity eher in etablierte Unternehmen investiert, oft im Rahmen von Management Buy-outs.
Wie ist die Situation für Risikokapital in Österreich?
Die Arbeit analysiert staatliche Fördermaßnahmen wie den Double-Equity-Garantiefonds und Initiativen zur Belebung des österreichischen Kapitalmarktes.
- Arbeit zitieren
- Gernot Unterfurtner (Autor:in), 2004, Wagnisfinanzierung am europäischen Kapitalmarkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31647