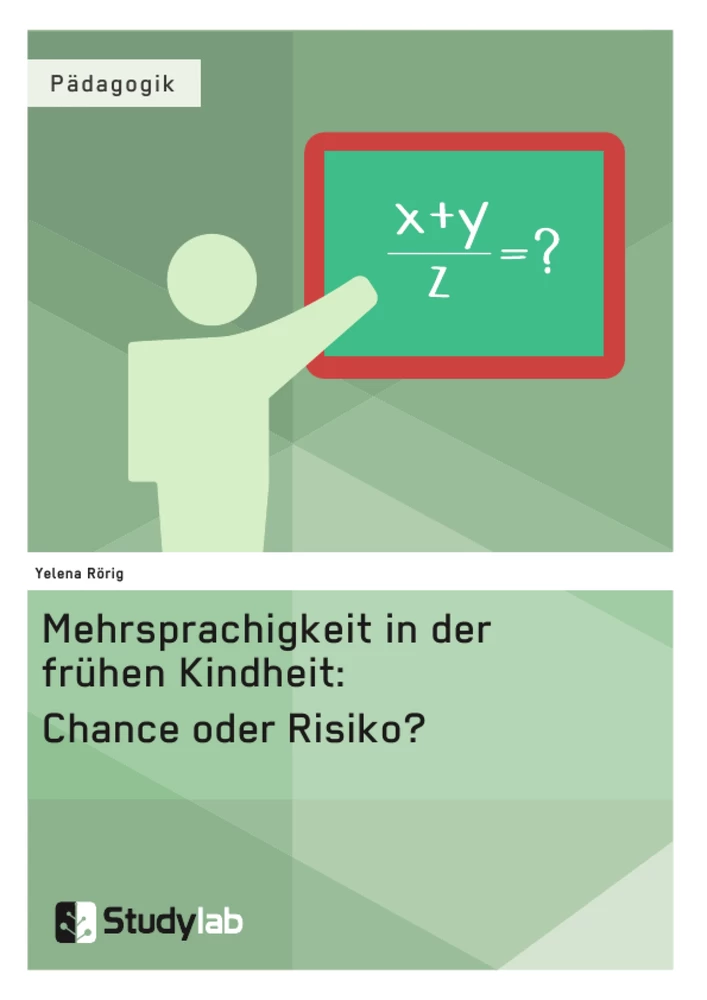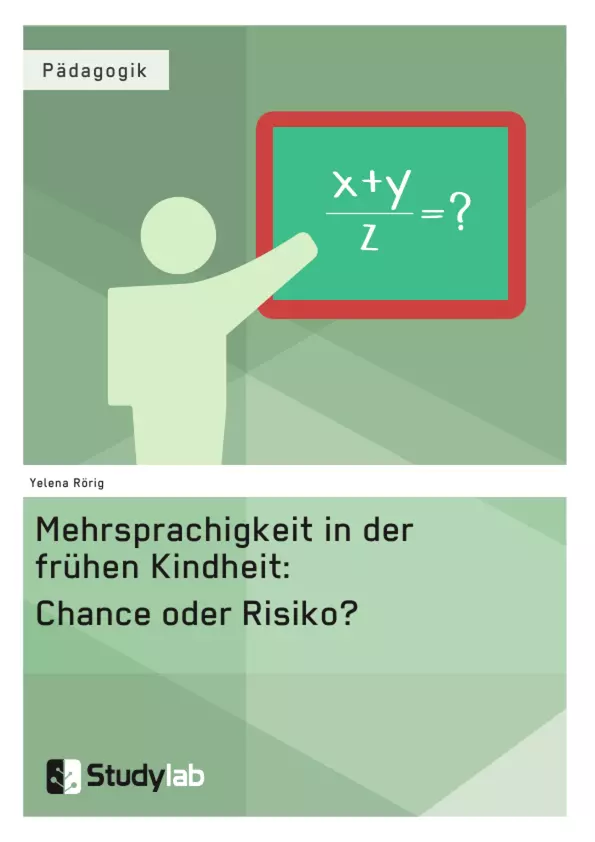Die Bedeutung der Sprache für die individuelle intellektuelle Entwicklung als Mensch zeigt sich auch in den nachfolgenden Zitaten: „Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet“ (Frank Harris (1856–1931)). Und: „Je mehr Sprachen Du sprichst, desto größer bist Du als Mensch“ deutlich (Hammes-Di Bernardo 2008, S. 6).
Die Bundesrepublik Deutschland zieht aus verschiedenen Gründen wie zum Beispiel Wohlstand oder auch nur als kriegsfreie Zone zahlreiche Migranten an. Dies führt dazu, dass Deutschland weltweit eines der beliebtesten Zuwanderungsländer geworden ist. Aus diesem Grund wachsen immer mehr Kinder mehrsprachig auf, indem sie sowohl die Sprache der Eltern als auch Deutsch lernen. Viele dieser Eltern mit Migrationshintergrund sind jedoch unsicher, ob sie ihre Kinder zweisprachig erziehen oder aufwachsen lassen sollen. Sie fragen sich, welchen Einfluss die Zweisprachigkeit auf die Kinder hat und ob sie deren Entwicklung fördert, verzögert oder gar erschwert (vgl. Soultanian 2012, S. 7).
Mehrsprachigkeit ist weltweit sicherlich keine Ausnahme und auch circa ein Drittel der in Deutschland aufwachsenden Kinder ist bilingual. Nichtsdestotrotz wird die Fähigkeit, in zwei Sprachen zu kommunizieren, in der schulischen Praxis und der Gesellschaft tendenziell eher kritisch, wenn nicht sogar negativ gesehen. Kinder, die beispielsweise türkisch sprechen, werden in der Öffentlichkeit als Problemfälle wahrgenommen, da sie statistisch gesehen zu den Verlierern des Bildungssystems gehören. Der Kern des Problems liegt jedoch nicht in der Mehrsprachigkeit selbst, sondern im Umgang mit ihr. In Deutschland herrscht weiterhin überwiegend die Meinung, dass semilinguale Mehrsprachige und ihre Eltern selbst an der unterentwickelten sprachlichen Kompetenz schuld seien, da sie sich nicht integrieren wollen. De facto ist es dem Bildungssystem indes nicht gelungen, die sprachlichen Qualifikationen sowohl der Mutter- als auch der Zweitsprache so zu fördern, dass in beiden Sprachen ausreichende Fähigkeiten erworben werden (vgl. Belke 2012, S. 2).
Auf Basis dieser Überlegungen lautet das Thema dieser Arbeit: Stellt Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit eine Chance oder ein Risiko dar?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundsätzliches zum Erstspracherwerb
- 2.1 Zum Begriff Sprache
- 2.2 Die Phasen des Spracherwerbs
- 2.3 Die Erstsprache als Fundament für den Erwerb der Zweitsprache
- 2.4 Die Rolle der Erstsprache für die Identitätsentwicklung
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Grundlagen zur Mehrsprachigkeit
- 3.1 Zum Begriff Mehrsprachigkeit
- 3.2 Fakten und Zahlen über Mehrsprachigkeit
- 3.3 Mehrsprachigkeit aus neurologischer Sicht
- 3.4 Familien- und Umgebungssprache
- 3.5 Starke und schwache Sprache
- 3.7 Zusammenfassung
- 4. Die Mehrsprachigkeit beeinflussende Faktoren
- 4.1 Art des sprachlichen Angebotes
- 4.2 Form der Förderung
- 4.3 Motivation und Emotionalität
- 4.4 Familiärer Sprachgebrauch
- 4.5 Alter bei Spracherwerbsbeginn
- 4.6 Zusammenfassung
- 5. Arten der Mehrsprachigkeit
- 5.1 Simultane versus sukzessive Mehrsprachigkeit
- 5.2 Natürliche versus gesteuerte Mehrsprachigkeit
- 5.3 Additive versus subtraktive Mehrsprachigkeit
- 5.4 Zusammenfassung
- 6. Pro und Kontra früher Mehrsprachigkeit
- 6.1 Vorteile der Mehrsprachigkeit
- 6.1.1 Steigerung der Kommunikationsfähigkeit
- 6.1.2 Interkulturelle Kompetenz
- 6.1.3 Bessere Berufschancen
- 6.1.4 Kognitiver Aspekt
- 6.1.5 Erhöhung der Aufmerksamkeitskontrolle
- 6.2 Nachteile der Mehrsprachigkeit
- 6.2.1 Sprachverweigerung
- 6.2.2 Doppelte Halbsprachigkeit
- 6.2.3 Sprachverlust bei Mehrsprachigkeit
- 6.2.4 Negativer Transfer beim Zweitspracherwerb
- 6.2.5 Kindlicher Sprachwechsel und Sprachmischungen
- 6.3 Zusammenfassung
- 6.1 Vorteile der Mehrsprachigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit. Ziel ist es, die Chancen und Risiken frühkindlicher Mehrsprachigkeit abzuwägen und einen umfassenden Überblick über die relevanten Faktoren zu geben. Die Arbeit beleuchtet sowohl die positiven Aspekte wie verbesserte kognitive Fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz, als auch die potenziellen Herausforderungen wie Sprachverzögerungen oder Sprachmischung.
- Erstspracherwerb und seine Grundlagen
- Definition und Ausprägungen von Mehrsprachigkeit
- Einflussfaktoren auf den Mehrsprachigkeitserwerb
- Vorteile und Nachteile früher Mehrsprachigkeit
- Zusammenfassende Bewertung der Chancen und Risiken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit ein und legt den Fokus auf die Fragestellung, ob Mehrsprachigkeit in diesem Kontext eher als Chance oder Risiko zu betrachten ist. Es bietet eine erste Annäherung an die Komplexität des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Grundsätzliches zum Erstspracherwerb: Das Kapitel behandelt die Grundlagen des Erstspracherwerbs, beginnend mit einer Definition des Begriffs "Sprache" selbst. Es beschreibt die verschiedenen Phasen des Spracherwerbs und betont die fundamentale Rolle der Erstsprache für den späteren Erwerb weiterer Sprachen. Die Bedeutung der Erstsprache für die Entwicklung der kindlichen Identität wird ebenfalls beleuchtet. Zusammenfassend legt dieses Kapitel den notwendigen Grundstein für das Verständnis der späteren Diskussion um Mehrsprachigkeit.
3. Grundlagen zur Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Mehrsprachigkeit und liefert statistische Daten zur Verbreitung mehrsprachiger Kinder. Es beleuchtet die neurologischen Aspekte von Mehrsprachigkeit, diskutiert den Einfluss von Familien- und Umgebungssprache sowie den Unterschied zwischen starken und schwachen Sprachen. Das Kapitel bietet somit ein fundiertes Verständnis der verschiedenen Facetten von Mehrsprachigkeit.
4. Die Mehrsprachigkeit beeinflussende Faktoren: Hier werden die verschiedenen Faktoren untersucht, die den Erwerb von Mehrsprachigkeit beeinflussen. Dies beinhaltet die Art des sprachlichen Angebots, die Art der sprachlichen Förderung, die Motivation und Emotionalität des Kindes, den familiären Sprachgebrauch sowie das Alter des Kindes beim Beginn des Spracherwerbs. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel dieser Faktoren und ihrer Bedeutung für den Erfolg des Mehrsprachigkeitserwerbs.
5. Arten der Mehrsprachigkeit: Das Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Arten der Mehrsprachigkeit, unterscheidet zwischen simultaner und sukzessiver Mehrsprachigkeit, natürlicher und gesteuerter Mehrsprachigkeit sowie additiver und subtraktiver Mehrsprachigkeit. Es analysiert die unterschiedlichen Bedingungen und Konsequenzen dieser verschiedenen Formen von Mehrsprachigkeit.
6. Pro und Kontra früher Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel stellt die Vor- und Nachteile einer frühen Mehrsprachigkeit gegenüber. Es werden detailliert die Vorteile wie die Steigerung der Kommunikationsfähigkeit, die Entwicklung interkultureller Kompetenz, die Verbesserung der Berufschancen sowie positive Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten und die Aufmerksamkeitskontrolle diskutiert. Gleichzeitig werden potenzielle Nachteile wie Sprachverweigerung, doppelte Halbsprachigkeit, Sprachverlust und negativer Transfer im Zweitspracherwerb sowie Sprachmischung analysiert.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, frühe Kindheit, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, kognitive Entwicklung, interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Chancen, Risiken, simultane Mehrsprachigkeit, sukzessive Mehrsprachigkeit, additive Mehrsprachigkeit, subtraktive Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Auswirkungen der Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Abwägung von Chancen und Risiken frühkindlicher Mehrsprachigkeit.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernbereiche: Grundlagen des Erstspracherwerbs, Definition und verschiedene Ausprägungen von Mehrsprachigkeit (simultane, sukzessive, additive, subtraktive Mehrsprachigkeit), Faktoren, die den Mehrsprachigkeitserwerb beeinflussen (sprachliches Angebot, Förderung, Motivation, familiärer Sprachgebrauch, Alter), Vorteile (verbesserte kognitive Fähigkeiten, interkulturelle Kompetenz, Berufschancen) und Nachteile (Sprachverzögerungen, Sprachmischung, Sprachverlust) früher Mehrsprachigkeit.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundsätzliches zum Erstspracherwerb, Grundlagen zur Mehrsprachigkeit, Einflussfaktoren auf den Mehrsprachigkeitserwerb, Arten der Mehrsprachigkeit und Pro und Kontra früher Mehrsprachigkeit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Vorteile werden mit früher Mehrsprachigkeit in Verbindung gebracht?
Das Dokument nennt folgende Vorteile: Steigerung der Kommunikationsfähigkeit, Entwicklung interkultureller Kompetenz, bessere Berufschancen, positive Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten (z.B. Aufmerksamkeitskontrolle).
Welche Risiken werden mit früher Mehrsprachigkeit in Verbindung gebracht?
Zu den genannten Risiken gehören: Sprachverweigerung, doppelte Halbsprachigkeit, Sprachverlust, negativer Transfer beim Zweitspracherwerb, Sprachmischung.
Welche Faktoren beeinflussen den Mehrsprachigkeitserwerb?
Der Erwerb von Mehrsprachigkeit wird beeinflusst durch: die Art des sprachlichen Angebots, die Art der sprachlichen Förderung, die Motivation und Emotionalität des Kindes, den familiären Sprachgebrauch und das Alter des Kindes beim Beginn des Spracherwerbs.
Welche Arten der Mehrsprachigkeit werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen simultaner und sukzessiver Mehrsprachigkeit, natürlicher und gesteuerter Mehrsprachigkeit sowie additiver und subtraktiver Mehrsprachigkeit.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Ziel ist es, die Chancen und Risiken frühkindlicher Mehrsprachigkeit abzuwägen und einen umfassenden Überblick über die relevanten Faktoren zu geben. Es soll ein ausgewogenes Bild der Komplexität des Themas vermittelt werden.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Thema Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit auseinandersetzen möchten. Es eignet sich für Studierende, Wissenschaftler und alle, die ein tiefergehendes Verständnis der Thematik suchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, frühe Kindheit, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, kognitive Entwicklung, interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Chancen, Risiken, simultane Mehrsprachigkeit, sukzessive Mehrsprachigkeit, additive Mehrsprachigkeit, subtraktive Mehrsprachigkeit.
- Quote paper
- Yelena Rörig (Author), 2016, Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit: Chance oder Risiko?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316482