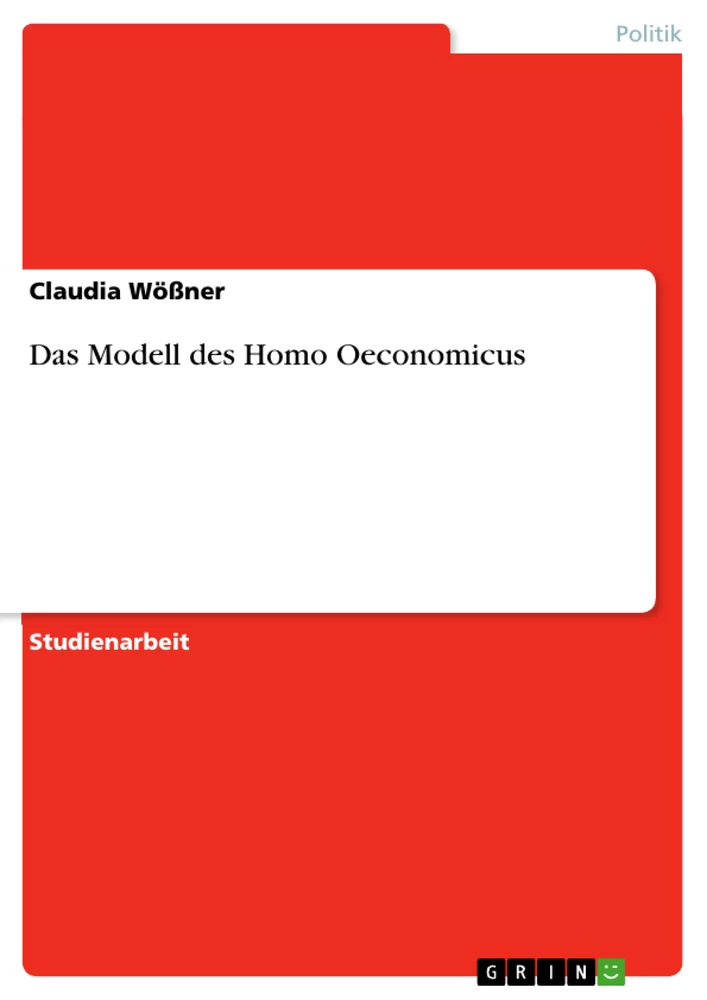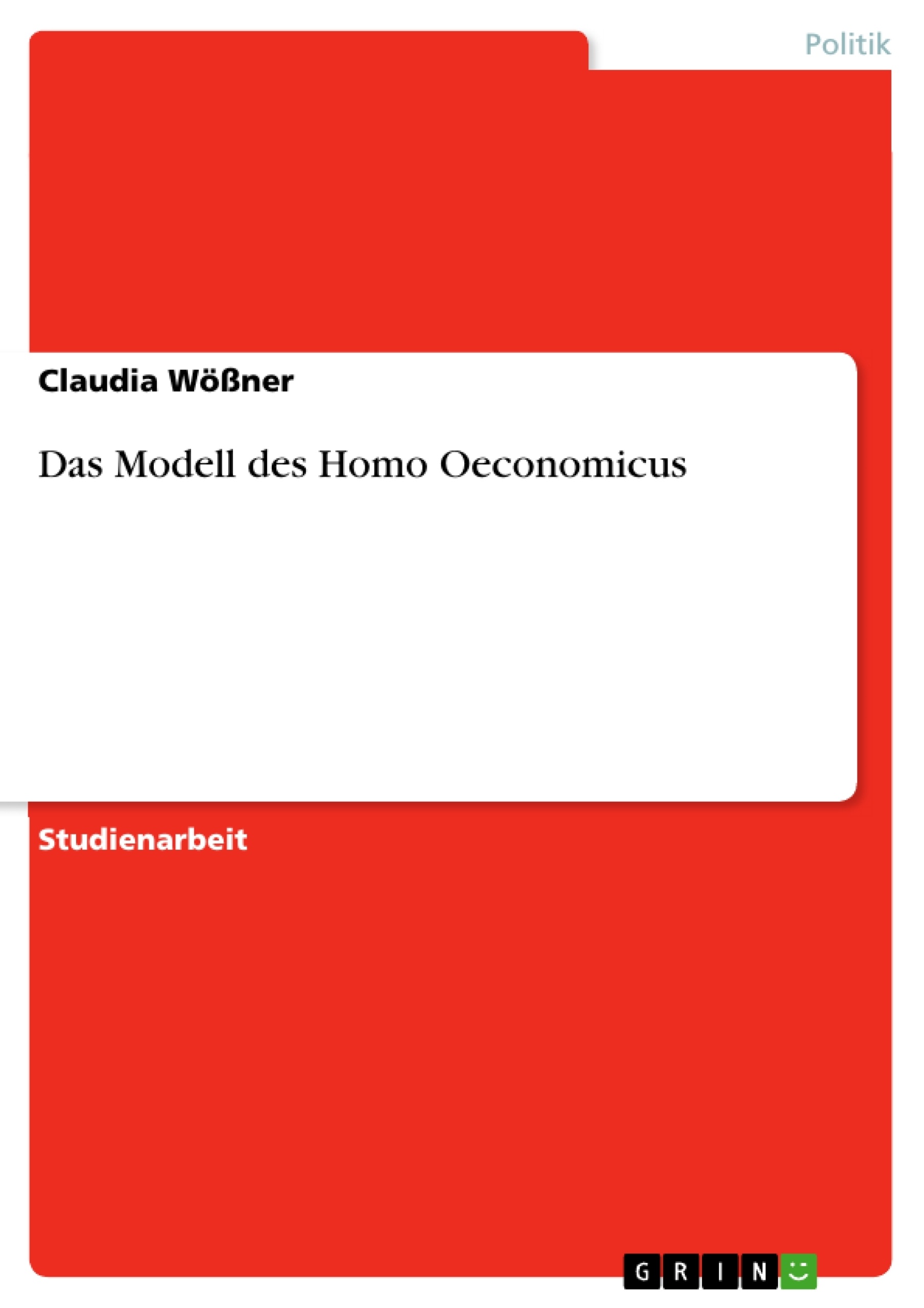Die Wurzeln des homo oeconomicus lassen sich bereits im 18. Jahrhundert bei dem Philosophen und Staatstheoretiker Adam Smith entdecken, währenddessen Dahrendorf erst 1958 zu der Gedankenkonstruktion des homo sociologicus fand. Allerdings hat das ökonomische Verhaltensmodell des homo oeconomicus und andere Lehrsätze der Wirtschaftswissenschaft nicht die dramatische Asien-Krise und den längsten anhaltenden Aufschwung der US-amerikanischen Geschichte in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kommen sehen. Die Politik konnte sich nicht auf die Empfehlungen der Ökonomen verlassen. In der hier vorliegenden Hausarbeit möchte der Autor daher aus der Sicht der modernen Politikwissenschaft der Problemstellung nachgehen, ob das Verhaltensmodell des homo oeconomicus die Möglichkeit eröffnet, menschliches Handeln erklären und eventuell sogar vorhersehen zu können – kann das Modell des homo oeconomicus die Verhaltensweise eines Menschen erklären und prognostizieren? Oder bedarf es vielleicht einer Modellerweiterung, um die oben geschilderten Fehlprognosen zu verhindern?
Um diese Frage hinreichend näher zu beleuchten und abschließend eine Antwort formulieren zu können, wird im Folgenden zunächst eingehend das Modell als solches mit seinen hervorstechenden Charakteristika vorgestellt werden (Kapitel 1), ehe sich der argumentative Teil anschließt. Im Verlauf der Argumentation wird der Autor die Kritiker des Modells zu Wort kommen lassen und diskutieren (Kapitel 2), inwieweit diese Kritik gerechtfertigt ist. Dabei werden dem Leser zwei durchaus interessante Experimente zur Veranschaulichung unterbreitet. Nachdem auf diese Weise die Grenzen des Modells ausgelotet worden sind, wird in der Zusammenfassung die Ausgangsfrage unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse wieder aufgegriffen, um zu sehen, ob das Verhaltensmodell des homo oeconomicus sich in der Realität bewährt hat und geeignet ist, menschliche Verhaltensweisen und menschliches Handeln erklären und prognostizieren zu können. Überdies wird abschließend betrachtet, ob eine begrenzte Erweiterung oder sogar eine totale Revision des Modells angeraten ist, um Politik und Gesellschaft verlässliche Prognosen bieten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Das ökonomische Verhaltensmodell des homo oeconomicus
- 1.1. Präferenzen und Restriktionen
- 1.2. Situationen und Probleme der Interdependenz
- 2. Grenzen des Modells
- 2.1. Bounded Rationality
- 2.2. Zwei Experimente
- 2.3. Niedrigkostensituationen
- 1. Das ökonomische Verhaltensmodell des homo oeconomicus
- III. Zusammenfassung
- IV. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit des ökonomischen Verhaltensmodells des homo oeconomicus auf menschliches Handeln. Ziel ist es zu klären, ob das Modell menschliches Verhalten erklären und prognostizieren kann oder ob es einer Erweiterung bedarf. Die Arbeit analysiert das Modell, seine Kritikpunkte und präsentiert illustrative Experimente.
- Das ökonomische Verhaltensmodell des homo oeconomicus
- Grenzen des Modells und Kritikpunkte
- Experimentelle Überprüfung des Modells
- Möglichkeiten der Modellerweiterung
- Relevanz des Modells für Politik und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Erklär- und Prognosefähigkeit des homo-oeconomicus-Modells. Sie begründet die Relevanz der Fragestellung im Kontext der zunehmenden Ökonomisierung der Lebenswelten und verweist auf die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit diesem Modell auch in den Sozialwissenschaften, insbesondere vor dem Hintergrund von Fehlprognosen wie der Asienkrise. Der methodische Aufbau der Arbeit wird skizziert.
II. Hauptteil, Kapitel 1. Das ökonomische Verhaltensmodell des homo oeconomicus: Dieses Kapitel definiert den homo oeconomicus als einen rational handelnden Akteur, der seinen Nutzen maximiert. Es beleuchtet die Wurzeln des Konzepts bei Adam Smith und anderen Denkern der Aufklärung und diskutiert die Grundannahmen des Modells, einschließlich der Rolle von Präferenzen, Restriktionen und der „unsichtbaren Hand“ im Kontext des freien Marktes. Die Kapitel verdeutlicht, dass das Modell ein vereinfachtes Bild des menschlichen Handelns darstellt, das auf der Annahme rationaler Entscheidungen beruht.
II. Hauptteil, Kapitel 2. Grenzen des Modells: Dieses Kapitel widmet sich der Kritik am homo-oeconomicus-Modell. Es wird die „Bounded Rationality“ diskutiert, die die Grenzen der menschlichen Rationalität hervorhebt. Zwei Experimente veranschaulichen die Abweichungen des realen menschlichen Verhaltens vom Modell. Der Abschnitt zu Niedrigkostensituationen untersucht weitere konkrete Grenzen und Herausforderungen des Modells, basierend auf beobachtbaren Verhaltensweisen in solchen Situationen. Insgesamt wird die Gültigkeit des Modells in realen Kontexten infrage gestellt und mögliche Schwächen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Homo oeconomicus, Verhaltensmodell, Rationalität, Bounded Rationality, Ökonomisierung der Lebenswelten, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Prognosefähigkeit, Modellkritik, Experimente.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Anwendbarkeit des Modells des Homo Oeconomicus
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit des ökonomischen Verhaltensmodells des Homo Oeconomicus auf menschliches Handeln. Sie analysiert das Modell, seine Stärken und Schwächen, und prüft, ob es menschliches Verhalten erklären und prognostizieren kann.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das ökonomische Verhaltensmodell des Homo Oeconomicus, seine Grenzen (insbesondere die "Bounded Rationality"), illustrative Experimente, die vom Modell abweichen, und die Relevanz des Modells für Politik und Gesellschaft. Die Kapitel befassen sich mit Präferenzen und Restriktionen rationaler Akteure, Niedrigkostensituationen und Möglichkeiten der Modellerweiterung.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in vier Teile gegliedert: Eine Einleitung, einen Hauptteil mit zwei Kapiteln (das ökonomische Verhaltensmodell des Homo Oeconomicus und dessen Grenzen), eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis. Der Hauptteil analysiert das Modell, seine Kritikpunkte und präsentiert illustrative Experimente. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den methodischen Aufbau. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Kritikpunkte am Homo-Oeconomicus-Modell werden angesprochen?
Die Hausarbeit kritisiert das Modell des Homo Oeconomicus, indem sie die "Bounded Rationality" (beschränkte Rationalität) diskutiert und durch zwei Experimente die Abweichungen des realen menschlichen Verhaltens vom Modell veranschaulicht. Auch werden die Grenzen des Modells in Niedrigkostensituationen beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Homo oeconomicus, Verhaltensmodell, Rationalität, Bounded Rationality, Ökonomisierung der Lebenswelten, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Prognosefähigkeit, Modellkritik, Experimente.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist es zu klären, ob das Modell des Homo Oeconomicus menschliches Verhalten erklären und prognostizieren kann oder ob es einer Erweiterung bedarf. Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendbarkeit des Modells zu evaluieren und seine Grenzen aufzuzeigen.
Welche Beispiele oder Experimente werden verwendet?
Die Hausarbeit präsentiert zwei Experimente, die die Abweichungen des realen menschlichen Verhaltens vom Modell des Homo Oeconomicus veranschaulichen. Die genauen Experimente werden im Hauptteil detailliert beschrieben.
Welche Bedeutung hat das Modell für Politik und Gesellschaft?
Die Hausarbeit diskutiert die Relevanz des Homo-Oeconomicus-Modells für Politik und Gesellschaft, insbesondere vor dem Hintergrund von Fehlprognosen (z.B. Asienkrise) und der zunehmenden Ökonomisierung der Lebenswelten. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit diesem Modell auch in den Sozialwissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Claudia Wößner (Autor:in), 2004, Das Modell des Homo Oeconomicus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31650