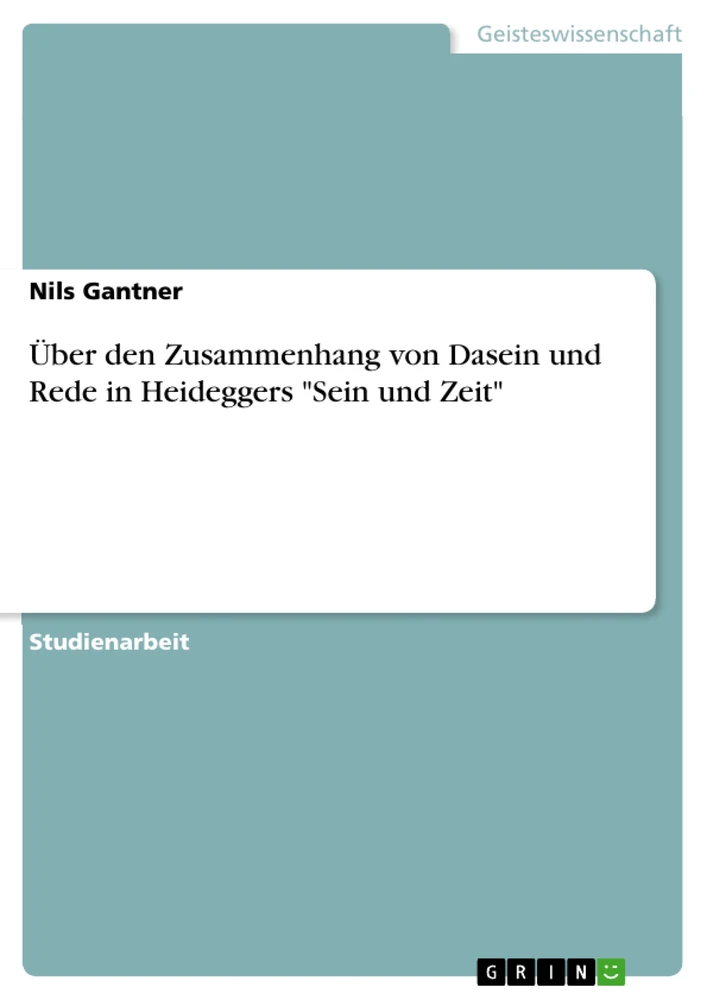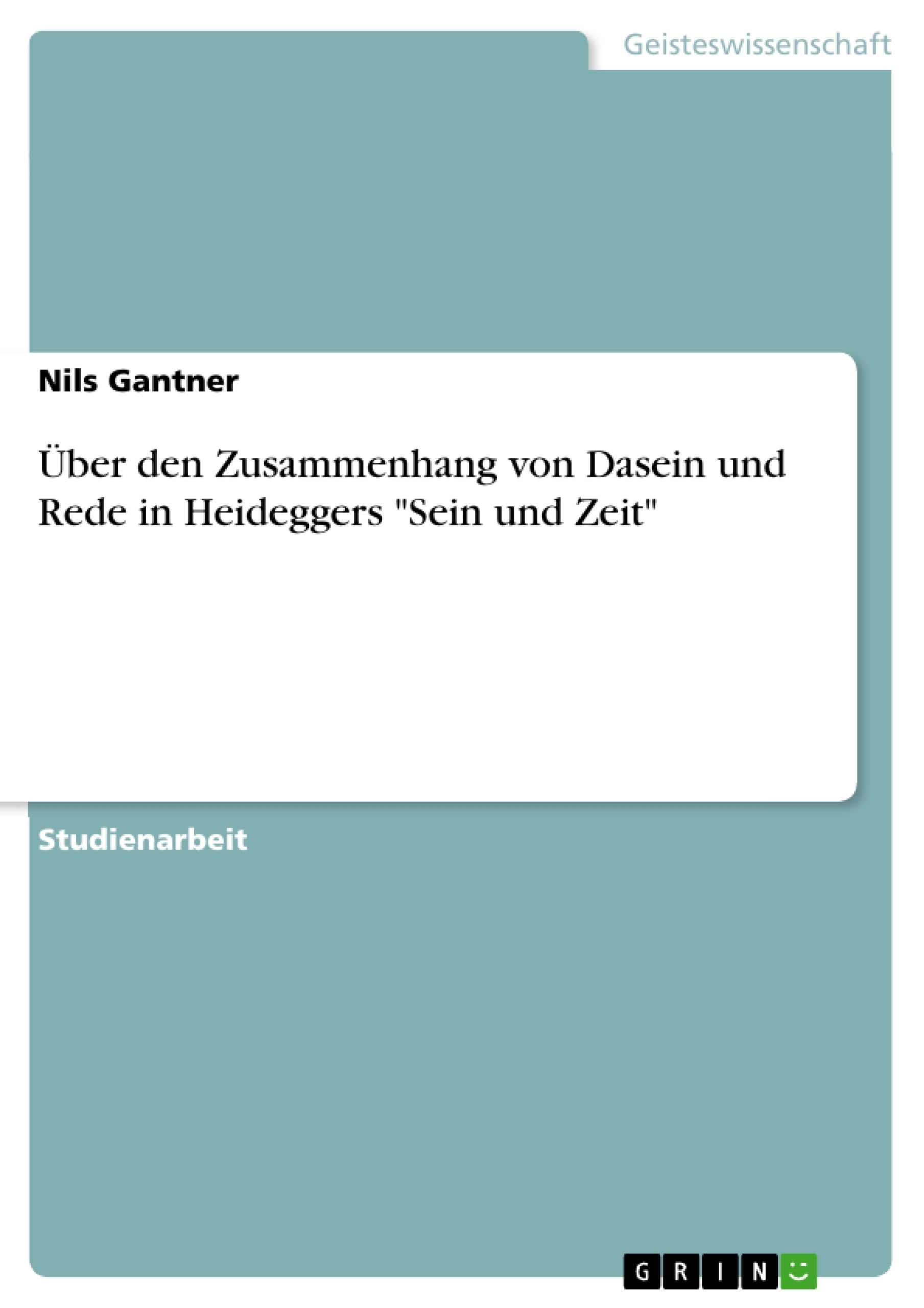In der vorliegenden Arbeit soll die Rolle der Sprache bzw. der Rede für Heideggers Daseinskonzeption näher untersucht werden, wie er sie in seinem frühen Hauptwerk "Sein und Zeit" (1927) besonders im § 34 entwickelt. Ziel dabei ist es den sprachlichen Charakter des Daseins aufzuzeigen, der sich besonders im Mitsein mit den Anderen zeigt. Dabei soll auch auf die berühmte aristotelische Formel, dass der Mensch ein zoon logon echon ist, ein Lebewesen also das über Sprache verfügt, genauer eingegangen werden, da sie für Heidegger Deutung des menschlichen Daseins von Relevanz ist.
Gerade wegen des sprachlichen Aspekts des Daseins, lässt sich die Frage nun stellen, ob nicht auch ein Bezug zur Rhetorik implizit bei Heidegger vorhanden ist. Was hier unter Rhetorik verstanden wird, soll vor allem durch das Eingehen auf moderne Rhetorikforscher wie Joachim Knape geklärt werden. Neben diesem Punkt bedarf ebenso der Zusammenhang zwischen dem Verstehen und der Rede einer gesonderten Behandlung. Der Logosbegriff, der hier für die Rede steht, ist einer der zentralen Kernbegriffe dieser Arbeit und erfährt daher eine besondere Beachtung. Die Auseinandersetzung mit dem Haupttext soll auch durch das Eingehen auf Vorlesungen, die Heidegger in den 1920-er Jahren gehalten hat, vertieft werden.
Wichtig ist zu beachten, dass alles was über die Beziehung des Logos zum Dasein gesagt wird, nur den frühen Heidegger betrifft, den der späte wird zu einer anderen Position hinsichtlich des Logosbegriffs kommen. Abgesehen von Joachim Knape, der Professor für Rhetorik in Tübingen ist, soll zudem durch das Eingehen auf den Philosophen Jacques Derrida ein weiterer relevanter Bezug zur Forschung hergestellt werden. Knape selber liest in seinem Buch "Was ist Rhetorik?" (2000) Heidegger rhetoriktheoretisch, Derrida problematisiert in seinem frühen Werk Grammatologie dessen Logozentrismus. Beide Forscher verbindet trotz theoretischer Unterschiede die Behandlung des Logozentrismus bei Heidegger.
Inhaltsverzeichnis
- A: Einleitung
- B: Über den Zusammenhang von Dasein und Rede in Heideggers Sein und Zeit.
- 1.1 Erste Grundzüge der heideggerschen Logostheorie...
- 1.2 Über den hermeneutischen Charakter der Rede und des Daseins.
- 1.3 Dasein als Miteinanderreden oder über Hören und Schweigen im sprachlichen Kontext -
- 1.4 Von der Rede zum Gerede
- 1.5 Die Zeitlichkeit der Rede und des Daseins
- 1.6 Heidegger aus der Sicht Joachim Knapes und Jacques Derridas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Sprache bzw. der Rede in Heideggers Daseinskonzeption, die er in seinem Werk „Sein und Zeit“ (1927) entwickelt. Sie zielt darauf ab, den sprachlichen Charakter des Daseins aufzuzeigen, der sich besonders im Mitsein mit den Anderen zeigt, und geht dabei auch auf die Frage ein, ob bei Heidegger ein impliziter Bezug zur Rhetorik vorhanden ist.
- Der sprachliche Charakter des Daseins
- Der Bezug zur Rhetorik bei Heidegger
- Der hermeneutische Charakter der Rede und des Daseins
- Die Zeitlichkeit der Rede und des Daseins
- Die phänomenologische Wahrheit des Logos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Sprache in Heideggers Daseinskonzeption. Sie skizziert die Ziele der Arbeit und wichtige Bezugspunkte, wie z.B. die Bedeutung des Logos, die Beziehung von Verstehen und Rede sowie den Zusammenhang zwischen Heidegger, Knape und Derrida.
Kapitel 1.1 beleuchtet die ersten Grundzüge der heideggerschen Logostheorie. Es wird die Vieldeutigkeit des Logosbegriffs bei Platon und Aristoteles sowie Heideggers spezifisches Verständnis des Logos als Rede betrachtet. Dabei wird die Bedeutung des Logos als „sehendes Offenbarmachen“ und seine Eigenschaft, wahr oder falsch zu sein, diskutiert.
Kapitel 1.2 vertieft die Analyse des Logos durch die Betrachtung seines hermeneutischen Charakters. Hier wird die enge Verbindung zwischen dem Verstehen und der Rede beleuchtet und die Rolle des Verstehens für die Möglichkeit des Sehenlassens durch den Logos hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Begriffe Logos, Dasein, Sprache, Rede, Hermeneutik, Phänomenologie, Rhetorik, Heidegger, Knape, Derrida, Sein und Zeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Beziehung zwischen Dasein und Rede und der Rolle der Sprache im Kontext von Heideggers Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Rede" im Kontext von Heideggers "Sein und Zeit"?
Die Rede (Logos) ist bei Heidegger eine existenziale Grundverfassung des Daseins, die das Verstehen und die Erschlossenheit der Welt erst ermöglicht.
Wie unterscheidet Heidegger zwischen "Rede" und "Gerede"?
Während die Rede das "sehende Offenbarmachen" von Sein ermöglicht, bezeichnet das Gerede eine oberflächliche, uneigentliche Form der Kommunikation, die das wahre Verständnis eher verdeckt.
Welche Rolle spielt die aristotelische Formel "zoon logon echon"?
Heidegger greift diese Definition des Menschen als Sprachwesen auf, um den sprachlichen Charakter des menschlichen In-der-Welt-seins und Mitseins zu begründen.
Inwiefern ist Heideggers Daseinskonzeption rhetoriktheoretisch relevant?
Forscher wie Joachim Knape lesen Heidegger rhetoriktheoretisch, da die Rede bei ihm als Medium fungiert, durch das sich das Dasein in der Welt und gegenüber anderen artikuliert.
Was kritisiert Jacques Derrida an Heideggers Logos-Begriff?
Derrida problematisiert in seiner Grammatologie den "Logozentrismus" bei Heidegger, also die Bevorzugung der gesprochenen Rede gegenüber der Schrift.
- Quote paper
- Nils Gantner (Author), 2008, Über den Zusammenhang von Dasein und Rede in Heideggers "Sein und Zeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316637