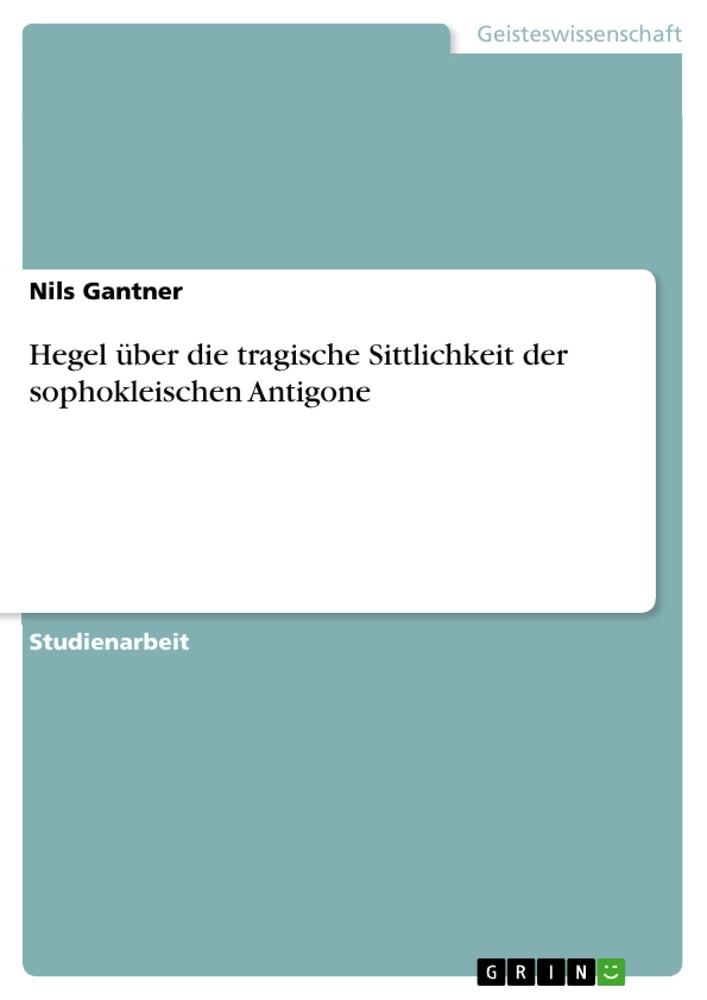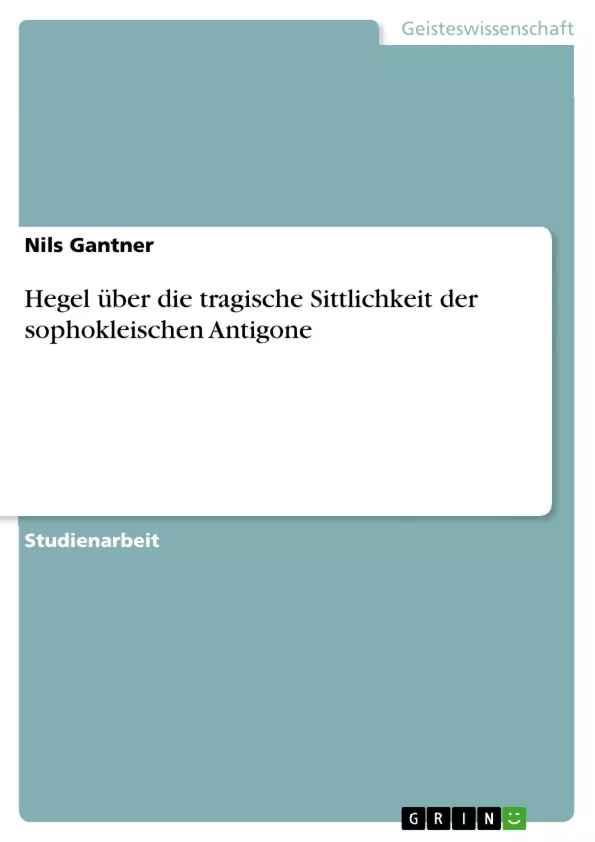Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, wie G.W. F. Hegel die sophokleische Antigone in der "Phänomenologie des Geistes" (1806) und später in seinen "Ästhetik-Vorlesungen" (1830) deutet. Neben den beiden genannten Werken wird zudem auch auf andere Texte von ihm Bezug genommen werden wie z.B. der "Rechtsphilosophie", der "Religionsphilosphie" oder der "Geschichtsphilosophie".
Genau untersucht werden soll dabei das Verhältnis zwischen Staat und Familie, welches Hegel als dialektischen Gegensatz hier konstruiert. Was den Aspekt der Familie betrifft, gilt es zudem die Beziehung zwischen Bruder und Schwester im Sinne der Geschlechterthematik mit zu reflektieren. Die Kategorien des Männlichen und Weiblichen sind in seinem Diskurs über die Sittlichkeit der Antigone von Bedeutung, was im Laufe der Arbeit genauer herausgearbeitet werden soll. Auch die Sprache der Tragödie wird eigens in einem Kapitel angegangen und ihre Bedeutung aufgezeigt. Ein wesentliches Anliegen der Arbeit ist zu erforschen, was Hegel selbst unter dem Tragischen versteht und wie er sein Verständnis desselben in seiner Deutung der sophokleischen Antigone einfließen lässt.
Was die Forschung noch anbetrifft, soll insbesondere Derridas Interpretation von Hegel in seinem Buch "Glas" (2006) berücksichtigt werden und damit besonders die französische Hegelforschung Beachtung finden, die durch ihn hier repräsentiert ist. Selbstverständlich wird auf einige andere Vertreter der philosophischen Forschung eingegangen werden wie z.B. Christoph Menke. Aber auch die Stellungnahmen von Philologen wie Szondi sollen beachtet werden, da sie zu Hegels Deutung der sophokleischen Antigone Stellung genommen haben. Insofern wird, was die Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur betrifft, die philosophische als auch philologische Forschung zu ihrem Recht kommen.
Inhaltsverzeichnis
- A: Einleitung:
- B: Hegel über tragische Sittlichkeit der sophokleischen Antigone........
- 1. Staat, Gesetz, Familie und griechische Sittlichkeit.
- 2. Die,,höhere❝ Sprache der Tragödie
- 3. Das Tragische in der Antigone.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, wie G.W. F. Hegel die sophokleische Antigone in der Phänomenologie des Geistes (1806) und später in seinen Ästhetik-Vorlesungen (1830) deutet. Neben den beiden genannten Werken wird zudem auch auf andere Texte von ihm Bezug genommen werden wie z.B. der Rechtsphilosophie, der Religionsphilosphie oder der Geschichtsphilosophie. Genau untersucht werden soll dabei das Verhältnis zwischen Staat und Familie, welches Hegel als dialektischen Gegensatz hier konstruiert. Was den Aspekt der Familie betrifft, gilt es zudem die Beziehung zwischen Bruder und Schwester im Sinne der Geschlechterthematik mit zu reflektieren. Die Kategorien des Männlichen und Weiblichen sind in seinem Diskurs über die Sittlichkeit der Antigone von Bedeutung, was im Laufe der Arbeit genauer herausgearbeitet werden soll. Auch die Sprache der Tragödie wird eigens in einem Kapitel angegangen und ihre Bedeutung aufgezeigt. Ein wesentliches Anliegen der Arbeit ist zu erforschen, was Hegel selbst unter dem Tragischen versteht und wie er sein Verständnis desselben in seiner Deutung der sophokleischen Antigone einfließen lässt. Was die Forschung noch anbetrifft, soll insbesondere Derridas Interpretation von Hegel in seinem Buch Glas (2006) berücksichtigt werden und damit besonders die französische Hegelforschung Beachtung finden, die durch ihn hier repräsentiert ist. Selbstverständlich wird auf einige andere Vertreter der philosophischen Forschung eingegangen werden wie z.B. Christoph Menke. Aber auch die Stellungnahmen von Philologen wie Szondi sollen beachtet werden, da sie zu Hegels Deutung der sophokleischen Antigone Stellung genommen haben. Insofern wird, was die Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur betrifft, die philosophische als auch philologische Forschung zu ihrem Recht kommen.
- Das Verhältnis von Staat und Familie in Hegels Deutung der Antigone
- Die Rolle der Geschlechterdifferenz in Hegels Analyse der tragischen Sittlichkeit
- Die Sprache der Tragödie und ihre Bedeutung für Hegels Interpretation
- Hegels Verständnis des Tragischen
- Der Einfluss von Derridas Interpretation von Hegel auf die französische Hegelforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- A: Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor und erläutert die methodischen und theoretischen Grundlagen. Sie beschreibt die wichtigsten Quellen und Sekundärliteratur, die für die Untersuchung relevant sind.
- B: Hegel über tragische Sittlichkeit der sophokleischen Antigone:
- 1. Staat, Gesetz, Familie und griechische Sittlichkeit: In diesem Kapitel wird Hegels Deutung der Antigone im Kontext seiner Philosophie des Geistes vorgestellt. Hegel argumentiert, dass die tragische Sittlichkeit der Antigone aus dem Konflikt zwischen dem göttlichen Gesetz der Familie und dem menschlichen Gesetz des Staates resultiert.
- 2. Die,,höhere❝ Sprache der Tragödie: Dieses Kapitel analysiert die Sprache der Tragödie und ihre Bedeutung für Hegels Interpretation. Hegel argumentiert, dass die Sprache der Tragödie eine „höhere“ Sprache ist, die die Grenzen der rationalen Sprache transzendiert.
- 3. Das Tragische in der Antigone: In diesem Kapitel wird Hegels Verständnis des Tragischen im Kontext seiner Interpretation der Antigone untersucht. Hegel argumentiert, dass das Tragische aus dem Konflikt zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen resultiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Hegel, Antigone, Tragödie, Sittlichkeit, Staat, Familie, Geschlecht, Sprache, Derrida, französische Hegelforschung.
Häufig gestellte Fragen
Wie deutet Hegel den Konflikt in Sophokles' Antigone?
Hegel sieht darin einen dialektischen Gegensatz zwischen zwei gleichermaßen berechtigten Mächten: dem göttlichen Gesetz der Familie (Antigone) und dem menschlichen Gesetz des Staates (Kreon).
Welche Rolle spielt die Geschlechterthematik bei Hegel?
Hegel ordnet das Weibliche der Familie und dem Unterirdischen zu, während das Männliche den Staat und das öffentliche Gesetz repräsentiert.
Was versteht Hegel unter dem „Tragischen“?
Das Tragische entsteht für Hegel nicht durch das Leiden an sich, sondern durch den unlösbaren Konflikt zweier sittlicher Prinzipien, die beide für sich Anspruch auf Wahrheit erheben.
Warum ist die Beziehung zwischen Bruder und Schwester für Hegel zentral?
Er betrachtet die Geschwisterliebe als die reinste Form der familiären Sittlichkeit, da sie frei von Begehren ist und die höchste Stufe der Anerkennung innerhalb der Familie darstellt.
Welchen Einfluss hatte Jacques Derrida auf die Hegelforschung?
Derrida kritisierte in seinem Werk „Glas“ Hegels Systematik und eröffnete neue, dekonstruktivistische Perspektiven auf die Rolle der Familie und der Frau in der Philosophie.
- Quote paper
- Nils Gantner (Author), 2011, Hegel über die tragische Sittlichkeit der sophokleischen Antigone, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316640