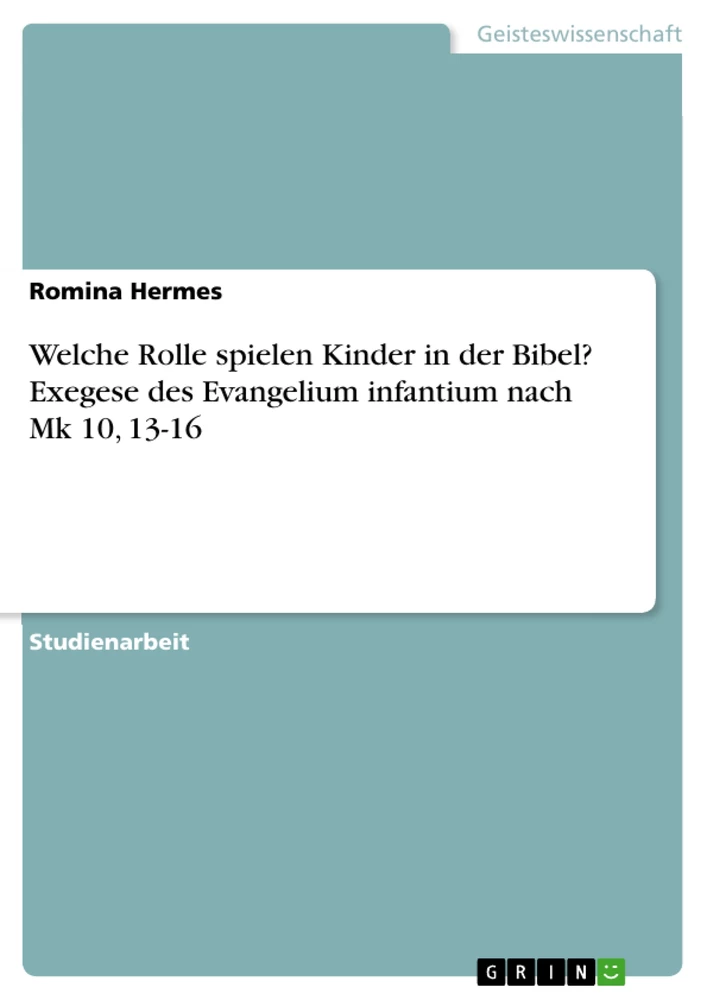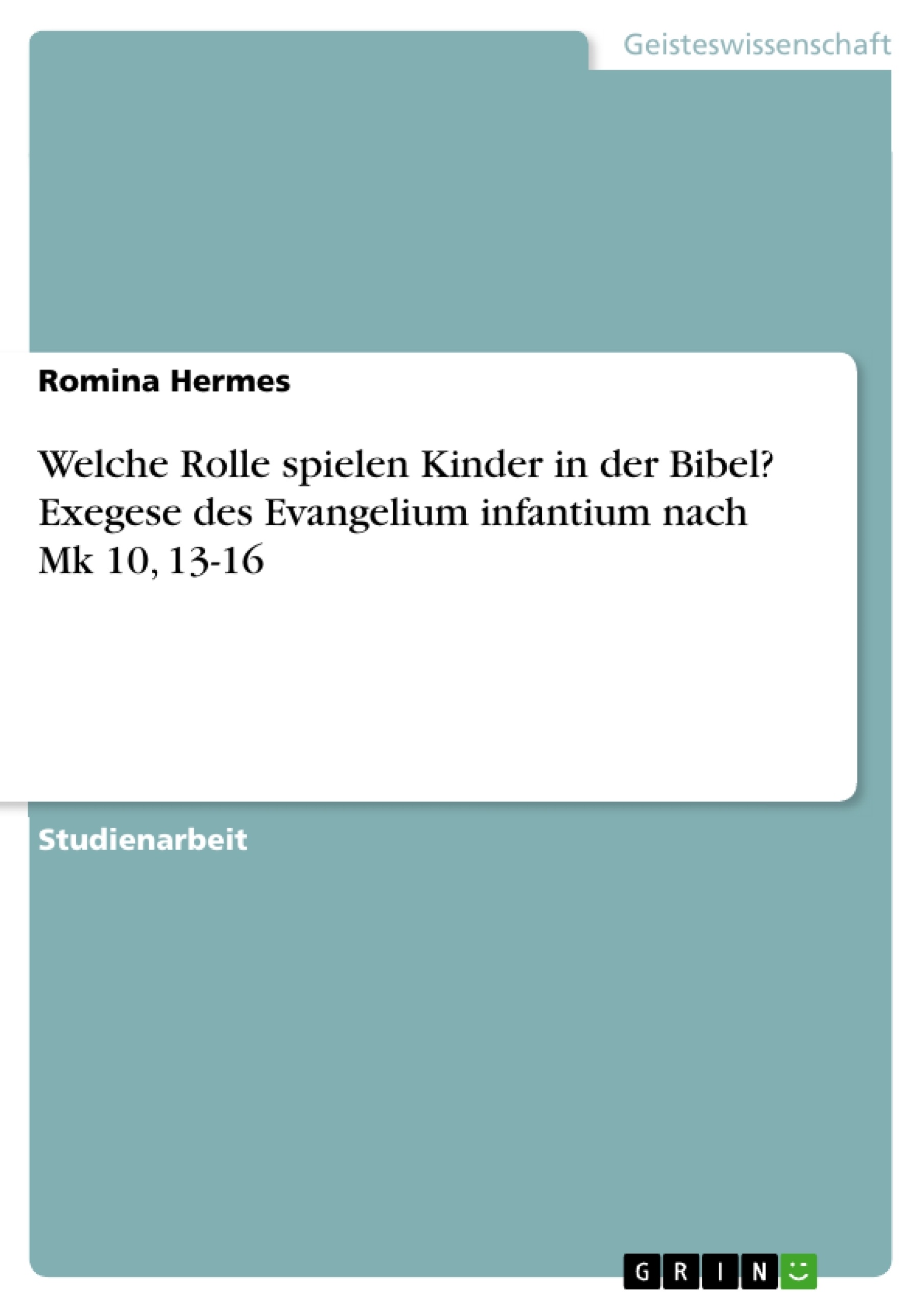Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden sich reichlich wenig Bibelstellen, in denen Kinder eine tragende oder wichtige Rolle spielen. Wie kann man also herausfinden, welche Stellung Kinder damals wirklich in der Gesellschaft in Bezug auf Gemeinden inne hatten? Wo in dem Neuen
Testament finden sich Hinweise darauf, wie Jesus den Jüngsten zugetan war? Schnell stößt man diesbezüglich auf eine häufig bei Taufen und Kinderkommunionen zitierte Stelle im Markusevangelium, Mk 10, 13-16.
In Mk 10, 13-16 geht es um die Rolle des Kindes aus Sicht Jesu.
Wo zuvor im alten Testament und auch in der soziokulturellen-raumzeitlichen Situierung zu Zeiten Jesu das Kind als wertlos angesehen war, nahm sich Jesus der Kinder an und erkannte ihren Wert.
Jedoch scheint es bei tieferem Betrachten nicht nur um den Wert eines Kindes zu gehen, sondern auch um dessen Vorbildfunktion, die in dieser Arbeit heraus gestellt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse des Evangelium Infantium: Mk 10, 13-16
- Das Bild des Kindes in der Bibel
- Das Kind im Alten Testament/im Judentum
- Das Kind im Neuen Testament/im frühen Christentum
- Das Kind in Mk 10, 13-16
- Die Eschatologie des Reich Gottes im Markusevangelium
- Das Bild des Kindes in der Bibel
- Mk 10, 13-16 im Kontext des gesamten Kapitels
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Bild des Kindes im Markusevangelium, insbesondere im Abschnitt Mk 10, 13-16, dem sogenannten „Evangelium Infantium“. Ziel ist es, die Bedeutung des Kindes in der Bibel und im frühen Christentum zu beleuchten und die Rolle Jesu in diesem Kontext zu analysieren.
- Die Relevanz des Kindes in der Bibel
- Die Interpretation von Mk 10, 13-16
- Die Eschatologie des Reich Gottes im Markusevangelium
- Die Stellung des Kindes in der Gesellschaft des frühen Christentums
- Die Bedeutung von Jesu Botschaft für Kinder und Erwachsene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Motivation für die Arbeit. Sie stellt die Relevanz des Kindes in der Bibel und im frühen Christentum sowie die besondere Bedeutung der Textstelle Mk 10, 13-16 heraus.
Das zweite Kapitel analysiert die Textstelle Mk 10, 13-16 im Detail. Es untersucht die Semantik, die Wortfelder, das Amen-Wort, den Tun-Ergehen-Zusammenhang und den Sitz im Leben. Darüber hinaus wird die Eschatologie des Reich Gottes im Markusevangelium beleuchtet, da diese im Kontext der ausgewählten Verse eine wichtige Rolle spielt.
Das dritte Kapitel betrachtet Mk 10, 13-16 im Kontext des gesamten Kapitels und setzt die Textstelle in Beziehung zu den vorangehenden und nachfolgenden Abschnitten.
Schlüsselwörter
Das Kind, Markusevangelium, Evangelium Infantium, Mk 10, 13-16, Reich Gottes, Eschatologie, Frühes Christentum, Judentum, Semantik, Wortfelder, Amen-Wort, Tun-Ergehen-Zusammenhang, Sitz im Leben, Gesellschaft, Tradition, Jesus, Jünger.
- Citar trabajo
- Romina Hermes (Autor), 2015, Welche Rolle spielen Kinder in der Bibel? Exegese des Evangelium infantium nach Mk 10, 13-16, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316682