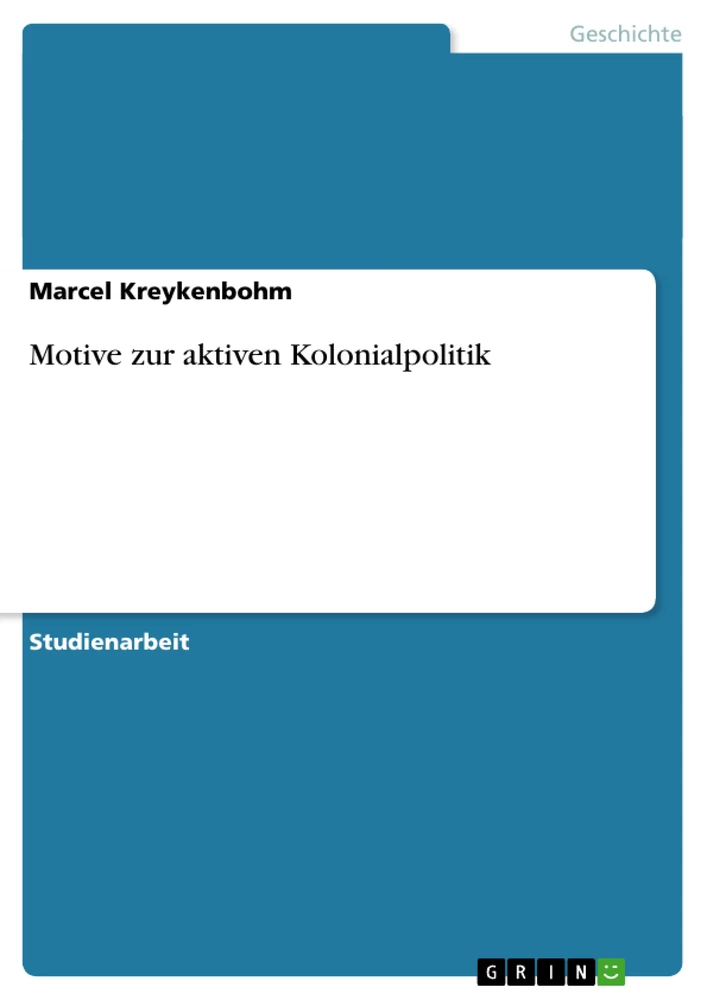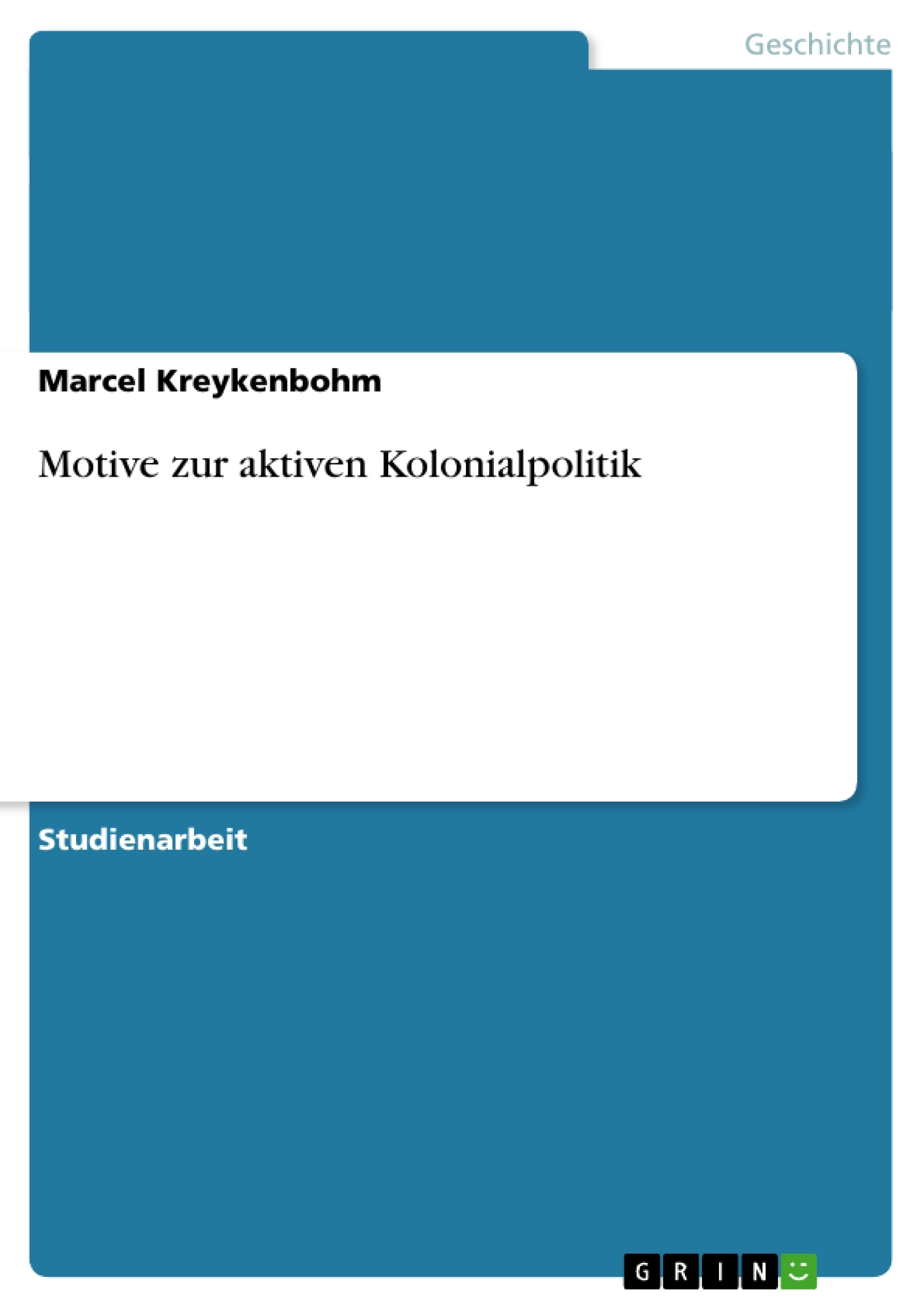Die Ausarbeitung soll nicht die Frage nach dem Verlauf oder den Folgen dieser Politik behandeln. Im Vordergrund stehen die Voraussetzungen und Motive die diese Politik ermöglichten bzw, erforderten. Welche außen-, bzw. innenpolitischen Faktoren veranlassten Bismarck zu einem Paradigmenwechsel in der Kolonialfrage? Muss Bismarck in Folge dieses Politikwechsels die Rolle eines autonom handelnden, „diktatorischen“3 Entscheidungsträgers zugeschrieben werden, wodurch das frühe parlamentarische System des Reiches zur Kanzlerdiktatur reduziert wäre? Oder hat sich der Reichskanzler entgegen seiner häufig bekundeten Überzeugung gar bereitwillig den Zwängen einer politischen Öffentlichkeit gebeugt? Die Historische Forschung hat hier einige Motivansätze hervorgebracht, die das Bismarckbild und die Bismarck-Ära nachhaltig beeinflußt haben. Vor allem werden hier Wehlers „pragmatischer Imperialismus“4 und der durch Riehls „Kronprinzen-These“5 untermauerte Motivansatz einer anglophoben Prinzipienpolitik angeführt. Diese und andere scheinbar unversöhnlichen Ansätze arbeiten mit unterschiedlichen Gewichtungen einzelner Aspekte und verleiten teils zu „dubiosen monokausalen“6 Geschichtsbetrachtungen, die der Komplexität der Sache nicht gerecht werden. Riehl spricht für den Zeitraum von Ende 1883 bis Mitte 1885 von der „chronologische[n] Parallelität der Handlungsstränge“7, womit bereits angedeutet ist, dass die Motivsuche zu Bismarcks Kolonialpolitik die Begegnung mit einigen Bündeln an Zusammenhängen nicht ausspart. Zudem können diese Zusammenhänge nicht ausschließlich auf die Person des Reichskanzlers bezogen sein. Damit sollen zu Beginn hagiographischen Tendenzen, die Bismarck zum Übermenschen einer ganzen Ära und Nation stilisieren, in den Bereich des Mythenhaften verwiesen werden. Diese Arbeit will vielmehr die verschiedenen ernstzunehmenden Zusammenhänge im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachzeichnen und, sofern möglich, zusammenführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Paradigmenwechsel: Vom „Informal Empire“ zur Reichsschutzpolitik
- Die Politik der „Offenen Tür“
- Expansionistischer Interventionsstaat – Exportfördermaßnahmen und Samoavorlage
- Die Samoavorlage von 1880
- Das Gesuch von Adolf Lüderitz um Schutzgewährung
- Kolonialpolitische Erwartungen – Innenpolitische Zwänge
- Wirtschaftliche Depression seit 1873
- Expansionsagitation und die Kolonialvereine
- Expansionsagitation und die Rolle der Presse
- „Der Primat der Außenpolitik“
- Bismarcks Außenpolitik in den Kolonialjahren 1884/85
- Freihandelszone und Kongo-Konferenz.
- Die deutsch-französische Haltung in der Ägyptenfrage
- Dreikaiserbündnis und russische Prinzipienpolitik
- Rußland, Battenbergheirat und Finanzanleihen
- Die „neuen“ Beziehungen zur englischen Kolonialmacht
- Kronprinzenthese
- Befürchtungen um ein deutsches „Kabinett Gladstone“
- Linksliberalismus und Herbstwahlen 1884
- Schluß
- Zusammenfassung.
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis..
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Motiven und Voraussetzungen für Bismarcks plötzliche Wende hin zu einer aktiven Kolonialpolitik in den Jahren 1884/85. Sie untersucht, welche außen- und innenpolitischen Faktoren Bismarck zu diesem Paradigmenwechsel bewogen haben. Die Arbeit analysiert, ob Bismarck dabei als autonomer, „diktatorischer“ Entscheidungsträger agierte oder sich den Zwängen der politischen Öffentlichkeit beugte.
- Der Paradigmenwechsel von der Politik der „Offenen Tür“ hin zur aktiven Kolonialpolitik
- Die Rolle innen- und außenpolitischer Faktoren in der Entscheidungsfindung Bismarcks
- Die Analyse von Bismarcks Rolle als autonomer Entscheidungsträger oder als Verhandlungspartner der politischen Öffentlichkeit
- Die Untersuchung von unterschiedlichen Motivansätzen für Bismarcks Kolonialpolitik
- Die Rekonstruktion der Komplexität und der verschiedenen Zusammenhänge, die zu Bismarcks Entscheidung führten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Frage nach Bismarcks Motiven für die koloniale Politik stellt und verschiedene Motivansätze in der Forschung beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird der Paradigmenwechsel von der „Offenen Tür“ zur Reichsschutzpolitik beschrieben, wobei der Fokus auf der Politik der „Offenen Tür“, dem Aufstieg des Interventionsstaates und der Samoavorlage von 1880 liegt.
Im dritten Kapitel werden die innenpolitischen Zwänge behandelt, die Bismarck zur Kolonialpolitik drängten. Hier werden die wirtschaftliche Depression seit 1873, die Expansionsagitation der Kolonialvereine und die Rolle der Presse analysiert.
Das vierte Kapitel beleuchtet Bismarcks Außenpolitik in den Kolonialjahren 1884/85. Hier werden Themen wie die Freihandelszone und die Kongo-Konferenz, die deutsch-französische Haltung in der Ägyptenfrage, das Dreikaiserbündnis und die Beziehungen zu England behandelt.
Das fünfte Kapitel widmet sich der „Kronprinzenthese“, die Bismarcks Politik mit den Befürchtungen um ein deutsches „Kabinett Gladstone“ in Verbindung bringt und die Rolle des Linksliberalismus bei den Herbstwahlen 1884 untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Bismarcks Kolonialpolitik, den Paradigmenwechsel vom „Informal Empire“ zur Reichsschutzpolitik, die Politik der „Offenen Tür“, den Interventionsstaat, die Samoavorlage, die Rolle der innenpolitischen Zwänge und die Analyse verschiedener Motivansätze für Bismarcks Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Warum änderte Bismarck 1884 seine Haltung zur Kolonialpolitik?
Bismarck vollzog einen Paradigmenwechsel aufgrund eines komplexen Gefüges aus innenpolitischem Druck, wirtschaftlicher Depression und außenpolitischen Kalkülen gegenüber England und Frankreich.
Was war die „Samoavorlage“ von 1880?
Dies war ein früher Versuch staatlicher Unterstützung für private Handelsgesellschaften in Übersee, der jedoch am Widerstand des Reichstags scheiterte.
Welche Rolle spielte die wirtschaftliche Depression seit 1873?
Die wirtschaftliche Krise erhöhte den Druck auf die Regierung, neue Absatzmärkte und Rohstoffquellen durch Kolonien zu erschließen, was durch Kolonialvereine massiv propagiert wurde.
Was besagt die „Kronprinzen-These“?
Sie vermutet, dass Bismarck die Kolonialpolitik auch nutzte, um einen Keil zwischen den englischfreundlichen Kronprinzen Friedrich Wilhelm und England zu treiben, um dessen künftigen politischen Spielraum einzuschränken.
Wie beeinflusste die Außenpolitik Bismarcks koloniale Bestrebungen?
Bismarck nutzte Kolonialfragen oft als Manövriermasse, um Spannungen zwischen anderen Großmächten (z.B. England und Frankreich in der Ägyptenfrage) für deutsche Interessen auszunutzen.
- Quote paper
- Marcel Kreykenbohm (Author), 2004, Motive zur aktiven Kolonialpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31670