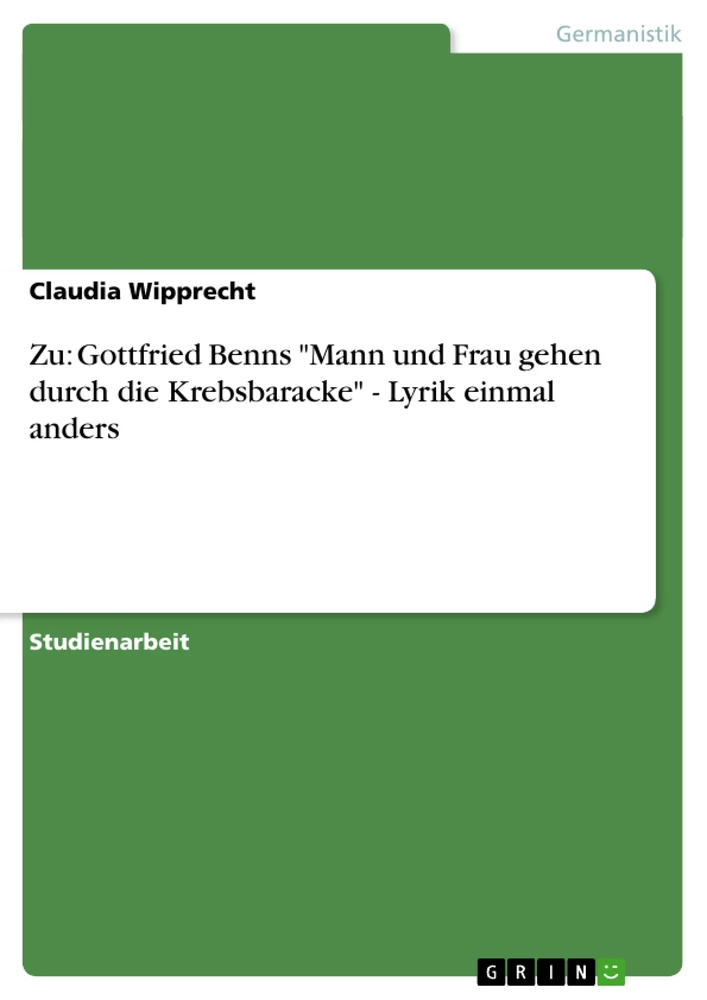Benns, mit besonderem Augenmerk auf den Gedichtzyklus „Morgue“ Die Epoche des Expressionismus wird von der Literaturgeschichtsschreibung zwischen 1910 und 1925 datiert. Der Begriff des Expressionismus wurde 1911 von Kurt Hiller geprägt und war lange Zeit eher umstritten. Das primäre Ziel dieser Stilbewegung war das Schockieren und die Provokation, was wiederum durch die Ablehnung der veralteten Muster und Normen unterstrichen wurde. Lyrik wurde zum Ausdruck einer Bewusstseinskrise, stilistisch umgesetzt durch kühne Metaphorik und einer Sprache, die völlig frei von Normen und Konventionen war; es wurden Satzfetzen und unverbundene Reihen verwendet, ebenso wie die sogenannte „Montagetechnik“ zum Aneinanderkoppeln von Wörtern aus verschiedenen Sinnesbereichen. Das Ziel dieses Konglomerats der Künste war die Ablehnung der Kunst als hübsches Beiwerk. Kunst sollte provozieren, kritisieren und schockieren.
Thematisch rückten Motive wie der Ich – Verfall, Kriegs – und Todesmotive, sowie das Großstadtmotiv in den Vordergrund. Anhand dieser Motive wurde Kritik geübt an der Doppelmoral und Spießigkeit der kleinbürgerlichen Idylle, mit dem Ziel des Ausbruchs aus diesen bürgerlichen Konventionen. Vor allem die Sicht des Menschenbildes ist völlig entgegengesetzt zu allem bisher Da – gewesenen: Menschen werden auf ihre bloße Existenz beschränkt und auf ihre elementare Triebhaftigkeit reduziert; menschliche Werte sind praktisch nicht mehr existent. Dies spiegelt sich auch im Großstadtmotiv wider. Die Großstadt wird als Qual beschrieben und auch empfunden; sie scheint der Fluchtort jeglichem Negativen zu sein: Krebsbaracken, Leichenhallen, Bordelle, Gefängnisse und weiterer schrecklicher Orte. Das Individuum empfindet eine Ohnmacht gegenüber den Zuständen in der Großstadt, es kann nichts tun. Die Bewohner sind isoliert, vereinsamt, betäubt, verblendet, orientierungslos, kurz gesagt: völlig hilflos gegenüber dem Phänomen Großstadt. Die Stadt ist der Dämon, die übermenschliche Kraft.
Diese Motive werden auch von Gottfried Benn in seinem Frühwerk, dem „Morgue“ – Zyklus, eingesetzt. Benn schuf diesen Gedichtband mit insgesamt neun Gedichten im Jahre 1912 in der sogenannten „ersten Periode“ seines Schaffens. Zu dieser Zeit war er Sanitätsoffizier im deutschen Heer und im Berliner Krankenhaus Moabit tätig.
Inhaltsverzeichnis
- Die Epoche des Expressionismus unter Einbeziehung der literarischen Figur Benns, mit besonderem Augenmerk auf den Gedichtzyklus „Morgue“
- Versuch des Eindringens in die Tiefenschichten des Gedichts „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“
- allgemeine formelle Mittel
- Analyse der einzelnen Strophen
- Abschließende Zusammenfassung der Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Gottfried Benns Gedicht „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“ im Kontext des Expressionismus. Die Arbeit untersucht die formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichts und versucht, dessen Tiefenschichten zu erschließen. Sie beleuchtet Benns Schreibstil und seine Auseinandersetzung mit Tod, Krankheit und dem menschlichen Dasein im Angesicht des Todes.
- Der Expressionismus und Benns literarische Figur
- Formale Analyse des Gedichts „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“
- Thematische Analyse: Tod, Krankheit und das menschliche Dasein
- Benns Verwendung von Sprache und Bildsprache
- Die gesellschaftliche Kritik im Gedicht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Epoche des Expressionismus unter Einbeziehung der literarischen Figur Benns, mit besonderem Augenmerk auf den Gedichtzyklus „Morgue“: Dieses Kapitel datiert die Epoche des Expressionismus zwischen 1910 und 1925 und beschreibt sie als eine Bewegung, die Schock und Provokation anstrebte, indem sie etablierte Normen ablehnte. Die Lyrik wurde zum Ausdruck einer Bewusstseinskrise, stilistisch geprägt durch kühne Metaphorik und eine von Konventionen freie Sprache. Motive wie Verfall, Krieg, Tod und die Großstadt standen im Vordergrund, um die Doppelmoral der kleinbürgerlichen Idylle zu kritisieren. Das Menschenbild wurde auf bloße Existenz und elementare Triebhaftigkeit reduziert. Der Großstadtmotiv wird als Ausdruck von Qual, Isolation und Hilflosigkeit dargestellt. Gottfried Benns „Morgue“-Zyklus, entstanden 1912 während seiner Tätigkeit als Sanitätsoffizier, wird als Beispiel für diese Tendenzen präsentiert, wobei die Auflösung klassischer lyrischer Formen und die syntaktische Freiheit hervorgehoben werden.
Versuch des Eindringens in die Tiefenschichten des Gedichts „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“: Dieser Abschnitt analysiert Benns Gedicht „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“. Formal besteht das Gedicht aus sieben Strophen mit reimlosen Versen unterschiedlicher Länge, ohne eindeutiges Metrum. Der Stil ist eher erzählend und prosaisch. Die Beschreibungen der Krebsbaracke sind geprägt von einer nüchternen, medizinischen Sprache, die Ekel und Entmenschlichung hervorruft. Die Entpersonalisierung von Mann und Frau unterstreicht die Thematik der Reduktion des Menschen auf bloße Materie. Die Verwendung des Präsens verdeutlicht den allgemeingültigen Zustand des Sterbens. Das Gedicht thematisiert die Randbereiche des Lebens, die die bürgerliche Gesellschaft zu ignorieren sucht – den Tod durch Krebs mit all seinen schrecklichen Aspekten.
Schlüsselwörter
Gottfried Benn, Expressionismus, „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“, „Morgue“-Zyklus, Tod, Krankheit, Großstadt, medizinische Sprache, Entmenschlichung, formale Analyse, inhaltliche Analyse, lyrische Form, gesellschaftliche Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Gottfried Benns "Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Gottfried Benns Gedicht "Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke" im Kontext des Expressionismus. Die Arbeit untersucht die formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichts und versucht, dessen Tiefenschichten zu erschließen. Sie beleuchtet Benns Schreibstil und seine Auseinandersetzung mit Tod, Krankheit und dem menschlichen Dasein im Angesicht des Todes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Expressionismus und Benns literarische Figur; Formale Analyse des Gedichts "Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke"; Thematische Analyse: Tod, Krankheit und das menschliche Dasein; Benns Verwendung von Sprache und Bildsprache; Die gesellschaftliche Kritik im Gedicht. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Gedichtzyklus "Morgue".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Zunächst wird die Epoche des Expressionismus und Gottfried Benns Rolle darin, insbesondere sein Gedichtzyklus "Morgue", eingeordnet. Im zweiten Teil erfolgt eine detaillierte Analyse von "Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke", sowohl formal als auch inhaltlich. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse des Gedichts verwendet sowohl formale (Analyse von Metrum, Reim, Strophenbau, Sprache) als auch inhaltliche Methoden (Interpretation der Thematik, Bildsprache, gesellschaftlicher Kontext). Die Arbeit stützt sich auf eine eingehende Auseinandersetzung mit dem literarischen Kontext des Expressionismus und Benns Werk.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine detaillierte Interpretation von "Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke", die die formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichts in Beziehung zum Expressionismus setzt. Sie beleuchtet die Thematik von Tod, Krankheit und Entmenschlichung und analysiert Benns sprachliche Mittel, um diese Themen zu verdeutlichen. Die gesellschaftliche Kritik im Gedicht wird ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gottfried Benn, Expressionismus, "Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke", "Morgue"-Zyklus, Tod, Krankheit, Großstadt, medizinische Sprache, Entmenschlichung, formale Analyse, inhaltliche Analyse, lyrische Form, gesellschaftliche Kritik.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für den Expressionismus, Gottfried Benn und die Analyse von Lyrik interessiert. Sie eignet sich besonders für Studenten der Germanistik oder Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Claudia Wipprecht (Author), 2004, Zu: Gottfried Benns "Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke" - Lyrik einmal anders, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31674