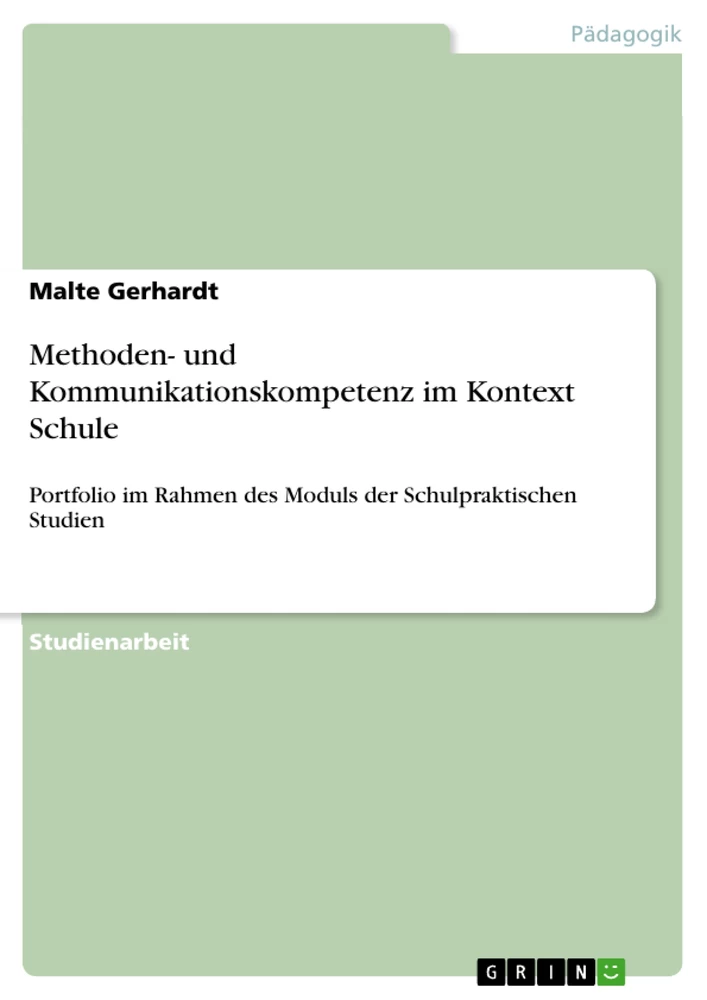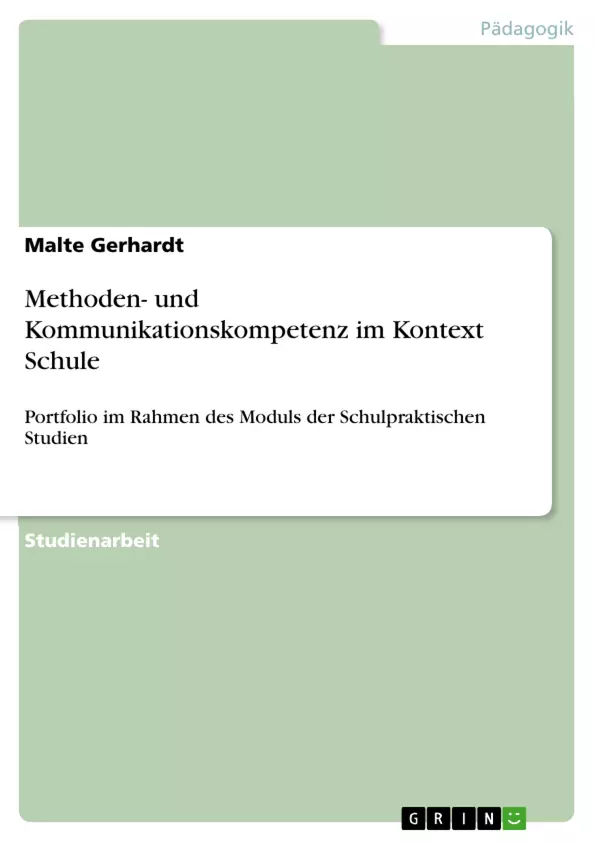Das eingereichte Portfolio dient der Dokumentation meines Professionalisierungsprozesses im Zuge meines Lehramtsstudiums. Die hier bearbeiteten Schreibaufträge sollen der Entwicklung meiner Reflexionskompetenz dienen und den eigenen Lernprozess fördern. Hauptbestandteile dieses Portfolios sind Reflexionen im Kontext des ersten Schulpraktikums sowie der begleitenden Seminarveranstaltung. Im ersten Teil meines Portfolios möchte ich ein theoretisches Idealbild einer Lehrperson skizzieren und meine Beweggründe für die Studienwahl darstellen.
Auch wenn es nicht explizit benannt wurde, fußt die Arbeit auf den Richtungsentscheidungen der Kultusministerkonferenz von 2004, welche auf die „Standards für die Lehrerbildung“ abheben. Durch Zusammenfassung der Tätigkeitsfelder der „Gemeinsamen Erklärung“ werden in den Standards vier Kompetenzbereiche herausstellt, die durch folgende Tätigkeiten charakterisiert sind: (a) Unterrichten, (b) Erziehen, (c) Diagnostizieren, Beraten, Beurteilen, (d) Evaluieren und Innovieren (vgl. KMK 2004).
Die Formulierung konkreter Lernziele soll mir helfen, meinen eigenen Lernprozess zu steuern und zu evaluieren. Die Beschreibung und Reflexion eines Seminareinstiegs dient der Entwicklung meiner Reflexionskompetenz bereits im VB-Seminar und ist gleichzeitig das Lernprodukt meiner bisherigen Studien. Der zweite Teil meines Portfolios enthält eine Beschreibung der Schule, an welcher ich mein erstens Schulpraktikum absolviert habe. Ebenso enthält dieser Teil eine Beschreibung und die Reflexion eines eigenen Unterrichtsversuchs. Ergänzt wird dieser Teil meines Portfolios durch ein Resümee meines Schulpraktikums. Ebenso sind ein Literaturverzeichnis und ein Anhang mit verwendeten Unterrichtsmaterialen und den Rasterplanungen der geplanten Unterrichtsstunden enthalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kontext Vorbereitungsveranstaltung
- 2.1. Meine Rolle als zukünftiger Lehrer
- 2.2. Studienwahl
- 2.3. Lernziele für das Modul Schulpraktische Studien
- 2.3.1. Methodenkompetenz als Sachkompetenz
- 2.3.2. Kommunikationskompetenz als Sozialkompetenz
- 2.4. Schulpraktikum
- 2.5. Reflexion des Seminareinstiegs anhand des Reflexionsstufenmodells
- 2.5.1. Einleitung
- 2.5.2 Vorbereitung des Seminareinstiegs
- 2.5.3 Geplanter Verlauf des Seminareinstiegs
- 2.5.4. Reflexionsstufenmodell
- 2.5.4.1. Stufe 1: Sachbezogene Beschreibung
- 2.5.4.2. Stufe 2: Handlungsbezogene Begründung
- 2.5.4.3. Stufe 3: Vergleichende Analyse von Unterrichtsplanung und Umsetzung
- 2.5.4.4. Stufe 4: Kritischer Diskurs im Kontext Unterricht
- 2.5.4.5. Stufe 5: Kritischer Diskurs im Kontext von Seminar und Praktikum
- 2.5.4.6. Stufe 6: Prozess der Professionalisierung
- 2.6. Resümee der Vorbereitungsveranstaltung
- 3. Der Kontext Schulpraktikum
- 3.1. Beschreibung der Schule
- 3.2. Reflexion eines Unterrichtsversuchs anhand des Reflexionsstufenmodells
- 3.2.1. Einleitung
- 3.2.2. Vorbereitung der Unterrichtsstunde
- 3.2.3. Geplanter Verlauf des Seminareinstiegs
- 3.2.4. Reflexionsstufenmodell
- 3.2.4.1. Stufe 1: Sachbezogene Beschreibung
- 3.2.4.2. Stufe 2: Handlungsbezogene Begründung
- 3.2.4.3. Stufe 3: Vergleichende Analyse von Unterrichtsplanung und Umsetzung
- 3.2.4.4. Stufe 4: Kritischer Diskurs im Kontext des Unterrichts
- 3.2.4.5. Stufe 5: Kritischer Diskurs im Kontext von Seminar und Praktikum
- 3.2.4.6. Stufe 6: Prozess der Professionalisierung
- 3.3. Resümee des Schulpraktikums
- Entwicklung der Reflexionskompetenz
- Theoretisches Idealbild einer Lehrperson
- Beweggründe für die Studienwahl
- Beschreibung und Reflexion des ersten Schulpraktikums
- Analyse des eigenen Unterrichtsversuchs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio dient der Dokumentation des Professionalisierungsprozesses des Autors im Lehramtsstudium. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Reflexionskompetenz im Kontext des ersten Schulpraktikums und der begleitenden Seminarveranstaltung. Das Portfolio skizziert ein theoretisches Idealbild einer Lehrperson und beleuchtet die Beweggründe für die Studienwahl.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Portfolios führt in das Thema ein und beschreibt die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die Vorbereitungsveranstaltungen zum Schulpraktikum beleuchtet. Hier wird die Rolle des zukünftigen Lehrers, die Studienwahl und die Lernziele des Autors im Kontext des Moduls Schulpraktische Studien analysiert. Im dritten Kapitel wird das Schulpraktikum näher betrachtet. Der Autor beschreibt die Schule, an der er sein Praktikum absolviert hat, und reflektiert einen eigenen Unterrichtsversuch anhand des Reflexionsstufenmodells. Das Portfolio endet mit einem Resümee des Schulpraktikums.
Schlüsselwörter
Reflexionskompetenz, Schulpraktikum, Lehrerrolle, Studienwahl, Unterrichtsplanung, Unterrichtsversuch, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieses Portfolios?
Das Portfolio dokumentiert den Professionalisierungsprozess während des Lehramtsstudiums und dient der Entwicklung der Reflexionskompetenz durch Schreibaufträge.
Welche vier Kompetenzbereiche für Lehrer werden genannt?
Basierend auf der KMK (2004) sind dies: Unterrichten, Erziehen, Diagnostizieren/Beraten/Beurteilen sowie Evaluieren und Innovieren.
Was umfasst die Methodenkompetenz im Lehramtskontext?
Methodenkompetenz wird hier als Sachkompetenz verstanden, die für die Planung und Durchführung von Unterricht entscheidend ist.
Wie wird die Kommunikationskompetenz eingeordnet?
Kommunikationskompetenz wird als Teil der Sozialkompetenz betrachtet, die für die Interaktion im Schulalltag essenziell ist.
Was ist das Reflexionsstufenmodell?
Es ist ein Modell zur Analyse von Unterricht, das von der sachbezogenen Beschreibung (Stufe 1) bis zum Prozess der Professionalisierung (Stufe 6) reicht.
- Citar trabajo
- Malte Gerhardt (Autor), 2009, Methoden- und Kommunikationskompetenz im Kontext Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316984