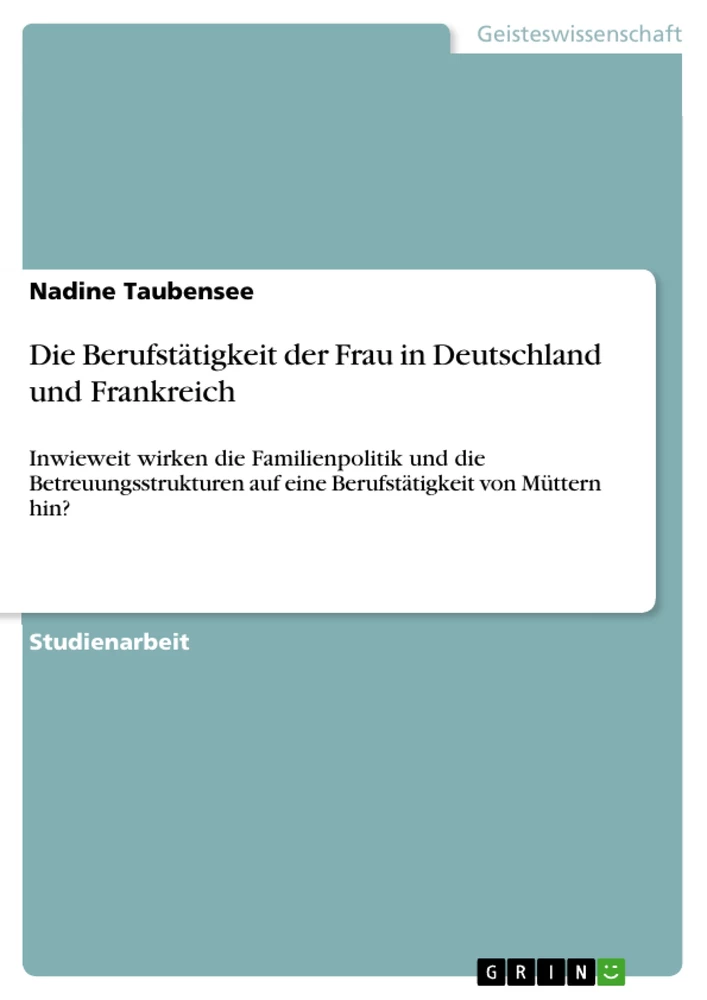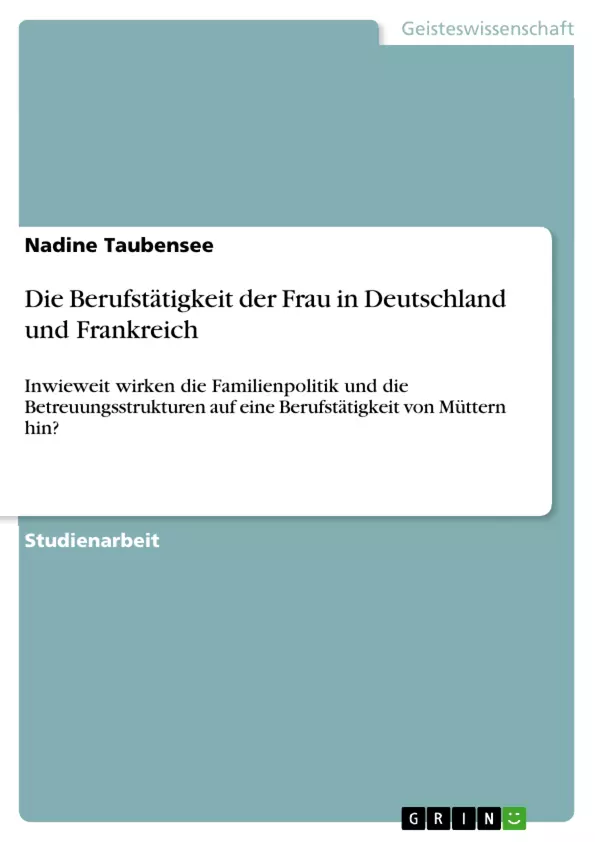In Frankreich herrscht das Modell der Ganztagsschule vor und die Frauen werden früh nach der Geburt wieder vollberufstätig. In Deutschland hingegen wird das Modell der Ganztagsschule häufig diskutiert sowie kritisiert, da die Frau in der Rolle als Mutter als elementar wichtig für die Entwicklung des Kindes beschrieben.
Welche Familienpolitik liegt in den zwei Ländern zugrunde? Welche Auswirkungen ergeben sich aus der Familienpolitik und dem Betreuungssystem für die Berufstätigkeit der Frauen? Zeugt die frühe Berufstätigkeit französischer Mütter von einer größeren Emanzipation der Frau?
Um diese Fragen genügend beantworten zu können, wird die Erwerbstätigkeit der Frau in beiden Ländern im geschichtlichen Kontext kurz beleuchtet. Darauffolgend werden die Familienpolitiken dargestellt und die Erziehungsstrukturen analysiert, um schließlich einen Bi-Nationalen Vergleich herzuleiten. Bei diesem sollen dann, auf der gegebenen Basis, die Rollen der Frauen in der Gesellschaft analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Entwicklungen in Deutschland und Frankreich
- 3. Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Familienpolitik
- 4. Familienpolitik
- 5. Fremdbetreuungsstrukturen
- 6. Bi-nationaler Vergleich der familienpolitischen Auswirkungen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Wechselwirkung zwischen Familienpolitik, Betreuungsstrukturen und der Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland und Frankreich. Es wird analysiert, wie die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Rolle der Frau im Berufsleben beeinflussen.
- Historische Entwicklung der Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland und Frankreich
- Vergleich der Familienpolitik in beiden Ländern
- Analyse von Betreuungsstrukturen für Kinder
- Auswirkungen der Familienpolitik und Betreuungsstrukturen auf die Erwerbstätigkeit von Müttern
- Bi-nationaler Vergleich der Rollen von Frauen in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Es wird untersucht, wie die Familienpolitik und die Betreuungsstrukturen in Deutschland und Frankreich die Erwerbstätigkeit von Müttern beeinflussen und ob die frühe Berufstätigkeit französischer Mütter auf eine größere Emanzipation hindeutet. Die Methodik, die einen historischen Überblick, die Darstellung der Familienpolitiken und die Analyse der Betreuungsstrukturen umfasst, wird skizziert. Der Fokus liegt auf einem binationalen Vergleich, um die Rollen der Frauen in beiden Gesellschaften zu analysieren.
2. Historische Entwicklungen in Deutschland und Frankreich: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungen der Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland und Frankreich. In Frankreich wird die lange Tradition der Ammen beschrieben, die die frühe Berufstätigkeit von Müttern ermöglichte. Die Rolle der Frauen während der französischen Revolution und die Entwicklung unterschiedlicher Familienstrukturen werden diskutiert. Im Gegensatz dazu wird die Entwicklung des bürgerlichen Familienmodells in Deutschland im Kontext der sozialstaatlichen Unterstützungsleistungen hervorgehoben, wobei die Mutter primär für die Kinderbetreuung verantwortlich war. Der Kapitel vergleicht die normative Betreuungsverantwortung der Frauen in beiden Ländern und deren Auswirkung auf den Arbeitsmarkt.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Erwerbstätigkeit der Frau, Deutschland, Frankreich, Betreuungsstrukturen, Ammentradition, bürgerliches Familienmodell, sozialstaatliche Unterstützungsleistungen, Emanzipation, binationaler Vergleich, Geschlechterrollen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Familienpolitik in Deutschland und Frankreich
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Wechselwirkung zwischen Familienpolitik, Betreuungsstrukturen und der Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland und Frankreich. Im Fokus steht ein binationaler Vergleich, der die historischen Entwicklungen, die jeweiligen Familienpolitiken, die Betreuungsstrukturen und deren Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit von Müttern beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen von Frauen in beiden Ländern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Historische Entwicklungen in Deutschland und Frankreich, Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Familienpolitik, Familienpolitik, Fremdbetreuungsstrukturen, Binationaler Vergleich der familienpolitischen Auswirkungen und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie unterschiedliche politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland und Frankreich die Rolle der Frau im Berufsleben beeinflussen. Es soll analysiert werden, inwieweit die Familienpolitik und die Betreuungsstrukturen die Erwerbstätigkeit von Müttern prägen und ob die frühe Berufstätigkeit französischer Mütter auf eine größere Emanzipation hindeutet.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methodik, die einen historischen Überblick, die Darstellung der Familienpolitiken beider Länder und die Analyse der jeweiligen Betreuungsstrukturen umfasst. Der Fokus liegt auf dem binationalen Vergleich, um die Rollen der Frauen in den beiden Gesellschaften zu analysieren.
Wie werden die historischen Entwicklungen dargestellt?
Das Kapitel zu den historischen Entwicklungen vergleicht die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland und Frankreich. Es beschreibt die lange Tradition der Ammen in Frankreich, die die frühe Berufstätigkeit von Müttern ermöglichte, und setzt dies in Kontrast zur Entwicklung des bürgerlichen Familienmodells in Deutschland, in dem die Mutter primär für die Kinderbetreuung verantwortlich war. Die normative Betreuungsverantwortung der Frauen in beiden Ländern und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden verglichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Familienpolitik, Erwerbstätigkeit der Frau, Deutschland, Frankreich, Betreuungsstrukturen, Ammentradition, bürgerliches Familienmodell, sozialstaatliche Unterstützungsleistungen, Emanzipation, binationaler Vergleich, Geschlechterrollen.
Welche Aspekte der Familienpolitik werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Familienpolitik in Deutschland und Frankreich im Kontext der Erwerbstätigkeit von Frauen und analysiert die jeweiligen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Einfluss der Familienpolitik auf die Betreuungsstrukturen und die Rolle der Frauen in der Gesellschaft wird untersucht.
Wie werden die Betreuungsstrukturen verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Betreuungsstrukturen für Kinder in Deutschland und Frankreich, um deren Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von Müttern zu analysieren. Die Unterschiede in den verfügbaren Betreuungsangeboten und deren Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Rollen von Frauen werden beleuchtet.
- Citar trabajo
- Nadine Taubensee (Autor), 2015, Die Berufstätigkeit der Frau in Deutschland und Frankreich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317014