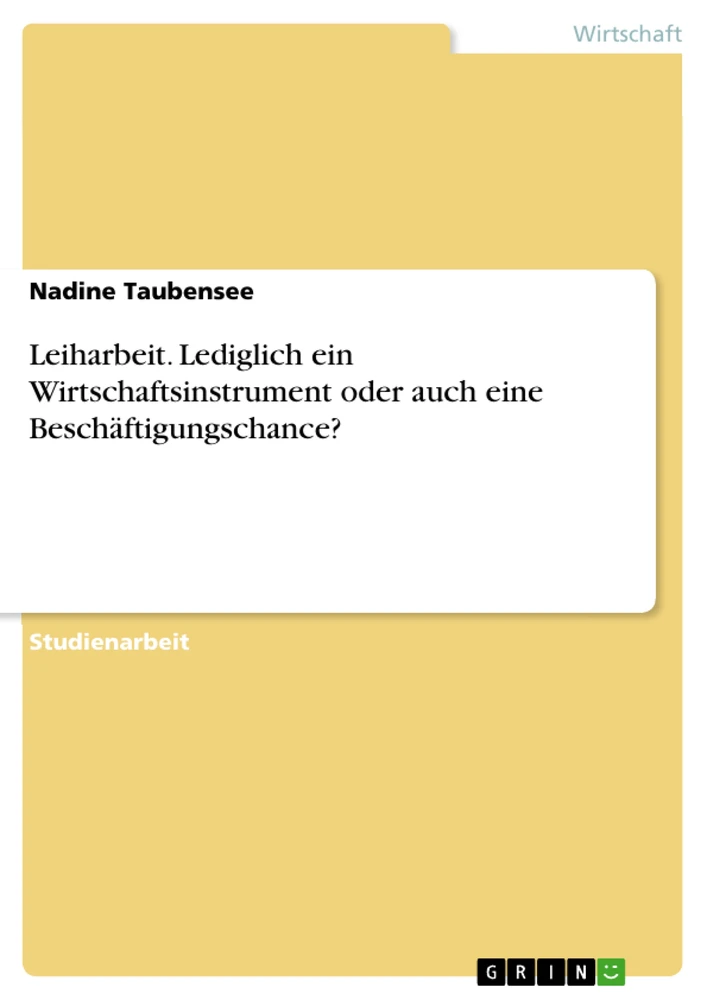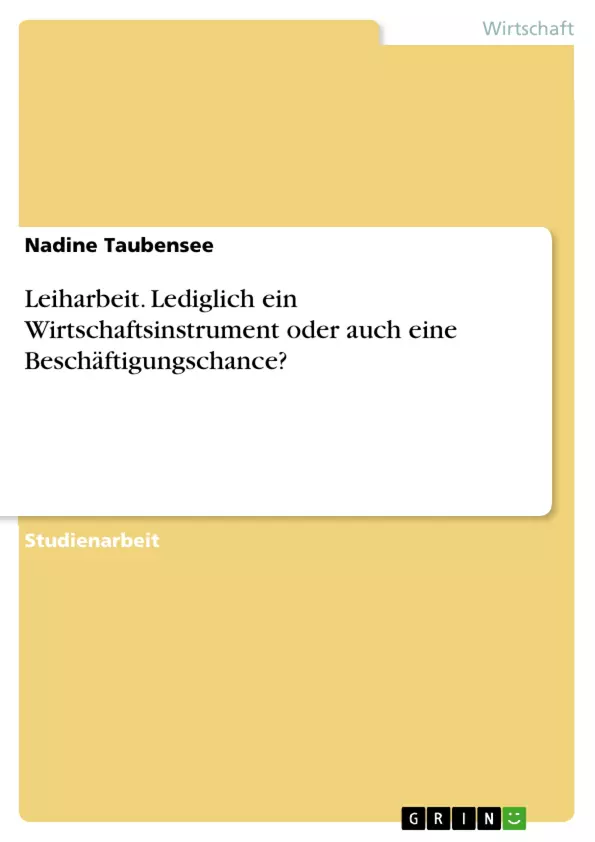In dieser Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, ob es sich bei der Leiharbeit in Deutschland entweder um ein reines wirtschaftliches Regulierungsinstrument handelt oder sie auch zu erhöhten Integrationschancen in den ersten Arbeitsmarkt führen kann.
Um diese beantworten zu können, wird die Leiharbeit zunächst definiert und ihre Merkmale analysiert. Darauf folgend wird auf die Reformen in Bezug auf die Leiharbeit eingegangen, wobei das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und die Hartz-Reformen betrachtet werden. Darauf aufbauend wird herausgestellt, welche Funktionen die Leiharbeit für die unterschiedlichen Parteien erfüllen beziehungsweise welche Vor- und Nachteile sie birgt, um Zusammenhänge in Bezug zu der Fragestellung erläutern und herausarbeiten zu können.
Lieber schlechte Arbeit als gar keine. So wie Nicole Peters denken viele Menschen in Deutschland. Sie ist eine von insgesamt ca. 824.000 Leiharbeitnehmern in Deutschland.
Das oberste Prinzip der Arbeitsförderung in Deutschland ist laut des §4 SGBIII die Eingliederung Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt. Die ANU wird hierbei als Chance gesehen, Arbeitslosen einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, neue Arbeitsplätze aufzubauen und so letzten Endes den staatlichen Haushalt zu entlasten. Diese Überlegung der Instrumentalisierung der Leiharbeit beruht hinlänglich auf der Schröder-Regierung.
Aufgrund des definierten Rahmens der Arbeit wird nicht gesondert auf die Diskussion in Bezug auf die niedrige Bezahlung in der Leiharbeitsbranche eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Leiharbeit
- Reformen in der Leiharbeit
- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- Hartz-Reformen
- Arbeitskonditionen von Leiharbeit
- Gleichbehandlungsgrundsatz
- Tarifvorbehalt
- Leiharbeit in Deutschland
- Motivation der beteiligten Parteien
- Arbeitnehmer
- Verleih- und Entleihunternehmen
- Entwicklung der Leiharbeit am Arbeitsmarkt
- Motivation der beteiligten Parteien
- Fazit / Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob Leiharbeit in Deutschland lediglich ein wirtschaftliches Regulierungsinstrument darstellt oder auch zu erhöhten Integrationschancen in den ersten Arbeitsmarkt führt. Die Analyse untersucht die Definition und Merkmale der Leiharbeit, die Reformen in Bezug auf die Leiharbeit, insbesondere das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und die Hartz-Reformen, sowie die Funktionen und Auswirkungen der Leiharbeit für die beteiligten Parteien.
- Definition und Merkmale der Leiharbeit
- Reformen in der Leiharbeit (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und Hartz-Reformen)
- Arbeitskonditionen von Leiharbeit
- Motivation der beteiligten Parteien (Arbeitnehmer, Verleih- und Entleihunternehmen)
- Entwicklung der Leiharbeit am Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Leiharbeit ein und stellt die Forschungsfrage dar. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Leiharbeit und analysiert die unterschiedlichen Bezeichnungen sowie die rechtlichen Grundlagen. Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Reformen in Bezug auf die Leiharbeit, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und die Hartz-Reformen, beleuchtet. Das vierte Kapitel widmet sich den Arbeitskonditionen in der Leiharbeit, wobei der Gleichbehandlungsgrundsatz und der Tarifvorbehalt im Fokus stehen. Kapitel fünf befasst sich mit der Leiharbeit in Deutschland und analysiert die Motivationen der beteiligten Parteien, Arbeitnehmer sowie Verleih- und Entleihunternehmen, und untersucht die Entwicklung der Leiharbeit am Arbeitsmarkt.
Schlüsselwörter
Leiharbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit, Hartz-Reformen, Arbeitskonditionen, Gleichbehandlungsgrundsatz, Tarifvorbehalt, Motivation, Entwicklung, Arbeitsmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Leiharbeit in Deutschland?
Leiharbeit (Arbeitnehmerüberlassung) beschreibt ein Dreiecksverhältnis, bei dem ein Verleiher einen Arbeitnehmer an ein Entleihunternehmen für eine begrenzte Zeit überlässt.
Wie haben die Hartz-Reformen die Leiharbeit verändert?
Die Reformen zielten darauf ab, die Leiharbeit als Instrument zur Eingliederung Arbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt zu stärken und gesetzliche Beschränkungen zu lockern.
Was bedeutet der Gleichbehandlungsgrundsatz (Equal Treatment)?
Er besagt, dass Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung Anspruch auf die gleichen wesentlichen Arbeitsbedingungen und das gleiche Entgelt wie vergleichbare Stammarbeitnehmer haben.
Bietet Leiharbeit echte Integrationschancen in den Arbeitsmarkt?
Leiharbeit wird oft als "Klebeeffekt" bezeichnet, da sie Arbeitslosen den Wiedereinstieg ermöglicht, birgt aber auch das Risiko einer dauerhaften Beschäftigung in prekären Verhältnissen.
Warum nutzen Unternehmen die Arbeitnehmerüberlassung?
Unternehmen nutzen sie als wirtschaftliches Regulierungsinstrument, um flexibel auf Auftragsspitzen zu reagieren, ohne langfristige Personalbindungen einzugehen.
- Arbeit zitieren
- Nadine Taubensee (Autor:in), 2016, Leiharbeit. Lediglich ein Wirtschaftsinstrument oder auch eine Beschäftigungschance?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317015