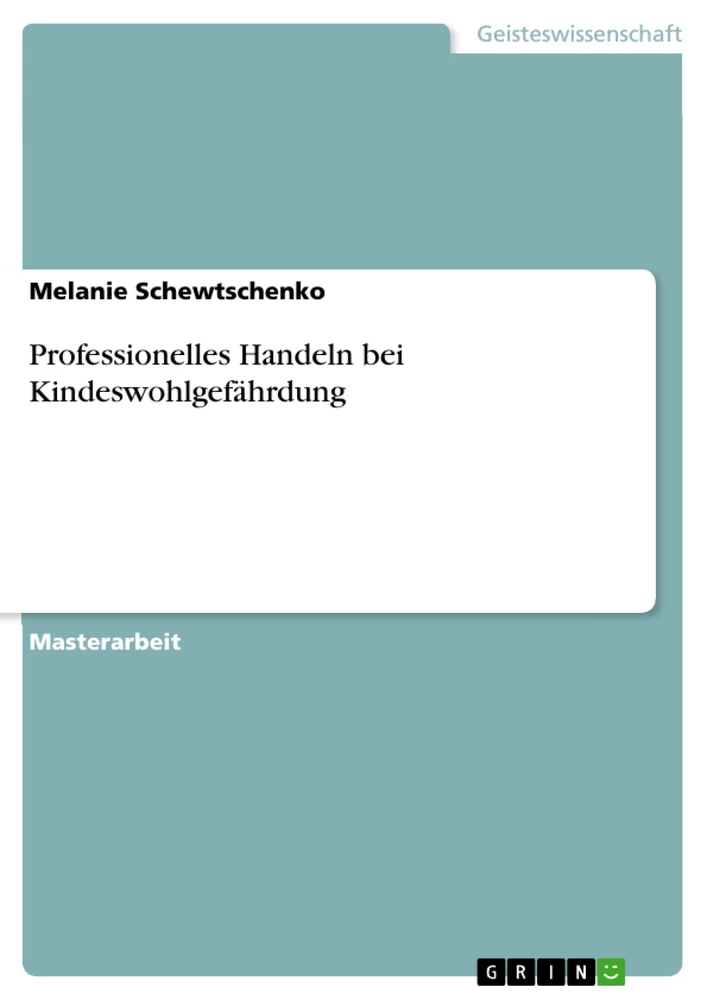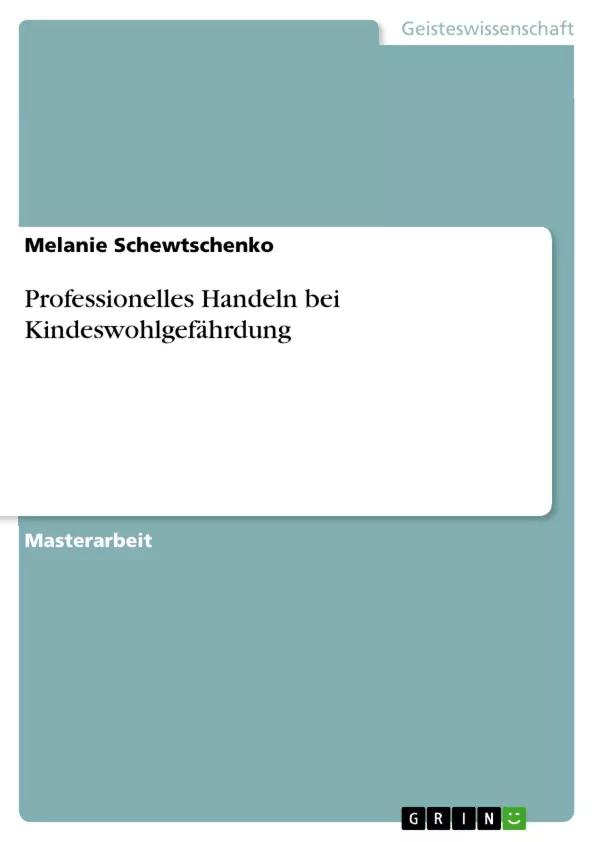In den letzten Jahren hat die Diskussion um Kindeswohlgefährdung eine große Präsenz in den Medien eingenommen. Viele schockierende Berichte von Kindestötungen, Misshandlungen und das Vernachlässigen der Schutzbefohlenen auch und gerade durch die eigenen Eltern sind immer wieder an die Öffentlichkeit gelangt. Besonders der Hungertod von Lea-Sophie in Schwerin im Jahr 2008 und der erschütternde Fall Kevin im Jahr 2006 zogen hier eine große
emotionale Debatte nach sich. Auch in der Politik hat das Thema zu Diskussionen und im Jahre 2005 sogar zu rechtlichen Neuerungen, wie den Paragraphen 8a, geführt. Bei diesen
dramatischen Fällen werden oft die Jugendämter sowie die einzelnen Fachkräfte in die Verantwortung genommen. (vgl. Köhler 2015, S. 8) Deren Aufgabe wird meistens auf das Wächteramt reduziert, infolgedessen ihnen oftmals erhebliche Versäumnisse in der Beaufsichtigung vorgeworfen werden. (vgl. Kinderschutzzentrum Berlin 2009, S.12) Hier stehen die Fachkräfte oftmals vor einem Dilemma: Handeln sie repressiv, wird ihnen vorgeworfen, das Kind vielleicht zu früh einer Familie entzogen zu haben. Sobald es aber zu einem Missbrauch oder gar zur Kindstötung kommt, heißt es dann aber, sie hätten nicht
rechtzeitig eingegriffen. Das Handeln der Fachkräfte bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Unterstützung und Hilfe sowie Pflicht und Kontrolle. (vgl. Köhler 2015, S. 8)
Politiker, Wissenschaftler und die Massenmedien haben das Jugendamt und seine Fehler fest in den Blick genommen (vgl. Ackermann 2010, S. 51). Mit einer solchen Situation müssen
die Fachkräfte im Kinderschutz, sowie die übrigen Organisationen alltäglich einen Umgang finden. Um das Wohl der Kinder besser zu schützen und hierbei Fehlern vorzubeugen,
wurden bereits vielfältige Sonderprogramme und gesetzliche bzw. administrative Neuregelungen erarbeitet. Es wurden Notdienste, Kinderschutzdienste, Verfahren, verbesserte
Arbeitsbedingungen als auch Personalschlüssel entwickelt und eingeführt. Trotz alledem zeigen die Ergebnisse und Diskussionen der letzten Jahre, dass das Thema in unserer
Gesellschaft noch nicht im gewünschten Maße gelöst wurde und dass es hier weiterer Bemühungen und Lösungsversuchen bedarf. (vgl. MGFFI 2010, S.12) Kinderschutz gehört unbestritten zu den wichtigsten und komplexesten Aufgaben der Jugendämter, denn sie übernehmen die Funktion des „staatlichen Wächteramtes“. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Thematische Einführung
- 2.1. Begrifflichkeiten
- 2.2. Formen von KWG und sich daraus ergebenden Folgen
- 2.3. Erklärungsmodelle - Ursachen für KWG
- 2.4. Das deutsche Kinderschutzsystem - Historische (Qualitäts-)Entwicklung
- 2.5. Öffentlich diskutierte Fälle von KWG - Fehler des ASD
- 3. Die Aufgaben des ASD bei Kindeswohlgefährdung
- 3.1. Organisation und Funktion des ASD
- 3.2. Rechtliche Aspekte und staatliches Wächteramt
- 3.3. Qualitätsentwicklung und Evaluation im ASD
- 3.4. Verfahren und Instrumente zur Gefahrenerkennung-/einschätzung
- 3.5. Verbesserung des Kinderschutzes durch Kooperation
- 4. Das professionelle Handeln der Fachkräfte im ASD
- 4.1. Was heißt Professionalität? Zur Theorie der reflexiven Professionalität nach Dewe
- 4.2. Studien zum professionellen Handeln
- 4.3. Rahmenbedingungen fachlichen Handelns:
- 4.3.1. Personalstruktur des ASD
- 4.3.2. Professionelle Handlungskompetenz der Fachkräfte
- 4.3.3. Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastung
- 4.4. Professionelles Handeln im Widerspruch zwischen
- 4.4.1. Hilfe und Kontrolle
- 4.4.2. Nähe und Distanz
- 5. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Professionalität im Kinderschutz und untersucht, wie die Arbeit von Fachkräften im Jugendamt in Bezug auf Kindeswohlgefährdung optimiert werden kann. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die sich aus der komplexen Situation von Kindeswohlgefährdung ergeben, und erörtert die Bedeutung von professionellem Handeln und Qualitätsentwicklung im Kinderschutz.
- Definition und Formen von Kindeswohlgefährdung
- Ursachen und Folgen von Kindeswohlgefährdung
- Das deutsche Kinderschutzsystem und seine historische Entwicklung
- Die Aufgaben des Jugendamtes im Kontext von Kindeswohlgefährdung
- Professionelles Handeln von Fachkräften im Kinderschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz und Aktualität des Themas Kindeswohlgefährdung beleuchtet. Kapitel 2 führt in die Thematik ein, indem es die Begriffe „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefährdung“ definiert und die verschiedenen Formen von Kindeswohlgefährdung sowie deren Folgen erläutert. Außerdem werden Erklärungsmodelle für die Ursachen von Kindeswohlgefährdung vorgestellt. Kapitel 2.4 beleuchtet das deutsche Kinderschutzsystem und seine historische Entwicklung. Kapitel 3 widmet sich den Aufgaben des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung, wobei Organisation, rechtliche Aspekte, Qualitätsentwicklung und Verfahren zur Gefahrenerkennung im Fokus stehen. Kapitel 4 untersucht das professionelle Handeln der Fachkräfte im Jugendamt, indem es die Theorie der reflexiven Professionalität, Studien zum professionellen Handeln und die Rahmenbedingungen fachlichen Handelns beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kindeswohlgefährdung, Kinderschutz, Jugendamt, Fachkräfte, Professionalität, Qualitätsentwicklung, Gefahrenerkennung, Kooperation, Hilfe und Kontrolle, Nähe und Distanz, Erklärungsmodelle, Folgen von Kindeswohlgefährdung, Rechtliche Aspekte, Arbeitsbedingungen, Handlungskompetenz.
- Quote paper
- Melanie Schewtschenko (Author), 2015, Professionelles Handeln bei Kindeswohlgefährdung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317054