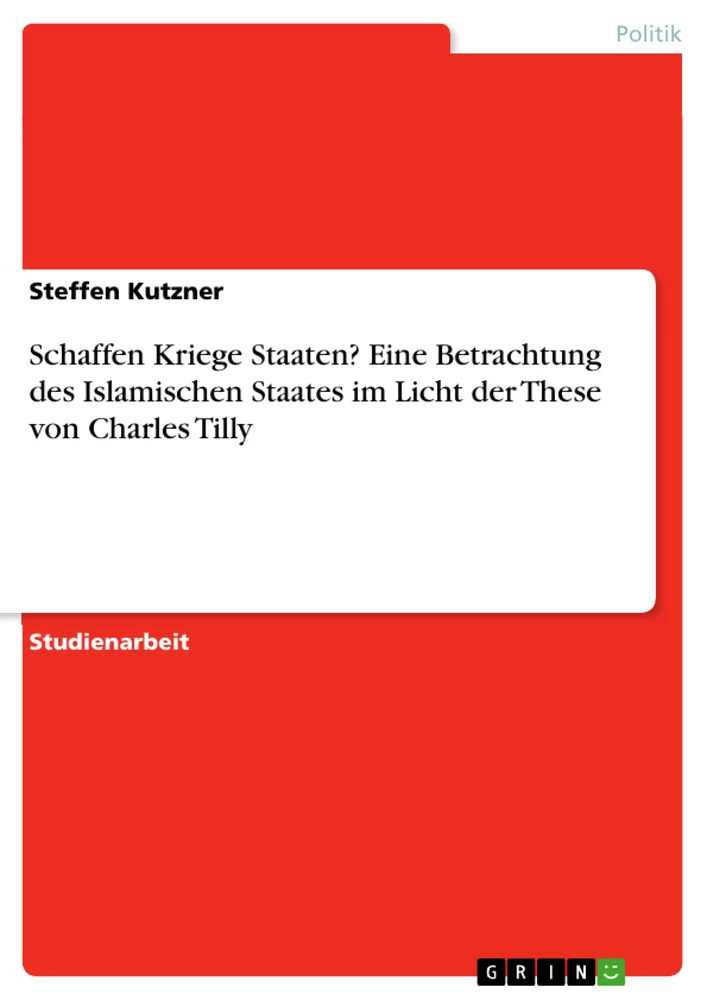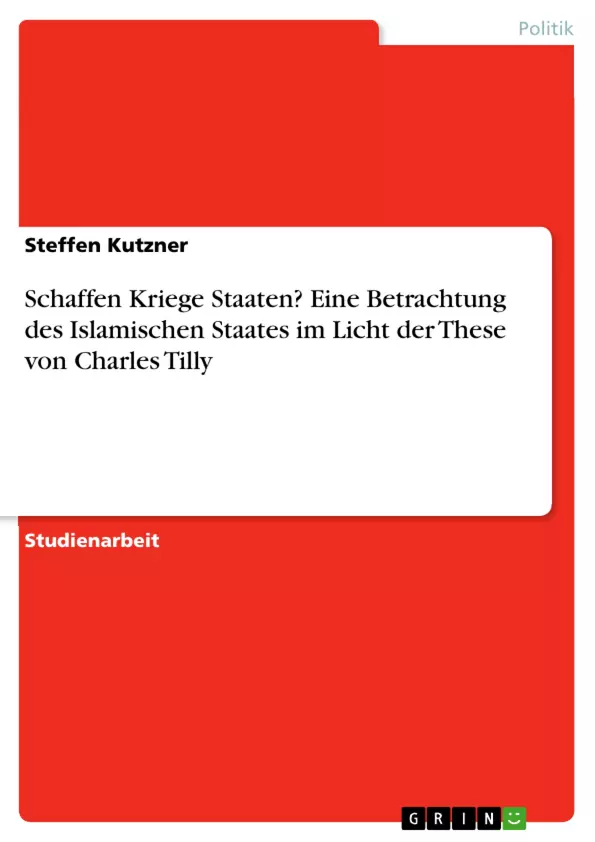Die folgende Arbeit befasst sich mit der These der Staatenbildung nach Charles Tilly. Dies soll am Beispiel des Islamischen Staates geschehen.
Charles Tilly gilt als einer der wichtigsten Forscher, die sich mit dem thematischen Komplex der Staatsbildung befasst haben. Sein Ansatz lässt sich grob herunterbrechen auf die These, dass Staaten im Laufe der Geschichte nur dann bestehen konnten, wenn sie ein funktionierendes System entwickelten, um die immer mehr Geldmittel verschlingende (Möglichkeit zur) Kriegsführung aufrecht zu erhalten. Durch technologischen Fortschritt wurden Kriege zunehmend teurer, so dass ein stetiger Kapitalfluss zwingend nötig geworden ist, woraus sich Steuersysteme, das Bankwesen und die dauerhafte Bindung zahlungsfähiger Unterstützer entwickelten.
Diese Ausarbeitung versucht nicht, diese These zu verifizieren oder falsifizieren, sondern untersucht anhand zeitgenössischer Beispiele wie dem Islamischen Staat, ob Kriege noch immer Staaten schaffen und warum beziehungsweise warum das nicht (mehr) so ist.
Zusätzlich wird der Versuch einer Begründung geliefert. Das Beispiel des Islamischen Staates wurde nicht nur gewählt, weil das Kalifat einen potenziellen gegenwärtigen Staatsbildungsprozess repräsentiert, sondern auch weil sich Tillys Thesen und Veröffentlichungen auf die westliche Hemisphäre konzentrieren und sich so möglicherweise neue Erkenntnisse gewinnen lassen, bezüglich der Frage, ob sich „western state making“ auch auf Prozesse im Nahen Osten übertragen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Tillys These im Detail
- 2.1 Wie die Handlungsfelder zusammenwirken
- 2.2 Gewaltmonopolisierung
- 3. Wie entstehen Staaten heute?
- 3.1 Auf welchen Handlungsfeldern ist ISIS aktiv?
- 3.2 Entspricht der IS der Definition eines Staates?
- 4. Schaffen Kriege Staaten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht anhand des Beispiels des Islamischen Staates (IS), ob Tillys These, dass Kriege Staaten schaffen, auch für gegenwärtige Prozesse zutrifft. Sie analysiert, ob der IS nach Tillys Definition ein Staat ist und ob seine Entstehung mit kriegerischen Aktivitäten in Verbindung steht. Die Arbeit fokussiert auf die Übertragbarkeit des westlichen "state making"-Modells auf den Nahen Osten.
- Tillys These der Staatsbildung durch Krieg
- Die vier Handlungsfelder des Staates nach Tilly (state making, war making, protection, extraction)
- Der Islamische Staat (IS) als Fallbeispiel für gegenwärtige Staatsbildungsprozesse
- Die Rolle von Gewaltmonopolisierung und Ressourcenkontrolle bei der Staatsbildung
- Übertragbarkeit des westlichen Staatsbildungsmodells auf den Nahen Osten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Staatsbildung nach Charles Tilly ein und stellt die zentrale Forschungsfrage: Entstehen Staaten auch heute noch durch Krieg? Der Islamische Staat (IS) wird als aktuelles Beispiel für einen potentiellen Staatsbildungsprozess ausgewählt, um Tillys These, die sich primär auf die westliche Hemisphäre konzentriert, auf den Nahen Osten anzuwenden und möglicherweise neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der IS nach Tillys Definition ein Staat ist und ob er durch Krieg entstanden ist. Klare Begrifflichkeiten (ISIS vs. IS) werden definiert, um Missverständnisse zu vermeiden.
2. Tillys These im Detail: Dieses Kapitel erläutert Tillys Kernthese "War makes states" und seine Definition eines Staates als Struktur der Macht mit vier Elementen: konzentrierte Mittel der Zwangsgewalt, Organisation unabhängig von Verwandtschafts- und Religionsbeziehungen, definiertes Gebiet der Gerichtsbarkeit und Priorität gegenüber anderen Organisationen innerhalb dieses Gebiets. Es werden Tillys vier Handlungsfelder (state making, war making, protection, extraction) vorgestellt, die für die Analyse des IS relevant sind. Das Kapitel betont die Bedeutung der Geldmittelbeschaffung (extraction) für die Kriegsführung und den dauerhaften Bestand eines Staates. Die Interaktion dieser Handlungsfelder wird diskutiert, wobei die Kriegsführung (war making) als zentraler Motor der Staatsbildung hervorgehoben wird. Die Herausbildung eines stehenden Heeres wird als entscheidender Schritt für die Konsolidierung staatlicher Macht beschrieben.
Schlüsselwörter
Staatsbildung, Charles Tilly, War Making, State Making, Islamischer Staat (IS), ISIS, Gewaltmonopolisierung, Ressourcenkontrolle, Geldmittelbeschaffung (Extraction), Krieg, Naher Osten, Westliches Staatsbildungsmodell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ausarbeitung: "Schaffen Kriege Staaten? Eine Analyse am Beispiel des Islamischen Staates"
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Diese Arbeit untersucht, ob Charles Tillys These „War makes states“ auch auf gegenwärtige Staatsbildungsprozesse zutrifft. Am Beispiel des Islamischen Staates (IS) wird analysiert, ob der IS nach Tillys Definition ein Staat ist und ob seine Entstehung mit kriegerischen Aktivitäten in Verbindung steht. Ein besonderer Fokus liegt auf der Übertragbarkeit des westlichen „state making“-Modells auf den Nahen Osten.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt Tillys These der Staatsbildung durch Krieg, seine vier Handlungsfelder (state making, war making, protection, extraction), den IS als Fallbeispiel, die Rolle von Gewaltmonopolisierung und Ressourcenkontrolle, und die Übertragbarkeit des westlichen Modells auf den Nahen Osten.
Wie ist die Ausarbeitung strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Tillys These, ein Kapitel zur Entstehung heutiger Staaten am Beispiel des IS und ein Kapitel zur Frage, ob Kriege Staaten schaffen. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und die Schlüsselwörter.
Was ist Tillys These zur Staatsbildung?
Tilly argumentiert, dass Kriege Staaten schaffen. Er definiert den Staat als eine Struktur der Macht mit vier Elementen: konzentrierte Mittel der Zwangsgewalt, Organisation unabhängig von Verwandtschafts- und Religionsbeziehungen, definiertes Gebiet der Gerichtsbarkeit und Priorität gegenüber anderen Organisationen innerhalb dieses Gebiets. Vier Handlungsfelder (state making, war making, protection, extraction) sind für die Staatsbildung zentral, wobei die Kriegsführung als Motor der Staatsbildung hervorgehoben wird.
Welche Rolle spielt der Islamische Staat (IS) in dieser Ausarbeitung?
Der IS dient als aktuelles Beispiel, um Tillys These, die sich primär auf die westliche Hemisphäre bezieht, auf den Nahen Osten anzuwenden. Die Ausarbeitung untersucht, ob der IS nach Tillys Definition als Staat betrachtet werden kann und ob seine Entstehung mit kriegerischen Aktivitäten zusammenhängt.
Welche Bedeutung haben die vier Handlungsfelder nach Tilly?
Tillys vier Handlungsfelder – state making (Staatsbildung), war making (Kriegsführung), protection (Schutz) und extraction (Geldmittelbeschaffung) – werden als interagierende Elemente der Staatsbildung betrachtet. Die Kriegsführung (war making) spielt dabei eine zentrale Rolle, und die Geldmittelbeschaffung (extraction) ist essentiell für den dauerhaften Bestand eines Staates.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht im gegebenen Text enthalten, da die Zusammenfassung der Kapitel nur eine Beschreibung der Kapitel ist und keine Schlussfolgerungen zieht. Die Ausarbeitung selbst müsste konsultiert werden, um dies zu beantworten.)
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Staatsbildung, Charles Tilly, War Making, State Making, Islamischer Staat (IS), ISIS, Gewaltmonopolisierung, Ressourcenkontrolle, Geldmittelbeschaffung (Extraction), Krieg, Naher Osten, Westliches Staatsbildungsmodell.
- Quote paper
- Steffen Kutzner (Author), 2015, Schaffen Kriege Staaten? Eine Betrachtung des Islamischen Staates im Licht der These von Charles Tilly, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317284