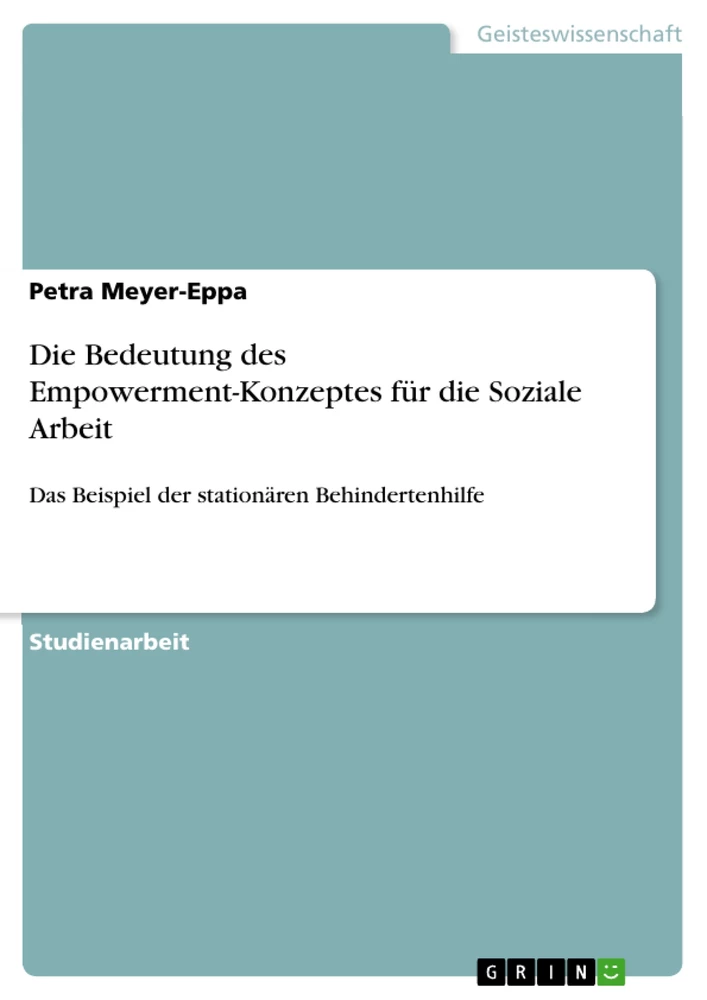Mit dem Wort Empowerment werden innerhalb der Sozialen Arbeit häufig die Begriffe Selbstbefähigung und Stärkung der eigenen Autonomie verbunden. Aber das Empowerment-Konzept ist deutlich umfangreicher und vielschichtiger und es ist keine einzelne Methode oder Technik, sondern eine Grundhaltung.
In gängigen Wörterbüchern wird Empowerment mit den Begriffen „Bevollmächtigung“, „Ermächtigung“, „Stärkung“ und „Unterstützung“ übersetzt. Heringer (2014) bezeichnet damit die Stärkung von Eigenmacht und Autonomie, erklärt aber auch, dass der Begriff Empowerment „eine offene normative Form“ ist, ein „Begriffsregal, das mit unterschiedlichen Grundüberzeugungen, Werthaltungen und moralischen Positionen aufgefüllt werden kann“. Empowerment findet sich als Schlagwort in vielen Konzepten der Sozialen Arbeit wieder, wobei der Fokus darauf liegt, den Klienten/Betroffenen wieder in die Lage zu versetzen selbständig handeln und durch Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit das eigene Leben autonom und aktiv gestalten zu können.
Ziel dieser Arbeit ist, die Komplexität des Begriffs Empowerment zu erläutern. Historische und theoretische Hintergründe werden betrachtet und die spezifische Bedeutung und die damit verbundene Grundhaltung von Empowerment herausgearbeitet. Konkretisiert wird das anhand des Praxisfeldes der stationären Behindertenhilfe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1 Historischer Ursprung
- 2.2 Theoretischer Hintergrund
- 3. Grundhaltung des Empowerment
- 4. Bedeutung für die Soziale Arbeit
- 4.1 im allgemeinen
- 4.2 für den Bereich der stationären Behindertenhilfe
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das komplexe Empowerment-Konzept zu erläutern. Historische und theoretische Hintergründe werden beleuchtet, und die spezifische Bedeutung sowie die damit verbundene Grundhaltung von Empowerment werden herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Anwendung im Praxisfeld der stationären Behindertenhilfe.
- Historische Entwicklung des Empowerment-Konzepts
- Theoretische Grundlagen und verschiedene Zugänge zum Verständnis von Empowerment
- Die Bedeutung von Empowerment für die Soziale Arbeit im Allgemeinen
- Spezifische Relevanz von Empowerment in der stationären Behindertenhilfe
- Empowerment als Grundhaltung und Handlungskonzept
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Julius Hermann von Kirchmann, das bereits Grundgedanken des Empowerments vorwegnimmt: Selbstständigkeit und politische Mündigkeit als Grundlage für individuelle und gesellschaftliche Veränderung. Sie führt in das Thema ein und benennt das Ziel der Arbeit: die Erläuterung der Komplexität des Empowerment-Konzepts, unter Berücksichtigung historischer und theoretischer Hintergründe, sowie dessen Bedeutung im Kontext der stationären Behindertenhilfe.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt den Begriff Empowerment und seine verschiedenen Übersetzungen (Bevollmächtigung, Ermächtigung etc.). Es betont den offenen und normativen Charakter des Begriffs, der mit verschiedenen Grundüberzeugungen aufgefüllt werden kann. Der Fokus liegt auf der Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und der Ermöglichung eines autonomen und aktiven Lebens der Klienten. Es wird deutlich, dass Empowerment kein einzelnes Verfahren, sondern eine umfassende Grundhaltung darstellt.
2.1 Historischer Ursprung: Dieses Unterkapitel beleuchtet die erste schriftliche Erwähnung des Begriffs "Empowerment" in Barbara B. Salomons Buch "Black Empowerment" von 1976. Es wird der Bezug zu der Bürgerrechtsbewegung in den USA der 1950er und 1960er Jahre hergestellt und die Verknüpfung mit dem Wirken von Martin Luther King betont. Darüber hinaus werden die Wurzeln des Konzepts in Ansätzen der psychosozialen Praxis, der Lebensweltorientierung und der Selbsthilfe aufgezeigt, um zu verdeutlichen, dass Empowerment auf bereits bestehenden Konzepten aufbaut.
2.2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel analysiert verschiedene theoretische Zugänge zum Empowerment-Begriff, die Herriger (2014) unterscheidet: den politischen, den lebensweltlichen, den reflexiven und den transitiven Zugang. Jeder Zugang beleuchtet unterschiedliche Facetten von Empowerment – von der Aneignung politischer Macht bis hin zur Unterstützung und Förderung von Selbstbestimmung durch professionelle Helfer. Die Kapitel verdeutlichen die Vielschichtigkeit des Konzepts und die Notwendigkeit, die verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Empowerment, Selbstbestimmung, Autonomie, Handlungsfähigkeit, Soziale Arbeit, Behindertenhilfe, Lebensweltorientierung, Selbsthilfe, politische Partizipation, professionelle Unterstützung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Empowerment in der stationären Behindertenhilfe
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Empowerment-Konzept, insbesondere im Kontext der stationären Behindertenhilfe. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Text beleuchtet historische und theoretische Hintergründe von Empowerment und analysiert dessen Bedeutung für die Soziale Arbeit allgemein und speziell in der Behindertenhilfe.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsklärung (mit Unterkapiteln zu historischem Ursprung und theoretischem Hintergrund), Grundhaltung des Empowerment, Bedeutung für die Soziale Arbeit (allgemein und speziell in der stationären Behindertenhilfe) und Fazit.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit zielt darauf ab, das komplexe Empowerment-Konzept zu erläutern und seine Bedeutung für die Soziale Arbeit, insbesondere in der stationären Behindertenhilfe, herauszuarbeiten. Historische und theoretische Hintergründe werden beleuchtet, und die spezifische Bedeutung sowie die damit verbundene Grundhaltung von Empowerment werden detailliert beschrieben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die historische Entwicklung des Empowerment-Konzepts, die theoretischen Grundlagen und verschiedenen Zugänge zum Verständnis von Empowerment, die Bedeutung von Empowerment für die Soziale Arbeit im Allgemeinen, die spezifische Relevanz in der stationären Behindertenhilfe und Empowerment als Grundhaltung und Handlungskonzept.
Wie wird der Begriff "Empowerment" definiert?
Der Begriff "Empowerment" wird im Dokument umfassend geklärt und seine verschiedenen Übersetzungen (Bevollmächtigung, Ermächtigung etc.) beleuchtet. Es wird betont, dass es sich um einen offenen und normativen Begriff handelt, der mit verschiedenen Grundüberzeugungen aufgefüllt werden kann. Der Fokus liegt auf der Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und der Ermöglichung eines autonomen und aktiven Lebens der Klienten. Empowerment wird als umfassende Grundhaltung und nicht als einzelnes Verfahren dargestellt.
Welche historischen Wurzeln hat das Empowerment-Konzept?
Die historischen Wurzeln des Empowerment-Konzepts werden im Dokument mit Bezug auf Barbara B. Salomons Buch "Black Empowerment" (1976) und die Bürgerrechtsbewegung in den USA der 1950er und 1960er Jahre erläutert. Es wird die Verbindung zu Martin Luther King hervorgehoben. Zusätzlich werden die Wurzeln in Ansätzen der psychosozialen Praxis, der Lebensweltorientierung und der Selbsthilfe aufgezeigt.
Welche theoretischen Zugänge zum Empowerment-Begriff werden vorgestellt?
Das Dokument analysiert verschiedene theoretische Zugänge zum Empowerment-Begriff nach Herriger (2014): den politischen, den lebensweltlichen, den reflexiven und den transitiven Zugang. Jeder Zugang beleuchtet unterschiedliche Facetten von Empowerment, von der Aneignung politischer Macht bis hin zur Unterstützung und Förderung von Selbstbestimmung durch professionelle Helfer.
Welche Bedeutung hat Empowerment für die Soziale Arbeit und speziell die Behindertenhilfe?
Das Dokument betont die zentrale Bedeutung von Empowerment für die Soziale Arbeit im Allgemeinen und hebt seine spezifische Relevanz in der stationären Behindertenhilfe hervor. Es wird gezeigt, wie Empowerment zur Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und zur Förderung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen beitragen kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Empowerment, Selbstbestimmung, Autonomie, Handlungsfähigkeit, Soziale Arbeit, Behindertenhilfe, Lebensweltorientierung, Selbsthilfe, politische Partizipation, professionelle Unterstützung.
- Quote paper
- Petra Meyer-Eppa (Author), 2015, Die Bedeutung des Empowerment-Konzeptes für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317306