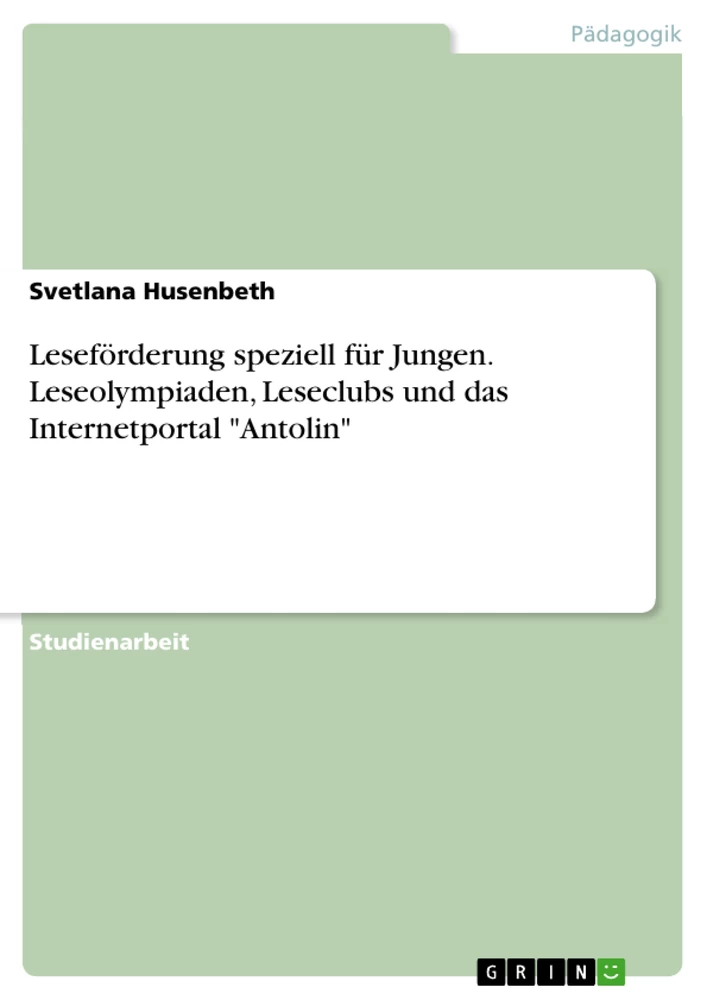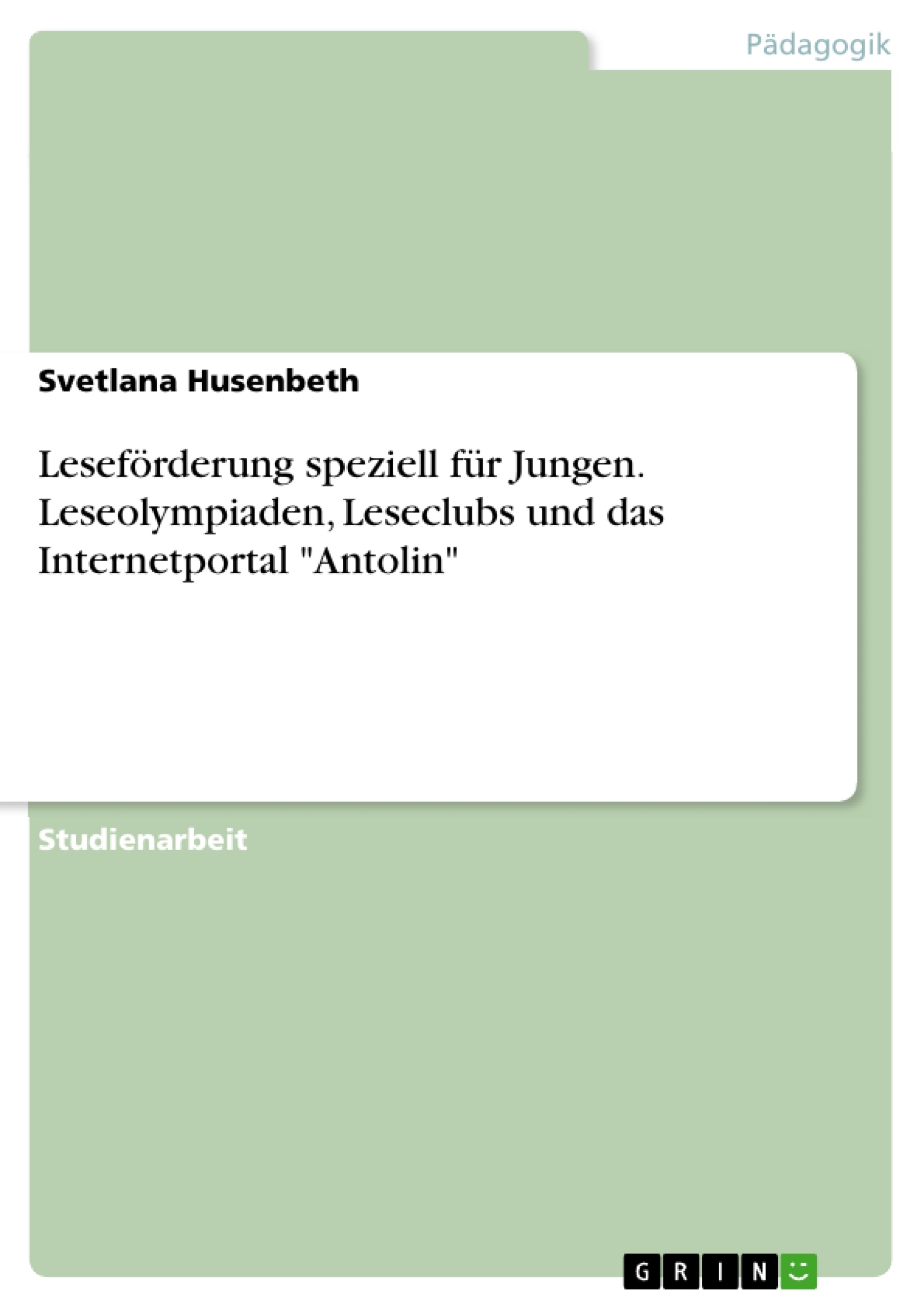Jungen lesen anders – und anderes als Mädchen. Diese Feststellung ist nicht neu, wie Wienholz schreibt. Weiterhin führt sie aus, dass „für Kenner der PISA-Studie [...] die genannte Behauptung ein knapp und griffig zusammengefasstes Ergebnis der Antworten auf die Frage [ist], warum in allen PISA-Teilnehmerstaaten Jungen im Bereich Lesekompetenz signifikant schlechter abschneiden“ {Wienholz 2005, S. 3}. Diese Unterschiede werden umso deutlicher, je anspruchsvoller die Aufgaben werden und je mehr Fliesstext sie haben. Zudem zeigt sich, dass die Unterschiede zwar schulartenübergreifend sind, dass aber die Jungen im unteren und untersten Leistungsniveau über- und im obersten unterrepräsentiert sind. Dies kann verschiedene Ursachen haben: Freizeitverhalten, Leseverhalten und Lesestoffe und Auswahl der Bücher. Diese Aspekte werden weiter unten Beachtung finden. Wichtig ist zunächst festzuhalten, dass es signifikante Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen bezüglich des Lesens gibt.
In der vorliegenden Arbeit habe ich mich damit beschäftigt, wie man die relativ leseschwachen Jungen besser fördern kann, damit die am Anfang bei vielen noch vorhandene Leselust über die Grundschulzeit hinaus erhalten werden kann. Ich finde es sinnvoll, bereits in der Grundschule anzufangen, deshalb gelten die hier vorliegenden die Fördervorschläge für die Grundschularbeit.
Zunächst geht es hier darum, zu begründen, warum eine spezielle Jungenförderung nötig ist. Anhand unterschiedlicher Fachliteratur möchte ich aufzeigen, dass es tatsächlich notwendig ist, Jungen gezielt und getrennt von den Mädchen zu fördern. Anschließend stelle ich beispielhaft bereits vorhandene Fördervorschläge aus der Praxis. Dazu
gehören die Lese- und Lernolympiade von Bamberger genauso wie das Internetportal „Antolin“.
Anschließend stelle ich meinen eigenen Vorschlag zur Leseförderung von Jungen in der Grundschule vor, zusammen mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Begründung der Leseförderung speziell für Jungen
- Zur Situation der Lesekompetenz der Jungen
- Zur Situation des Leseunterrichts
- Das Internetportal „Antolin“ - kurze Vorstellung
- Was ist „Antolin“?
- Wie funktioniert „Antolin“ genau?
- „Antolin“ in der Grundschule: Schülersicht
- „Antolin“ in der Grundschule aus Lehrersicht
- „Antolin“ und die Eltern
- Fazit: Was leistet „Antolin“ für die Leseförderung?
- Die Lese- und Lernolympiade
- Praktische Durchführung
- Welche Maßnahmen werden zur Unterstützung der Lese- und Lernolympiade empfohlen?
- Leseergebnisse, Prämien für besondere Leseleistungen und der Umgang mit Langsamlesern
- Fazit
- Leseclub für Jungen "Lesepiraten"
- Institutionelle Voraussetzungen
- Interne Organisation
- Zur konkreten Förderung
- Wie soll ein Lesepass aussehen? Was gehört da alles hinein?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Leseförderung von Jungen in der Grundschule verbessert werden kann. Der Fokus liegt dabei auf der besonderen Situation von Jungen, die im Vergleich zu Mädchen häufig eine geringere Lesemotivation und -kompetenz aufweisen. Die Arbeit analysiert die Ursachen für diese Unterschiede und stellt verschiedene Förderprogramme und Konzepte vor, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Jungen zugeschnitten sind.
- Analyse der Lesekompetenz und -motivation von Jungen in der Grundschule
- Bewertung von Förderprogrammen wie „Antolin“ und der Lese- und Lernolympiade
- Entwicklung eines eigenen Konzepts zur Leseförderung von Jungen im Grundschulalter
- Die Rolle von Freizeitaktivitäten und Medien im Leseverhalten von Jungen
- Die Bedeutung von Geschlechterrollen in der Literatur für die Lesemotivation von Jungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Leseförderung von Jungen in der Grundschule vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 analysiert die Gründe für die Unterschiede in der Lesekompetenz und -motivation von Jungen und Mädchen. Dabei werden die Ergebnisse verschiedener Studien und Untersuchungen herangezogen. Kapitel 3 stellt das Internetportal „Antolin“ als ein Beispiel für ein bestehendes Förderprogramm vor und beleuchtet seine Vor- und Nachteile. Kapitel 4 widmet sich der Lese- und Lernolympiade und untersucht ihre Wirksamkeit als Fördermaßnahme. Kapitel 5 stellt ein eigenes Konzept zur Leseförderung von Jungen vor, den „Lesepiraten“-Leseclub. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Leseförderung, Jungenförderung, Grundschule, Lesemotivation, Lesekompetenz, „Antolin“, Lese- und Lernolympiade, „Lesepiraten“-Leseclub, Geschlechterrollen, Medien, Freizeitverhalten, Literaturdidaktik, PISA-Studie, IGLU-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Warum benötigen Jungen eine spezielle Leseförderung?
Studien wie PISA zeigen, dass Jungen signifikant schlechtere Lesekompetenzen aufweisen und oft ein anderes Leseverhalten als Mädchen haben.
Was ist das Internetportal "Antolin"?
Antolin ist ein Programm zur Leseförderung, bei dem Schüler Quizfragen zu gelesenen Büchern beantworten und dafür Punkte sammeln können.
Wie funktioniert die Leseolympiade?
Es ist ein Wettbewerbsformat, das durch spielerische Elemente und Prämien für Leseleistungen die Motivation der Kinder steigern soll.
Was sind die "Lesepiraten"?
Dies ist ein spezieller Leseclub-Vorschlag für Jungen, der durch interne Organisation und einen Lesepass gezielt die Leselust fördern soll.
Welche Rolle spielen die Eltern bei der Leseförderung?
Eltern sind wichtig, um das Leseverhalten zu unterstützen, beispielsweise durch die Nutzung von Programmen wie Antolin auch im häuslichen Umfeld.
- Quote paper
- Svetlana Husenbeth (Author), 2014, Leseförderung speziell für Jungen. Leseolympiaden, Leseclubs und das Internetportal "Antolin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317308