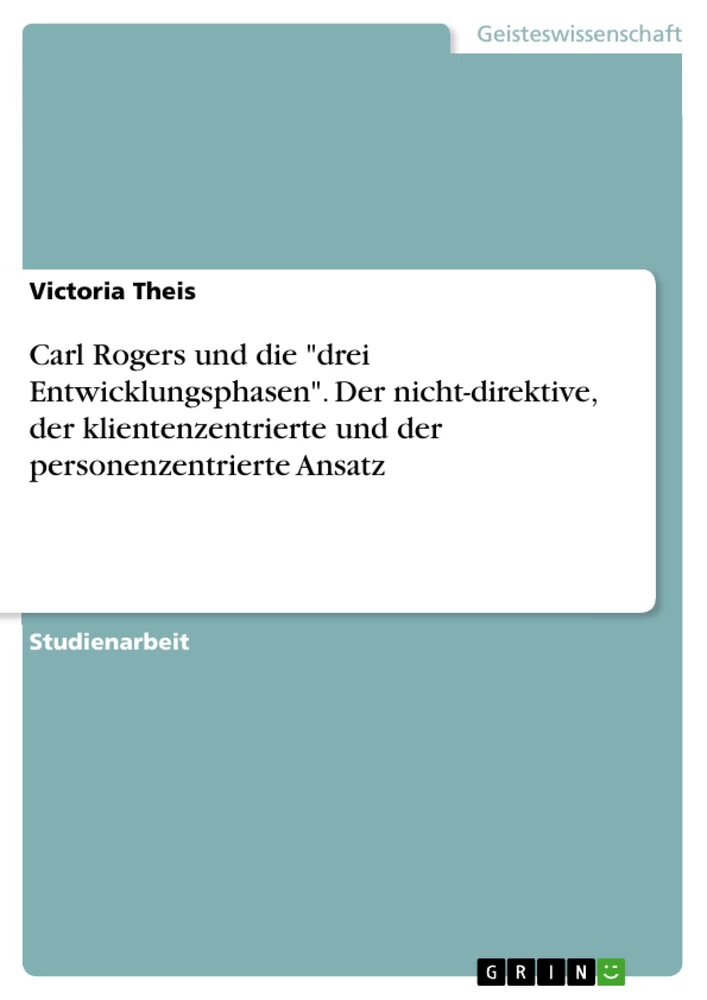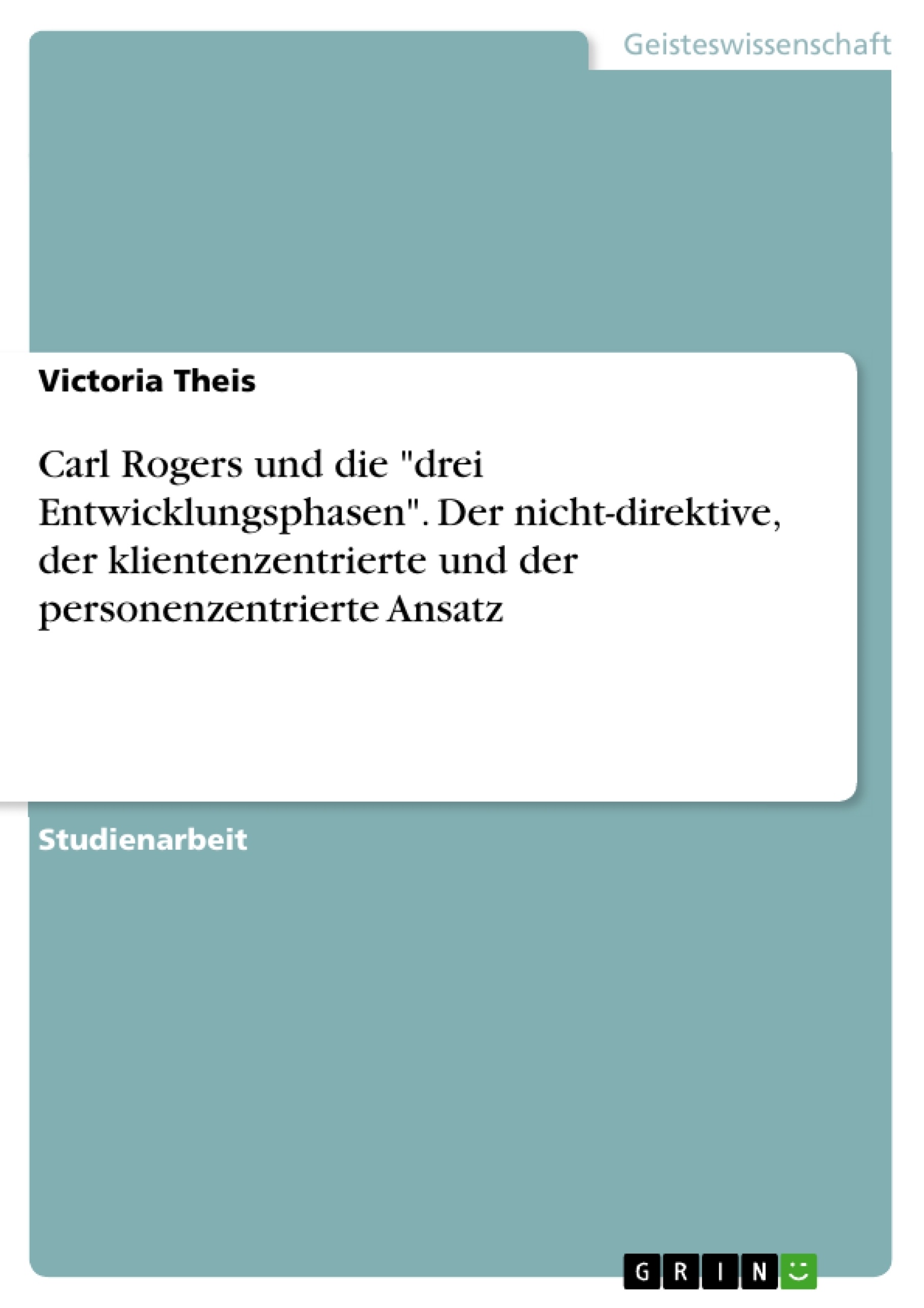Der Titel der vorliegenden Arbeit lässt offen, ob Carl Rogers Werk in den Bereich der Psychotherapie bzw. Beratung fällt, oder ob es einer Methode der Gesprächsführung zuzuordnen ist. Der theorieleitende Aufsatz mit dem Titel „A Theory of Therapy, Personality and Interpersonal Relationship , as developed in the Client-Centered Framework“ wurde zwar von Rogers verfasst, jedoch wurden die theoretischen Grundlagen „damals sehr vage vorformuliert.“ Es wurde somit Raum geschaffen für eigenständige Entwicklungen und Begriffsformulierungen in verschiedenen Kontexten.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung der sogenannten „Drei Entwicklungsphasen“ im Werk von Carl Rogers. Als Orientierung dienen die von Sabine Weinberger benannten Phasen: Die nicht-direktive Phase; die klientenzentrierte Phase und die personenzentrierte Phase.
Die drei Phasen werden jeweils mit persönlichen Erfahrungen und Lernerlebnissen Carl Rogers gefüllt. Daneben wird das Menschenbild Rogers miteinbezogen, welches die Grundlage seiner Persönlichkeitstheorien darstellt. Zudem wird eine Variable genauer betrachtet, die für die jeweilige Phase von besonderer Bedeutung ist. Alle drei therapeutischen Einstellungen sind eng miteinander verbunden: „Es sind vielleicht drei Dimensionen eines elementaren Faktors.“ Die Schlussbetrachtung sowie der Ausblick geben einen Überblick über einige Schwierigkeiten des Ansatzes von Carl Rogers.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE NICHT-DIREKTIVE PHASE
- Fazit der nicht- direktiven Phase
- DIE KLIENTENZENTRIERTE PHASE
- Fazit der klientenzentrierten Phase
- DIE PERSONENZENTRIERTE PHASE
- Fazit der personenzentrierten Phase
- FAZIT UND AUSBLICK
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung der sogenannten „Drei Entwicklungsphasen“ im Werk von Carl Rogers. Ziel ist es, die Entwicklung von Rogers' Ansatz von der nicht-direktiven Phase über die klientenzentrierte Phase bis hin zur personenzentrierten Phase zu beleuchten. Dabei werden die jeweiligen Phasen mit persönlichen Erfahrungen und Lernerlebnissen Carl Rogers gefüllt, das Menschenbild Rogers miteinbezogen und wichtige Variablen, die für die jeweilige Phase von besonderer Bedeutung sind, beleuchtet.
- Die Entwicklung von Carl Rogers' therapeutischem Ansatz
- Die drei Phasen: nicht-direktiv, klientenzentriert, personenzentriert
- Das Menschenbild von Carl Rogers
- Wichtige Variablen in jeder Phase
- Schwierigkeiten des Ansatzes von Carl Rogers
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
In der Einleitung wird der Titelbegriff der Arbeit „Carl Rogers- Vom nicht- direktiven zum Personenzentrierten Ansatz“ vorgestellt und die Einordnung des Werkes in den Bereich der Psychotherapie bzw. Beratung diskutiert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der sogenannten „Drei Entwicklungsphasen“ im Werk von Carl Rogers: die nicht-direktive, die klientenzentrierte und die personenzentrierte Phase.
2. Die nicht-direktive Phase
Das Kapitel befasst sich mit Rogers' erstem, in größeren Kreisen bekanntes Buch „Counseling and Psychotherapy“, das in Deutschland unter dem Titel „Die nicht- direktive Beratung“ bekannt wurde. Es wird auf Rogers' Erfahrungen in einer sozialpsychiatrischen Beratungsstelle eingegangen, wo er zu der Erkenntnis gelangt, dass der Klient derjenige ist, der seine Probleme am besten kennt und Lösungswege findet. Rogers stellt seine Überzeugung vor, dass jedes Individuum die Fähigkeit besitzt, seine eigene Problemlösung selbst zu finden.
Groddeck fasst einen von Rogers skizzierten idealtypischen Therapieablauf auf, in dem die „Grundlinien des nicht-direktiven Ansatzes“ enthalten sind. Der Therapeut soll dem Klienten auf Augenhöhe begegnen und ihm die Möglichkeit geben, eigene Einsichten und Erfahrungen zu gewinnen. Emotionale Wärme und Akzeptanz sind dabei entscheidende Einflussfaktoren.
3. Die klientenzentrierte Phase
In diesem Kapitel wird Rogers' Buch „Counseling and Psychotherapy“ weiter beleuchtet. Es wird hervorgehoben, dass Rogers' Interesse sich von der Diagnose hin zum Prozess der Beratung und Therapie verschob. Für Rogers geht es nicht um die Analyse und Diagnose, sondern viel mehr um die Therapie und das Verstehen des Individuums an Prozessen, an Hilfe zu gelangen.
Der Terminus „Beratung“ wird besonders im pädagogischen Bereich immer häufiger benutzt. Kontakte mit dem Ziel der Heilung und Wiederherstellung kann man als „Psychotherapie“ bezeichnen. Rogers verwendet die Begriffe Beratung und Therapie synonym.
Schlüsselwörter
Carl Rogers, Personenzentrierte Therapie, Nicht-direktive Beratung, Klientenzentrierte Therapie, Menschenbild, Psychotherapie, Beratung, Entwicklungsphasen, therapeutische Beziehung, Emotionsregulation, Empathie, Akzeptanz, Selbstfindung, Problemlösungsprozess, Einsicht, Verantwortungsübernahme.
- Citar trabajo
- Victoria Theis (Autor), 2015, Carl Rogers und die "drei Entwicklungsphasen". Der nicht-direktive, der klientenzentrierte und der personenzentrierte Ansatz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317315