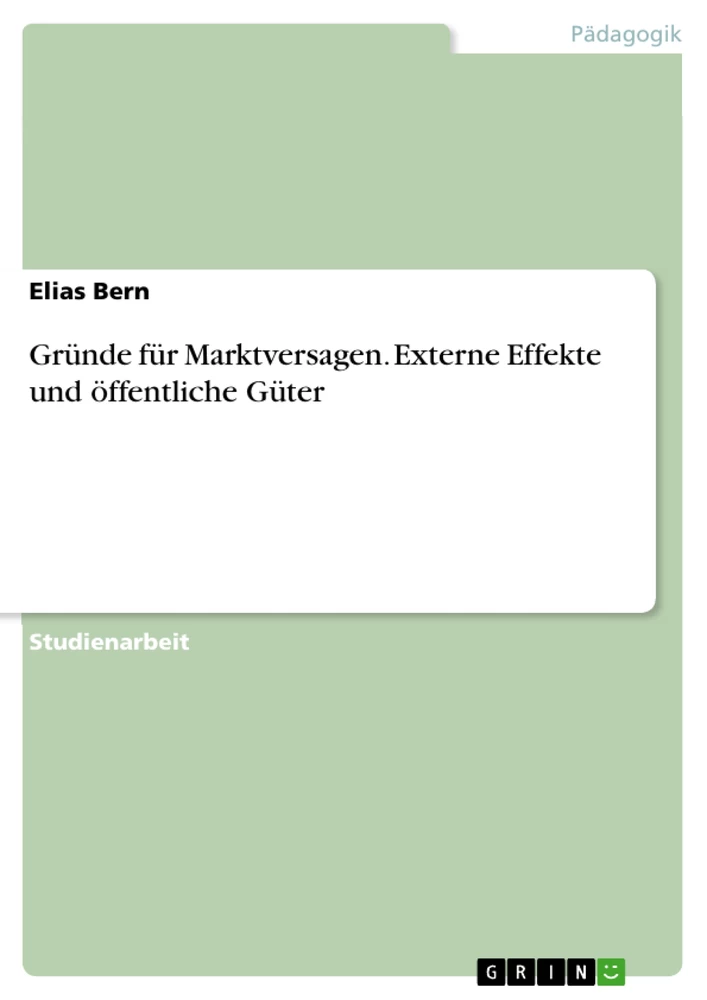Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Ausarbeitung ist die Vertiefung der externen Effekte bzw. öffentlichen Güter in Bezug auf das Marktversagen. Ein Marktversagen tritt dann auf, wenn der Markt seine Koordinationsaufgaben nicht erfüllen kann. Als Gründe für Marktversagen werden externe Effekte und das Vorliegen von spezifisch öffentlichen Gütern genannt. Externe Effekte, auch „Externalitäten“ genannt, verursachen soziale Zusatzkosten, die sich auf bestimmte Individuen nachteilig auswirken.
Ausgangspunkt ist die Frage, inwieweit wirtschaftspolitische Eingriffe eine ökonomisch optimale Situation für alle Individuen herstellen kann. Des Weiteren entstehen durch Externalitäten fehlerhafte Verteilungen bzw. „Allokationen“ im öffentlichen Güterangebot. Es muss ferner der Frage nachgegangen werden, ob verteilungsorientierte Theorien eine optimale Allokation bezwecken können.
Im ersten Kapitel werden die beiden o.a. Entstehungsgründe für Marktversagen und ihre Auswirkungen näher erläutert. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den wirtschaftspolitischen Eingriffen, die die Auswirkungen der externen Effekte reduzieren sollen. Hierbei werden nur die Internalisierungsverfahren durch Property-Rights, die Pigou-Steuer und das Coase-Theorem vorgestellt. Andere Eingriffsmöglichkeiten werden in dieser Ausarbeitung nicht berücksichtigt.
Nach einer ausführlichen Darstellung dieser Eingriffsmechanismen werden im dritten Kapitel zwei Methoden zur Lösung von Allokationsproblemen diskutiert. Im Fokus stehen hierbei die Clarke-Methode und das Samuelson-Kriterium. Ein kurzes Fazit rundet die Ausarbeitung ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehungsgründe für Marktversagen
- 2.1 Die Theorie des öffentlichen Gutes
- 2.2 Die Bedeutung von externen Effekten
- 3. Die Internalisierung von externen Effekten
- 3.1 Internalisierung durch Property-Rights
- 3.2 Die Pigou-Steuer
- 3.3 Das Coase-Theorem
- 4. Verteilungsorientierte Theorien des öffentlichen Gutes
- 4.1 Die Clarke-Methode
- 4.2 Das Samuelson-Kriterium
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung vertieft die Themen externe Effekte und öffentliche Güter im Kontext von Marktversagen. Ziel ist es, die Entstehungsgründe von Marktversagen zu untersuchen und wirtschaftspolitische Lösungsansätze zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen von externen Effekten und die Möglichkeiten ihrer Internalisierung.
- Marktversagen durch externe Effekte und öffentliche Güter
- Theorien des öffentlichen Gutes (Samuelson)
- Internalisierung externer Effekte (Property Rights, Pigou-Steuer, Coase-Theorem)
- Verteilungsorientierte Theorien (Clarke-Methode, Samuelson-Kriterium)
- Ökonomisch optimale Allokation von Ressourcen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einführende Kapitel legt den Fokus auf die Untersuchung von Marktversagen, verursacht durch externe Effekte und öffentliche Güter. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit wirtschaftspolitische Interventionen eine ökonomisch optimale Situation für alle Beteiligten herbeiführen können und wie fehlerhafte Ressourcenallokationen im Bereich öffentlicher Güter durch verteilungsorientierte Theorien behoben werden können. Die weiteren Kapitel werden kurz skizziert, wobei die Schwerpunkte auf der Erläuterung der Entstehungsgründe von Marktversagen und der Vorstellung wirtschaftspolitischer Eingriffsmöglichkeiten liegen.
2. Die Entstehungsgründe für Marktversagen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Theorie des öffentlichen Gutes nach Samuelson, wobei private und öffentliche Güter anhand der Kriterien Rivalität und Ausschließbarkeit des Konsums unterschieden werden. Es wird der Begriff des Allmendeguts erläutert und die Bedeutung des Öffentlichkeitsgrades einer Aktivität im Kontext der externen Effekte hervorgehoben. Die vier Hauptformen öffentlicher Güter, inklusive gemischter Charakterzüge, werden kategorisiert und die Problematik von Nutzungskonflikten knapper Ressourcen im Zusammenhang mit externen Effekten diskutiert. Positive und negative externe Effekte und ihre Auswirkungen auf die Kosten-Nutzen-Bilanz werden analysiert.
Schlüsselwörter
Marktversagen, externe Effekte, öffentliche Güter, Internalisierung, Property-Rights, Pigou-Steuer, Coase-Theorem, Allmendegut, Verteilungsorientierte Theorien, Clarke-Methode, Samuelson-Kriterium, ökonomische Allokation, Ressourcenallokation.
Häufig gestellte Fragen zu: Marktversagen, Öffentliche Güter und Externe Effekte
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Marktversagen, das durch externe Effekte und öffentliche Güter verursacht wird. Sie untersucht die Entstehungsgründe von Marktversagen und beleuchtet wirtschaftspolitische Lösungsansätze. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen externer Effekte und der Möglichkeiten ihrer Internalisierung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Darstellung der Entstehungsgründe von Marktversagen, die Erläuterung verschiedener Internalisierungsmethoden, verteilungsorientierte Theorien und ein Fazit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Marktversagen durch externe Effekte und öffentliche Güter; Theorien des öffentlichen Gutes (insbesondere nach Samuelson); Internalisierung externer Effekte (mittels Property Rights, Pigou-Steuer und dem Coase-Theorem); verteilungsorientierte Theorien (Clarke-Methode und Samuelson-Kriterium); sowie die ökonomisch optimale Allokation von Ressourcen.
Was sind die Hauptursachen für Marktversagen laut dieser Arbeit?
Die Arbeit identifiziert externe Effekte und die Eigenschaften öffentlicher Güter als Hauptursachen für Marktversagen. Es wird detailliert auf die Theorie öffentlicher Güter nach Samuelson eingegangen, wobei private und öffentliche Güter anhand von Rivalität und Ausschließbarkeit im Konsum unterschieden werden. Die Bedeutung von Allmendegütern und die Auswirkungen positiver und negativer externer Effekte auf die Kosten-Nutzen-Bilanz werden analysiert.
Welche Lösungsansätze zur Internalisierung externer Effekte werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Lösungsansätze zur Internalisierung externer Effekte, darunter: die Internalisierung durch Property Rights; die Pigou-Steuer; und das Coase-Theorem. Diese Methoden werden im Detail erläutert und ihre Vor- und Nachteile werden implizit oder explizit diskutiert.
Welche verteilungsorientierten Theorien werden behandelt?
Im Bereich der verteilungsorientierten Theorien werden die Clarke-Methode und das Samuelson-Kriterium vorgestellt und erklärt. Diese Theorien zielen darauf ab, fehlerhafte Ressourcenallokationen im Bereich öffentlicher Güter zu beheben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Marktversagen, externe Effekte, öffentliche Güter, Internalisierung, Property-Rights, Pigou-Steuer, Coase-Theorem, Allmendegut, verteilungsorientierte Theorien, Clarke-Methode, Samuelson-Kriterium, ökonomische Allokation, Ressourcenallokation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die die Fragestellung und die Struktur der Arbeit umreißt. Es folgen Kapitel, die sich mit den Entstehungsgründen von Marktversagen, der Internalisierung externer Effekte und verteilungsorientierten Theorien befassen. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
- Quote paper
- Elias Bern (Author), 2010, Gründe für Marktversagen. Externe Effekte und öffentliche Güter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317552