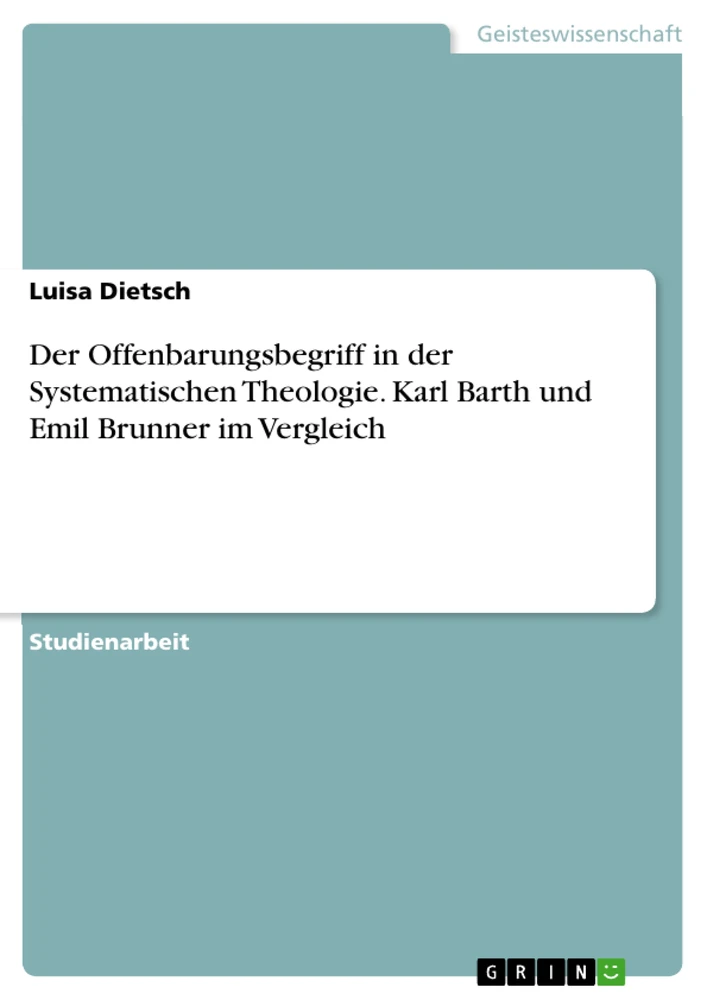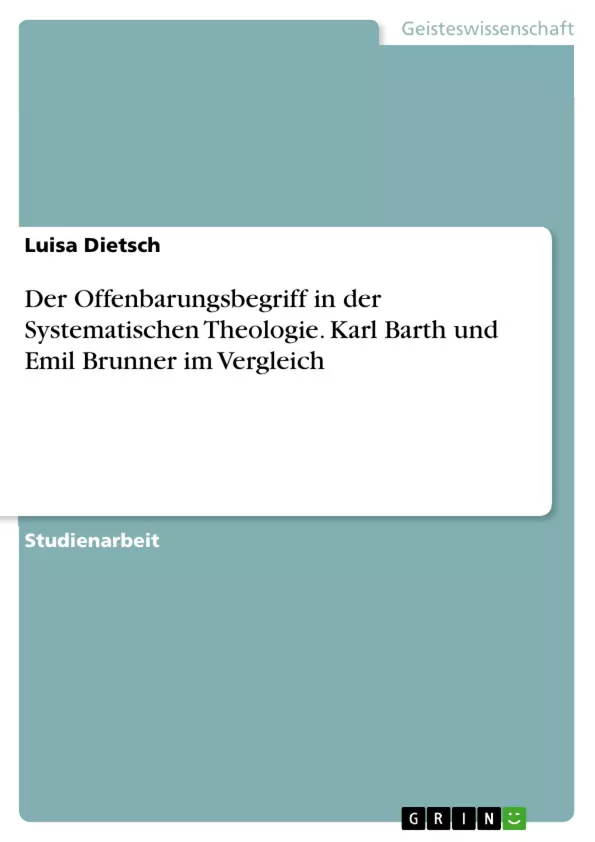In dieser Arbeit werden die Theologen Karl Barth und Emil Brunner kurz vorgestellt und im Anschluss auf ihren Offenbarungsbegriff hin verglichen.
Die „Systematische Theologie“ ist einer der vier wichtigen Teilbereiche der Theologie. In ihr geht es um die Lehre und die Ethik, sowie um das Verhältnis zu anderen Religionen und die wissenschaftstheoretischen Grundlagen. Grundlegendes Thema der Systematischen Theologie ist die Offenbarung.
Zunächst möchte ich den allgemeinen Wortsinn des Offenbarungsbegriffes erläutern: Etwas offenbaren kommt aus dem lateinischen und bedeutet so viel wie etwas Verhülltes aufdecken (Praktisches Bibel Lexikon, S. 826), also etwas offenlegen. Wenn ein Mensch einem anderen etwas offenbart, so ist damit nach dem allgemeinen Verständnis gemeint, dass er ihm ein Geheimnis erzählt. Die Offenbarung im theologischen Sinn ist die Selbsterschließung Gottes, wobei Gott sowohl Sender als auch Inhalt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung des Themas
- Hintergrundinformationen zu Karl Barth
- Hintergrundinformationen zu Emil Brunner
- Die Position von Emil Brunner
- Vergleich der Positionen von Karl Barth und Emil Brunner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den theologischen Positionen von Karl Barth und Emil Brunner und untersucht deren Offenbarungsverständnis, die Rolle von Jesus Christus und weitere Stärken ihrer jeweiligen Positionen. Ziel ist es, die Positionen kritisch zu hinterfragen, einen Vergleich zu erarbeiten und zu beurteilen, ob Karl Barth tatsächlich den stärkeren Standpunkt entwickelt hat. Außerdem wird untersucht, wie sich zunächst so ähnliche Haltungen in so unterschiedliche Richtungen entwickeln konnten.
- Offenbarungstheorie und deren Bedeutung
- Die Rolle von Jesus Christus in der Theologie
- Vergleich der Positionen von Karl Barth und Emil Brunner
- Die Entwicklung unterschiedlicher theologischer Ansätze
- Bewertung der Stärken der jeweiligen Positionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Positionen von Karl Barth und Emil Brunner im Kontext des Seminars „Proseminar Systematische Theologie“ vor. Die Arbeit soll eine kritische Auseinandersetzung mit den Positionen beider Theologen liefern, indem sie deren Hintergrund, theologische Ansichten und einen Vergleich der Positionen erarbeitet. Die Einleitung hebt auch die Bedeutung der Offenbarung für die systematische Theologie und die Besonderheiten der beiden Theologen hervor.
Darstellung des Themas
Dieser Abschnitt erläutert den Begriff der Offenbarung in theologischer Hinsicht, wobei zwischen der allgemeinen und der besonderen Offenbarung unterschieden wird. Der Text beleuchtet die verschiedenen Arten der Offenbarung und ihre Merkmale, wie zum Beispiel den Offenbarungsurheber, den Offenbarungsmittler, den Offenbarungsinhalt und die Offenbarungsvermittlung. Zudem wird der Zusammenhang zwischen Offenbarung und Gotteserkenntnis betrachtet.
Hintergrundinformationen zu Karl Barth
Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über Leben und Werk von Karl Barth. Er beschreibt Barth als einen der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts, der sich insbesondere mit dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch auseinandersetzte. Der Text erwähnt seinen Kommentar zum Römerbrief, in dem Barth den Graben zwischen Gott und Mensch herausarbeitete, sowie seine Zugehörigkeit zur „Theologie der Krise“ oder „Dialektischen Theologie“.
Schlüsselwörter
Diese Hausarbeit fokussiert sich auf die theologischen Positionen von Karl Barth und Emil Brunner, insbesondere im Hinblick auf ihre Offenbarungstheorien, ihre Vorstellung von Jesus Christus und die Entwicklung ihrer jeweiligen Positionen. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Offenbarung, Gotteserkenntnis, Systematische Theologie, Karl Barth, Emil Brunner, Dialektische Theologie, Theologie der Krise, Jesus Christus, Vergleich, theologische Positionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen allgemeiner und besonderer Offenbarung?
Allgemeine Offenbarung bezieht sich auf die Erkenntnis Gottes durch die Natur oder Vernunft. Besondere Offenbarung ist die spezifische Selbsterschließung Gottes, im christlichen Kontext primär in Jesus Christus.
Wie unterscheiden sich die Positionen von Karl Barth und Emil Brunner?
Barth vertrat eine radikale Position, die jede natürliche Gotteserkenntnis ablehnte und Offenbarung allein in Christus sah. Brunner hingegen räumte dem Menschen eine gewisse „Anknüpfungsmöglichkeit“ für das Wort Gottes ein.
Was versteht man unter „Dialektischer Theologie“?
Es ist eine theologische Strömung des 20. Jahrhunderts (auch „Theologie der Krise“), die den unendlichen qualitativen Unterschied zwischen Gott und Mensch betont und sich gegen die liberale Theologie richtet.
Welche Bedeutung hat Jesus Christus für Karl Barths Offenbarungsbegriff?
Für Barth ist Jesus Christus die einzige und vollkommene Offenbarung Gottes. Außerhalb von Christus gibt es für Barth keine wahre Gotteserkenntnis.
Was bedeutet der Begriff „Offenbarung“ im theologischen Sinn allgemein?
Theologisch ist Offenbarung die Selbsterschließung Gottes gegenüber dem Menschen, wobei Gott gleichzeitig der Sender, der Mittler und der Inhalt der Botschaft ist.
Warum ist der Vergleich zwischen Barth und Brunner heute noch relevant?
Der Streit markiert eine Grundsatzentscheidung in der protestantischen Theologie über das Verhältnis von Glaube, Vernunft und der Möglichkeit des Menschen, Gott zu begegnen.
- Arbeit zitieren
- Luisa Dietsch (Autor:in), 2014, Der Offenbarungsbegriff in der Systematischen Theologie. Karl Barth und Emil Brunner im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317607