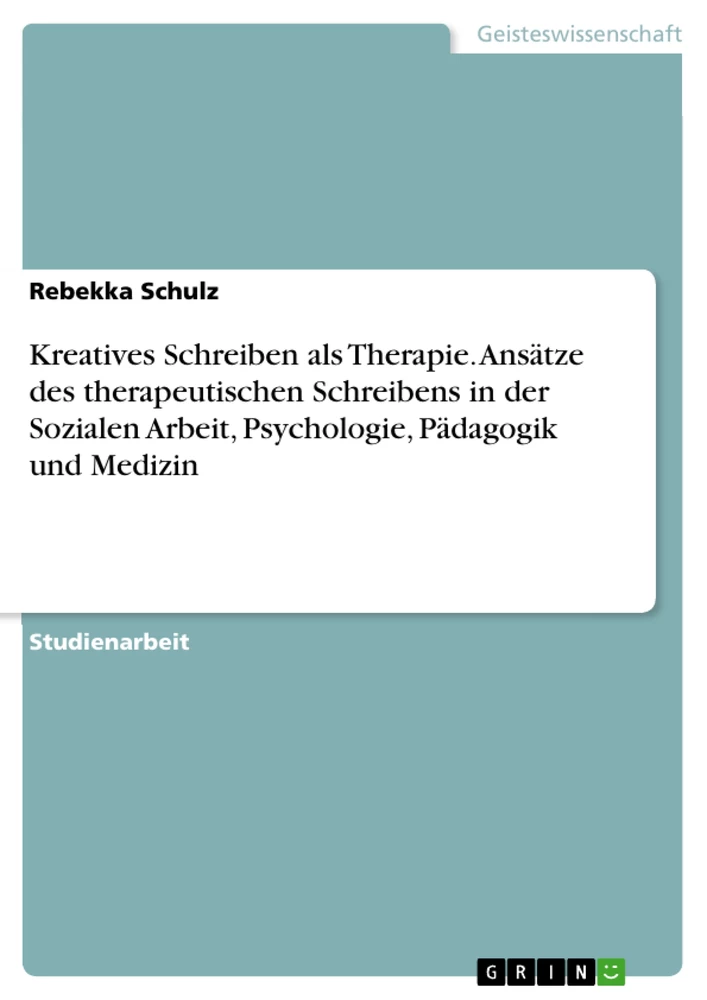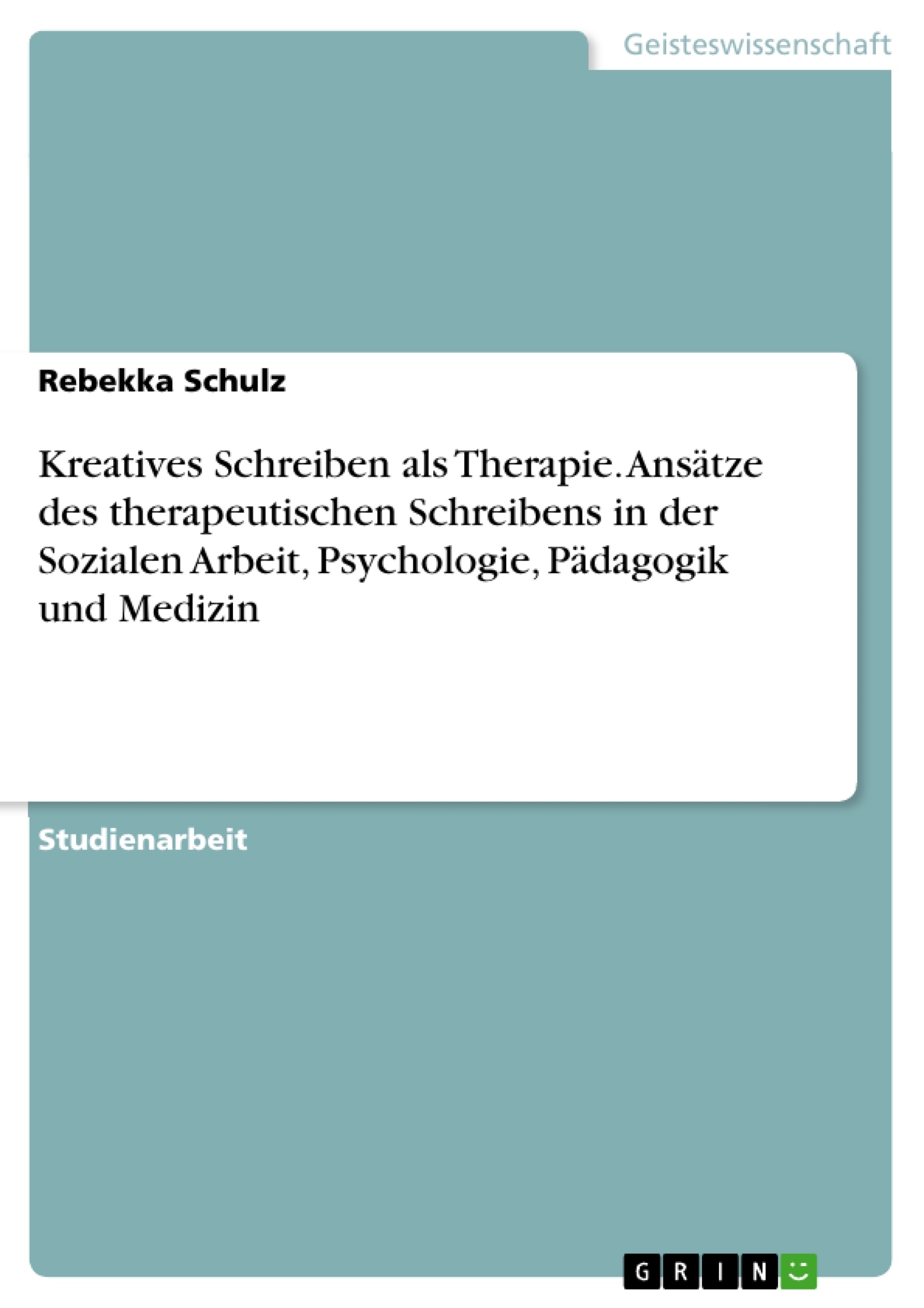Viele moderne therapeutische und pädagogische Ansätze befassen sich mit der Form des Kreativen Schreibens, trotzdem handelt es sich gerade in Deutschland immer noch um ein eher unbekanntes Terrain. Die vorliegende Arbeit soll einige Ansätze des therapeutischen Schreibens in der Sozialen Arbeit, Psychologie, Pädagogik und Medizin beschreiben, verdeutlichen und gegenüberstellen.
Ist therapeutisches Schreiben immer gleich oder gibt es auch hier verschiedene Facetten? Inwiefern unterscheiden sich die Methoden in den verschiedenen Feldern und wo liegen die Gemeinsamkeiten?
Als Hauptquelle dieser Arbeit dient das Arbeitsbuch von Silke Heimes, „Kreatives und therapeutisches Schreiben – Ein Arbeitsbuch“, das im Jahr 2008 im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erschien. Dieses Buch basiert auf der persönlichen Erfahrung der Autorin, die unter anderem selbst als Poesietherapeutin arbeitet und sich daher intensiv mit dem Thema des therapeutischen Kreativen Schreibens befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen therapeutischer Schreibschulen
- Definition Kreatives Schreiben und Poesietherapie
- Definition autobiografisches Schreiben
- Anwendungsgebiete des Kreativen Schreibens als Therapie
- Überblick über die Anwendungsgebiete
- Therapeutisches Schreiben als Selbstanalyse
- Therapeutisches Schreiben in der Gerontologie
- Therapeutisches Schreiben in der Sterbebegleitung
- Therapeutisches Schreiben bei somatischen Krankheiten
- Therapeutisches Schreiben in der Psychologie und Psychotherapie
- Therapeutisches Schreiben im Justizvollzug
- Therapeutisches Schreiben in weiteren Bereichen
- Fazit und Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vielseitigen Anwendungsgebiete des kreativen Schreibens als Therapieform. Sie beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Methoden in unterschiedlichen Bereichen wie Sozialer Arbeit, Psychologie, Pädagogik und Medizin. Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Bild der therapeutischen Anwendung des kreativen Schreibens zu liefern.
- Definition und Abgrenzung verschiedener therapeutischer Schreibformen (Kreatives Schreiben, Poesietherapie, autobiografisches Schreiben)
- Vielfältige Anwendungsgebiete des therapeutischen Schreibens in verschiedenen Kontexten
- Analyse der Wirkungsweise des therapeutischen Schreibens auf die psychische und physische Gesundheit
- Vergleich verschiedener Methoden und Ansätze des therapeutischen Schreibens
- Bewertung des Potenzials und der Grenzen des therapeutischen Schreibens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des therapeutischen Schreibens ein und hebt dessen Vielseitigkeit und den Bedarf an einer umfassenden Darstellung hervor. Die Autorin beschreibt ihre persönliche Motivation und den Fokus der Arbeit auf die Darstellung und den Vergleich verschiedener Ansätze des therapeutischen Schreibens in verschiedenen Bereichen, unter Verwendung des Arbeitsbuchs von Silke Heimes als Hauptquelle.
Definitionen therapeutischer Schreibschulen: Dieses Kapitel definiert und differenziert zwischen kreativem Schreiben und Poesietherapie, wobei die Überschneidungen und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Abgrenzung herausgestellt werden. Es wird auf die unterschiedlichen Zielsetzungen eingegangen: Selbstausdruck und Selbstfindung beim kreativen Schreiben versus Selbsterforschung und Selbstreflexion in der Poesietherapie. Das autobiografische Schreiben wird als eine weitere, eng verwandte Methode vorgestellt, die sich auf die Aufarbeitung vergangener Erlebnisse konzentriert.
Anwendungsgebiete des Kreativen Schreibens als Therapie: Dieses Kapitel präsentiert einen breiten Überblick über die Anwendungsbereiche des therapeutischen Schreibens. Es wird die große Popularität von kreativen Schreibkursen hervorgehoben und die Gründe dafür erläutert. Es werden verschiedene Bereiche genannt, in denen therapeutisches Schreiben eingesetzt wird, darunter psychiatrische, neurotische und somatische Erkrankungen, Krisenintervention, Prävention und Psychohygiene. Die Anwendung in Gerontologie, Sterbebegleitung, im Justizvollzug sowie in der Psychologie und Psychotherapie wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Kreatives Schreiben, Poesietherapie, autobiografisches Schreiben, therapeutisches Schreiben, Selbstanalyse, Selbstreflexion, Gerontologie, Sterbebegleitung, somatische Krankheiten, Psychologie, Psychotherapie, Justizvollzug, Selbstfindung, Selbstausdruck, Heilpraktiker.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Therapeutisches Schreiben
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über therapeutisches Schreiben. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition und Abgrenzung verschiedener therapeutischer Schreibformen (kreatives Schreiben, Poesietherapie, autobiografisches Schreiben) sowie deren vielseitigen Anwendungsgebiete in verschiedenen Kontexten (z.B. Gerontologie, Sterbebegleitung, Justizvollzug, Psychologie).
Welche therapeutischen Schreibformen werden behandelt?
Das Dokument behandelt kreatives Schreiben, Poesietherapie und autobiografisches Schreiben. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Methoden, ihre Zielsetzungen (Selbstausdruck, Selbstfindung, Selbsterforschung, Selbstreflexion) und ihre Anwendung in therapeutischen Kontexten erläutert.
In welchen Bereichen wird therapeutisches Schreiben angewendet?
Therapeutisches Schreiben findet Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Gerontologie, Sterbebegleitung, bei somatischen Krankheiten, in der Psychologie und Psychotherapie, im Justizvollzug und weiteren Bereichen. Das Dokument hebt die breite Popularität von kreativen Schreibkursen hervor und erläutert die Gründe dafür.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der therapeutischen Anwendung des kreativen Schreibens zu liefern. Sie untersucht die vielseitigen Anwendungsgebiete, beleuchtet Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Methoden und analysiert deren Wirkungsweise auf die psychische und physische Gesundheit. Ein Vergleich verschiedener Methoden und Ansätze sowie eine Bewertung des Potenzials und der Grenzen des therapeutischen Schreibens werden ebenfalls vorgenommen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kreatives Schreiben, Poesietherapie, autobiografisches Schreiben, therapeutisches Schreiben, Selbstanalyse, Selbstreflexion, Gerontologie, Sterbebegleitung, somatische Krankheiten, Psychologie, Psychotherapie, Justizvollzug, Selbstfindung, Selbstausdruck, Heilpraktiker.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Definitionen therapeutischer Schreibschulen, Anwendungsgebiete des kreativen Schreibens als Therapie und Fazit/Stellungnahme. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Welche Quelle wird hauptsächlich verwendet?
Das Dokument nennt das Arbeitsbuch von Silke Heimes als Hauptquelle.
- Arbeit zitieren
- Rebekka Schulz (Autor:in), 2012, Kreatives Schreiben als Therapie. Ansätze des therapeutischen Schreibens in der Sozialen Arbeit, Psychologie, Pädagogik und Medizin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317664