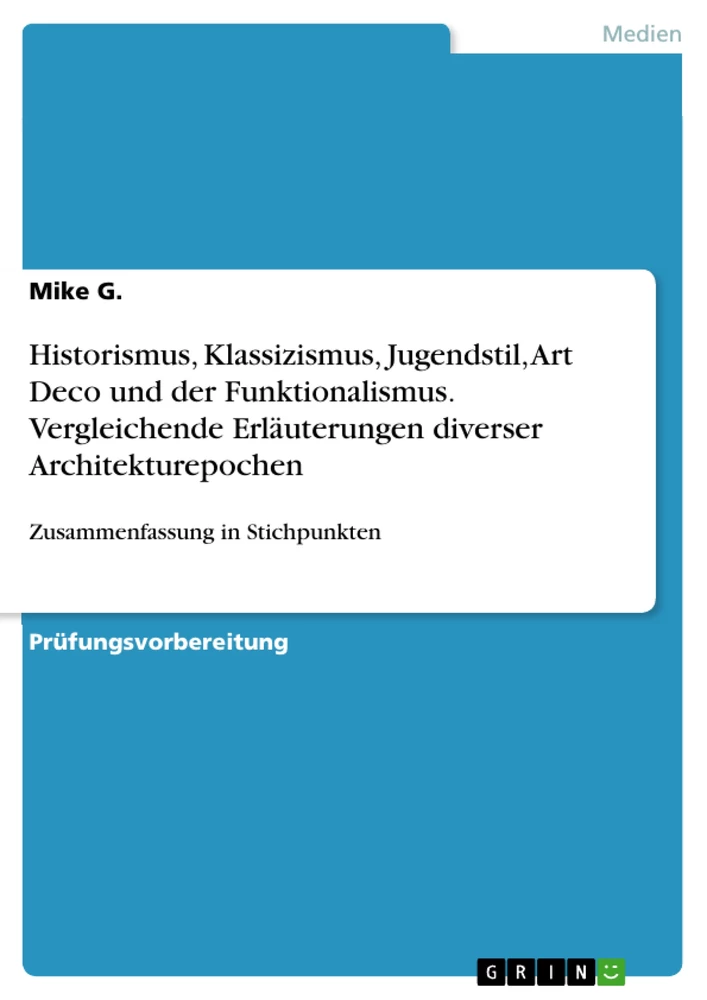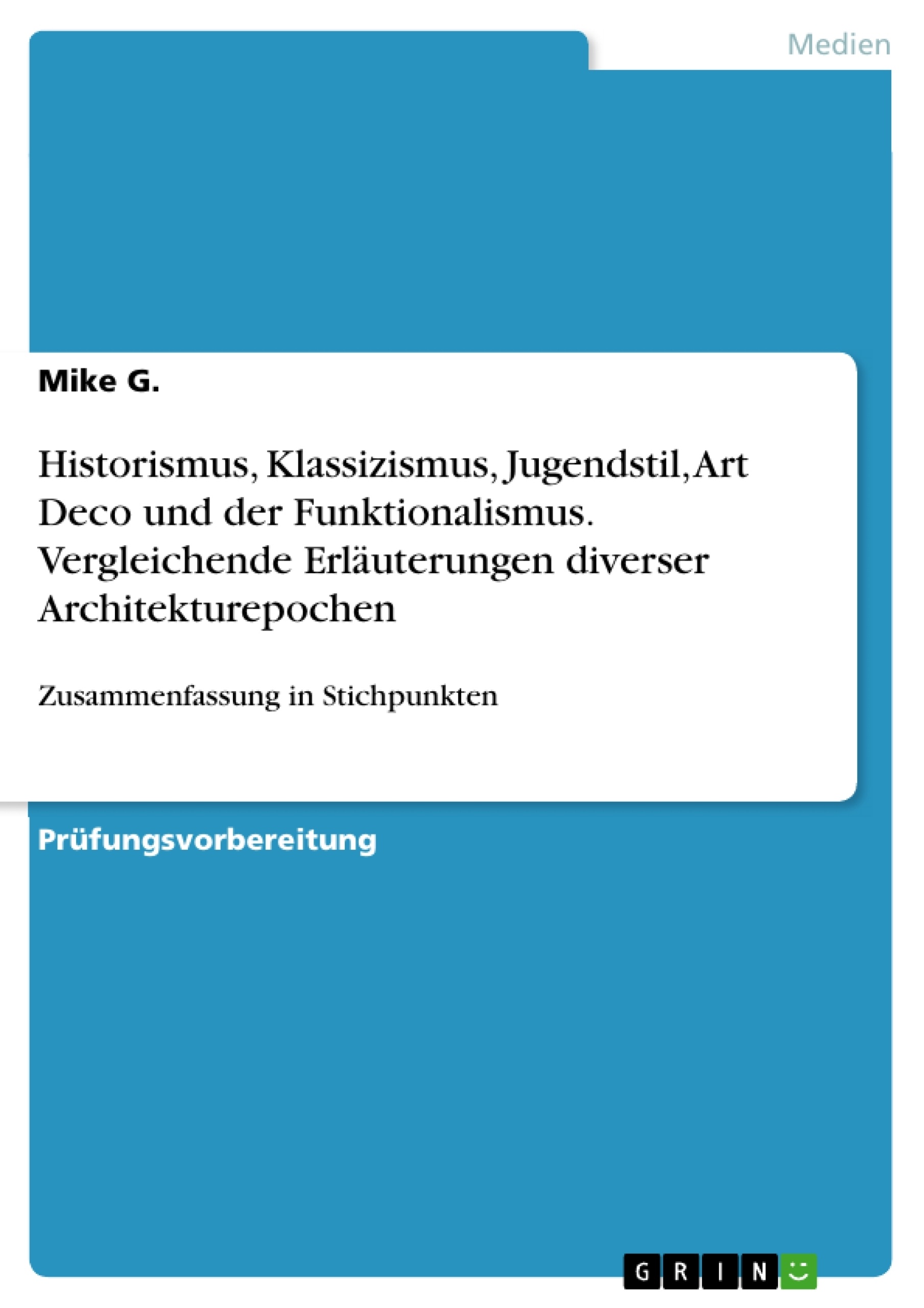Diese Zusammenfassung bzw. Gegenüberstellung verschiedener Architekturepochen ist im Zusammenhang mit einer BK – Klausur im Schuljahr 12/2 entstanden. Hierbei werden die Epochen des Historismus, Klassizismus, Jugendstil, Art Deco und des modernen Bauens miteinander verglichen, näher ausgeführt und anhand von (bekannten) Beispielen (z.B. Eiffelturm) erläutert. Am Ende findet sich eine Gegenüberstellung der wichtigsten Merkmale der einzelnen Epochen, welche hervorragend als Prüfungsvorbereitung genutzt werden kann. Ganz zu Beginn werden zwei bekannte Betrachtungsweisen / Analysevorgänge der bildenden Kunst näher dargestellt, der hermeneutische und semiotische Ansatz.
Inhaltsverzeichnis
- Betrachtungsweisen in der bildenden Kunst
- Semiotischer Ansatz
- Hermeneutischer Ansatz
- Architekturepochen
- Historismus (1750 – 1910)
- Eiffelturm
- Opernhaus in Paris
- Opernhaus in Dresden
- Bahnhof St. Pancras in London
- Klassizismus (1770-1840)
- Brandenburger Tor
- Kirche Ste. Madeleine
- Jugendstil (1890 – 1915)
- Haus und Büro vom Architekten Horta
- Art Deco (1920 - 1930)
- Chrysler Building
- Moderne Architektur (1920 - 1970)
- Meisterhäuser in Dessau
- Referat: Meisterhäuser von Gropius in Dessau (HandOut)
- Bauhaus in Weimar
- Informationen zum Thema „Wohnungsbau für die moderne Gesellschaft.“
- Falling Water
- Meisterhäuser in Dessau
- Historismus (1750 – 1910)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Zusammenfassung befasst sich mit verschiedenen Architekturepochen und deren charakteristischen Merkmalen. Ziel ist es, einen Überblick über die Entwicklung der Architektur von der Zeit des Historismus bis zur Moderne zu geben und dabei die wichtigsten Stile und ihre Besonderheiten aufzuzeigen. Dabei werden bekannte Beispiele aus der Architekturgeschichte herangezogen, um die theoretischen Ausführungen zu veranschaulichen.
- Die Bedeutung von Geschichte und Tradition in der Architektur
- Der Einfluss von politischer und gesellschaftlicher Entwicklung auf die Architektur
- Die Rolle von Materialien und Techniken in der Gestaltung von Gebäuden
- Die Verbindung von Funktionalität und Ästhetik in der Architektur
- Die Bedeutung von Ornamenten und Symbolen in der Architektur
Zusammenfassung der Kapitel
Betrachtungsweisen in der bildenden Kunst
Der Abschnitt beleuchtet zwei wichtige Ansätze in der Analyse von Kunstwerken: den semiotischen und den hermeneutischen Ansatz. Der semiotische Ansatz konzentriert sich auf die Zeichenhaftigkeit von Bildern und deren Interpretation, während der hermeneutische Ansatz eine umfassende Interpretation des Kunstwerks im Kontext seiner Entstehung und Wirkung anstrebt.
Architekturepoche: Historismus (1750 – 1910)
Der Historismus zeichnet sich durch eine bewusste Rückbesinnung auf historische Stile aus. Die Architektur dieser Zeit greift Elemente aus verschiedenen Epochen auf und kombiniert sie zu neuen Formen. Der Eiffelturm, das Opernhaus in Paris und das Opernhaus in Dresden sind Beispiele für den Historismus. Auch Bahnhöfe wie der St. Pancras in London zeigen die typischen Merkmale dieser Epoche.
Architekturepoche: Klassizismus (1770-1840)
Der Klassizismus orientiert sich an der klassischen Antike und zeichnet sich durch strenge Symmetrie, klare Formen und eine Anlehnung an die italienische Frührenaissance aus. Das Brandenburger Tor und die Kirche Ste. Madeleine sind Beispiele für den Klassizismus in der Architektur.
Architekturepoche: Jugendstil (1890 – 1915)
Der Jugendstil entstand als Gegenbewegung zum Historismus und zur industriellen Massenproduktion. Er zeichnet sich durch organische Formen, Pflanzenmotive und eine Betonung von Materialästhetik aus. Das Haus und Büro vom Architekten Horta ist ein Beispiel für den Jugendstil.
Schlüsselwörter
Historismus, Klassizismus, Jugendstil, Art Deco, Moderne Architektur, Eiffelturm, Brandenburger Tor, Opernhaus, Bahnhof, Semiotik, Hermeneutik, Ornament, Symbol, Materialästhetik, Funktionalität, Ästhetik
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet die Architektur des Historismus?
Der Historismus (1750–1910) greift auf vergangene Stile zurück und kombiniert diese neu, wie beim Eiffelturm oder dem Pariser Opernhaus zu sehen ist.
Wodurch zeichnet sich der Klassizismus aus?
Der Klassizismus (1770–1840) orientiert sich an der Antike mit strenger Symmetrie und klaren Formen, beispielhaft am Brandenburger Tor.
Was ist das Hauptmerkmal des Jugendstils?
Der Jugendstil (1890–1915) nutzt organische Formen und Pflanzenmotive als Gegenbewegung zur industriellen Massenproduktion.
Was versteht man unter dem semiotischen Ansatz in der Kunst?
Dieser Ansatz betrachtet Kunstwerke als Systeme von Zeichen, die interpretiert und entschlüsselt werden müssen.
Welche Bedeutung hat das Bauhaus für die moderne Architektur?
Das Bauhaus steht für funktionales Bauen, die Verbindung von Kunst und Handwerk und den Verzicht auf unnötige Ornamente.
Was sind Beispiele für Art Deco Architektur?
Ein berühmtes Beispiel für den Art Deco Stil (1920–1930) ist das Chrysler Building in New York.
- Quote paper
- Mike G. (Author), 2015, Historismus, Klassizismus, Jugendstil, Art Deco und der Funktionalismus. Vergleichende Erläuterungen diverser Architekturepochen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317678