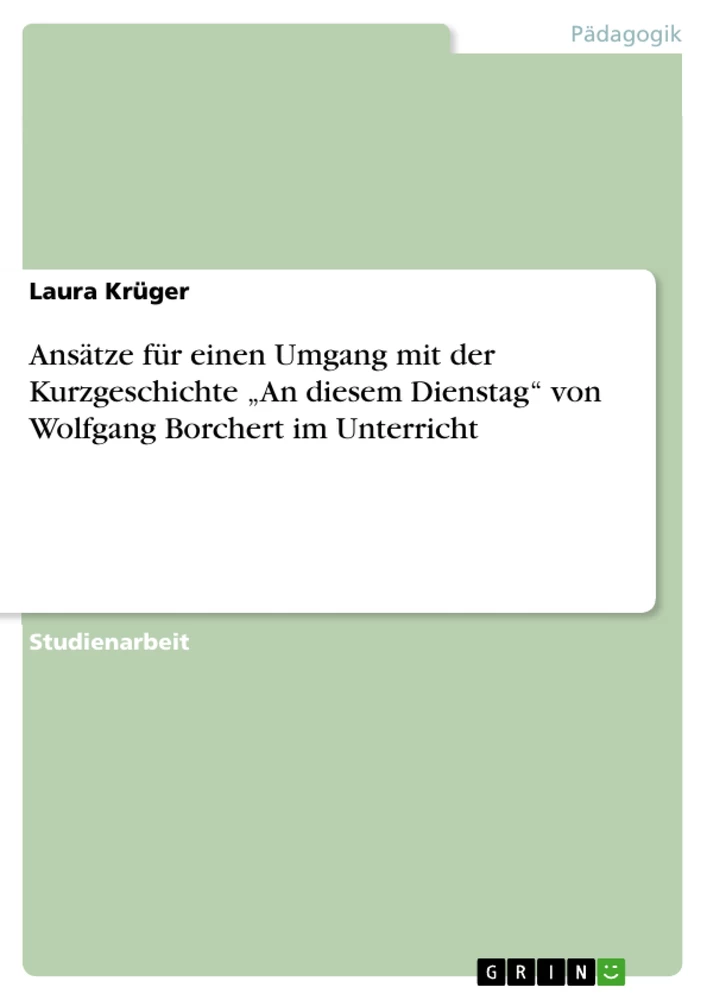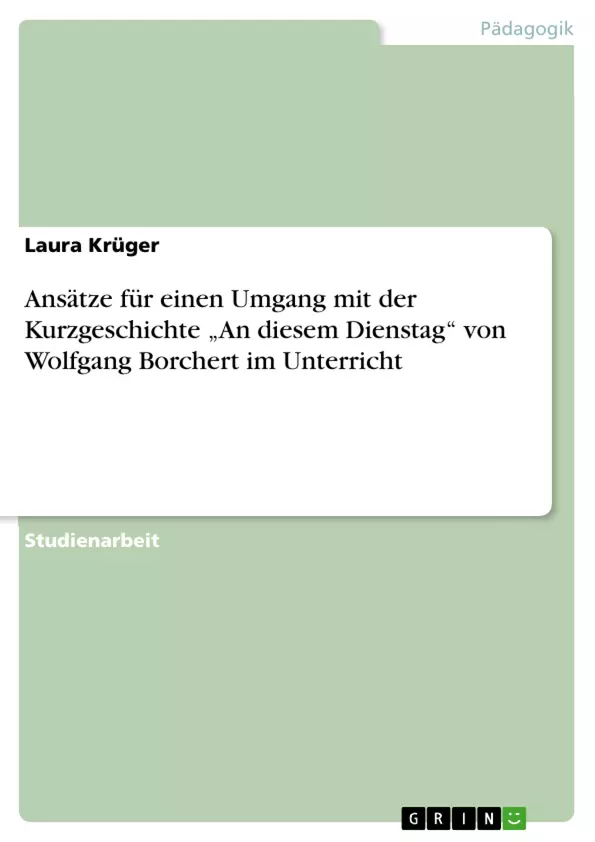Um eindringlich auf Konzepte und Methoden für die Literaturinterpretation des hier ausgewählten Werkes "An diesem Dienstag" von Wolfgang Borchert eingehen zu können, ist es vorab nötig eine Sachanalyse durchzuführen. Hierfür ist im Folgenden kurz das Leben von Wolfgang Borchert skizziert, sowie sein literarisches Wirken dargestellt. Dieses Wirken steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Gattung der Kurzgeschichte, weshalb auch diese hier ausreichend erläutert werden soll. Abschließend soll ein kurzer Überblick über die ausgewählte Kurzgeschichte Borcherts „An diesem Dienstag“ gegeben werden.
Im Zuge dieser Ausarbeitung steht vor allem die Texterschließungskompetenz im Mittelpunkt. Den Sinn eines Textes zu entnehmen, beziehungsweise einen Text verstehen zu können, ist eine zentrale Aufgabe von jeder schulischen Beschäftigung mit einem Text. Häufig kommt es im schulischen Alltag bedauerlicherweise dazu, dass das Verfolgen dieser Zielebene dazu führt, dass die Texterschließung zu einer Suchaufgabe degradiert wird und wenig auf sinnvolle unterrichtliche Textanschlusshandlungen geachtet wird. Einen Text zu erschließen heißt nicht nur die zentralen Textelemente zu erkennen, sondern auch ihn zu deuten, oder sogar weiterführend, ihn mit der Wirklichkeit in Bezug zu setzen.
In Anlehnung an die Ziele von Spinner, sollte hier auch das klassische „Drei-Säulen-Modell“ nicht unerwähnt bleiben. Die Ziele des Literaturunterrichts werden im sogenannten „Drei-Säulen-Modell“ unter Textverstehen, Wissen über Literatur und ihre Kontexte, sowie der Lesefreude beziehungsweise Lesemotivation zusammengefasst. Die Literaturinterpretation ist hier unter dem Begriff „Textverstehen“ gefasst, der neben Erkennen von Textelementen und ihren Zusammenhängen, auch die Deutung selbst als ein zentrales Ziel beinhaltet. Die zunehmend größer werdende Rolle der Kompetenzorientierung im Unterricht allgemein und ebenso im Literaturunterricht führt zu einer Unverträglichkeit mit den über viele Jahre als normativ geltenden Zielen des Literaturunterrichts. Im Mittelpunkt dieser normativen Ziele des Literaturunterrichts stehen primär Lesefreude und Lesemotivation, sowie das Wissen über Literatur und ihre Kontexte. Das Textverstehen als explizites Ziel spielte hier bislang keine Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in den aktuellen Diskurs über Ziele des Literaturunterrichts und die Rolle der Literaturinterpretation
- Gegenstandsorientierte Betrachtung - Wolfgang Borchert: „An diesem Dienstag“
- Das Leben von Wolfgang Borchert
- Das literarische Wirken von Wolfgang Borchert / Die Gattung der Kurzgeschichte
- Ausgewählte Kurzgeschichte Wolfgang Borcherts :,,An diesem Dienstag“.
- Didaktische Überlegungen - Potentiale der Kurzgeschichte „An diesem Dienstag“
- Didaktische Begründung - Methoden und Konzepte zum Umgang mit der Kurzgeschichte im Literaturunterricht
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Online- Verzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Literaturinterpretation im Deutschunterricht. Sie analysiert die Ziele des Literaturunterrichts, insbesondere im Hinblick auf die Texterschließungskompetenz, und untersucht die Rolle der Literaturinterpretation im Kontext des „Drei-Säulen-Modells“. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Ebenen des Textverstehens, von der objektiven Bedeutungsebene bis hin zur subjektiven Deutung, und setzt diese Erkenntnisse in Bezug zu den Konzepten der Psychoanalytischen Literaturwissenschaft. Schließlich wird ein konkretes Beispiel, die Kurzgeschichte „An diesem Dienstag“ von Wolfgang Borchert, herangezogen, um die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in der Unterrichtspraxis zu demonstrieren.
- Ziele des Literaturunterrichts und Texterschließungskompetenz
- Rolle der Literaturinterpretation im „Drei-Säulen-Modell“
- Ebenen des Textverstehens: Objektive Bedeutung und subjektive Deutung
- Psychoanalytische Literaturwissenschaft und Textrezeption
- Didaktische Konzepte und Methoden für die Literaturinterpretation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in den aktuellen Diskurs über die Ziele des Literaturunterrichts und die Rolle der Literaturinterpretation. Es werden verschiedene Zielsetzungen des Literaturunterrichts, wie z.B. die Förderung der Lesefreude, die literarische Bildung und die Texterschließungskompetenz, vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Texterschließungskompetenz und ihrer Bedeutung im schulischen Kontext. Es werden verschiedene Modelle zur Zielsetzung des Literaturunterrichts, wie das „Drei-Säulen-Modell“, beleuchtet und die Bedeutung der Kompetenzorientierung im heutigen Unterricht diskutiert.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel bietet eine gegenstandsorientierte Betrachtung der Kurzgeschichte „An diesem Dienstag“ von Wolfgang Borchert. Es werden zunächst das Leben und das literarische Wirken von Wolfgang Borchert sowie die Gattung der Kurzgeschichte vorgestellt. Anschließend wird die Kurzgeschichte „An diesem Dienstag“ in ihren zentralen Aspekten zusammengefasst.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel widmet sich den didaktischen Überlegungen zum Einsatz der Kurzgeschichte „An diesem Dienstag“ im Unterricht. Es werden die Potentiale der Kurzgeschichte für den Literaturunterricht aufgezeigt und verschiedene didaktische Ansätze für die Arbeit mit dem Text vorgestellt.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Begründung für die Anwendung bestimmter Methoden und Konzepte zum Umgang mit der Kurzgeschichte im Literaturunterricht. Es werden verschiedene Methoden und Konzepte vorgestellt, die sich für die Interpretation und Analyse der Kurzgeschichte eignen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Literaturinterpretation, Texterschließungskompetenz, Ziele des Literaturunterrichts, „Drei-Säulen-Modell“, Psychoanalytische Literaturwissenschaft, Kurzgeschichte, Wolfgang Borchert, „An diesem Dienstag“ und didaktische Methoden.
- Quote paper
- Laura Krüger (Author), 2013, Ansätze für einen Umgang mit der Kurzgeschichte „An diesem Dienstag“ von Wolfgang Borchert im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317764