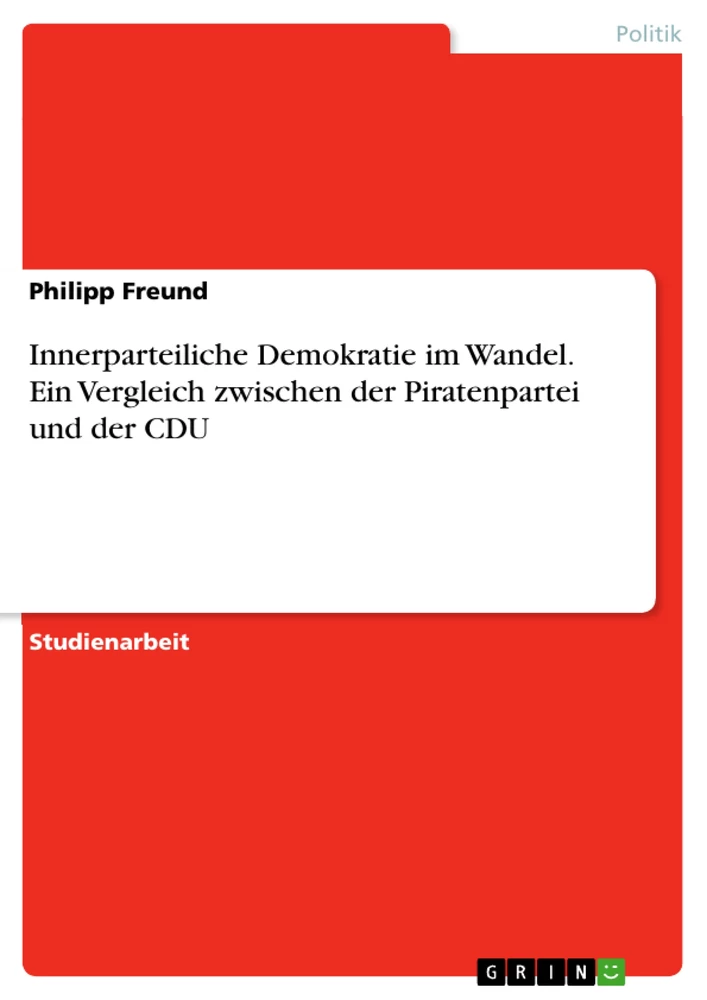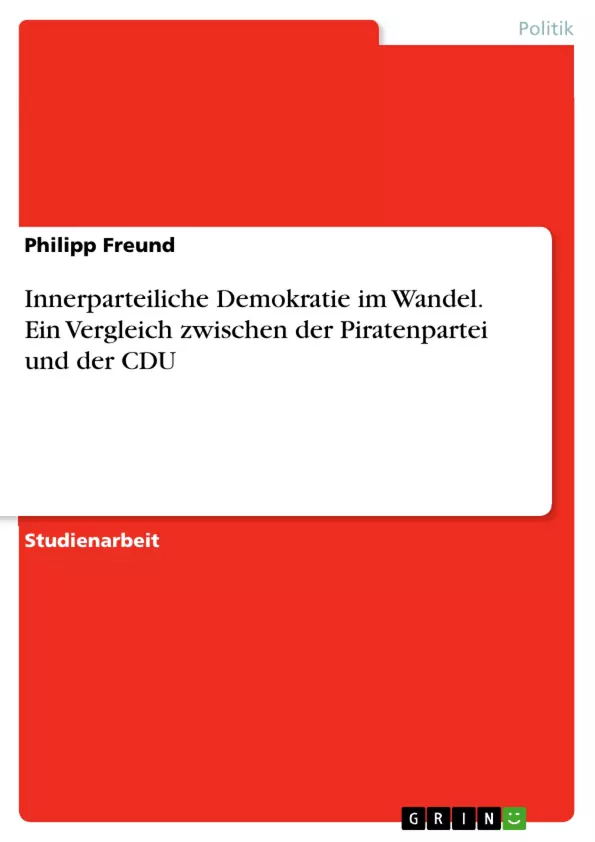In wie weit sollten Bundesparteien den Trend der direkten Demokratie mitgehen, vor allem um keine Wähler, respektive keine Glaubwürdigkeit zu verlieren? Die Piratenpartei hat einen interessanten Ansatz gefunden, welcher im Hauptteil der Arbeit erläutert werden wird. Hierbei ist es für diese Seminararbeit von besonderer Wichtigkeit, eine traditionelle Volkspartei mit ihren ebenso traditionellen Strukturen und hierarchischen Gliederungen mit der neuartigen »Partei der direkten Demokratie« zu vergleichen, da nur durch eine vergleichende Gegenüberstellung der beiden Parteiensysteme die Beantwortung bzw. Bearbeitung der oben erläuterten Frage möglich ist, ob traditionelle Parteien diesen Trend der direkten Demokratie überhaupt mitgehen könnten und sollten.
Es leitet sich hieraus das Forschungsthema »Innerparteiliche Demokratie im Wandel – Ein Vergleich zwischen der Piratenpartei und der CDU« ab, wobei die These vertreten werden soll, dass die Piratenpartei zwar durch ihre modernen Partizipationsmöglichkeiten den Zahn der Zeit getroffen hat, indem sie nicht nur Parteimitglieder zu aktivieren weiß, sondern auch innerparteiliche Veränderungen hervorruft. Nichts desto trotz ist das teils vorbildliche System der Piraten nicht auf Bundesebene umsetzbar, da es mehrere mit dem Grundgesetz und anderen Bedingungen unvereinbare Parameter aufweist und infolgedessen als gute, jedoch nicht umsetzbare Idee charakterisiert werden muss, welche für etablierte Parteien nicht zu empfehlen wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema der Arbeit
- Forschungsfrage
- Theorieperspektive
- Aufbau der Arbeit
- Methodisches Vorgehen
- Forschungsstand
- Definitionen
- Direkte Demokratie
- Innerparteiliche Demokratie
- Innerparteiliche Demokratie in den Parteien
- Christlich demokratische Union Deutschlands
- Funktionalität
- Effizienz
- Stabilität
- Die Piratenpartei
- Funktionalität
- Effizienz
- Stabilität
- Innerparteiliche Demokratie in der Realität
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die innerparteiliche Demokratie im Wandel, indem sie die Piratenpartei und die CDU vergleicht. Die Arbeit zielt darauf ab, die Frage zu beantworten, ob und inwieweit etablierte Parteien den Trend der direkten Demokratie mitgehen sollten, um keine Wähler und Glaubwürdigkeit zu verlieren.
- Vergleich der innerparteilichen Strukturen der Piratenpartei und der CDU
- Analyse der Funktionalität, Effizienz und Stabilität der jeweiligen Parteiensysteme
- Bewertung der Partizipationsmöglichkeiten in beiden Parteien im Kontext des Wandels der politischen Partizipation
- Untersuchung der Umsetzbarkeit des Piratenpartei-Modells auf Bundesebene
- Beurteilung der Relevanz des Trends der direkten Demokratie für etablierte Parteien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage, den theoretischen Ansatz, den Aufbau und das methodische Vorgehen dar. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Direkte Demokratie“ und „Innerparteiliche Demokratie“. Kapitel 3 analysiert die innerparteiliche Demokratie der CDU und der Piratenpartei anhand der Parameter Funktionalität, Effizienz und Stabilität. Kapitel 4 betrachtet die innerparteiliche Demokratie in der Realität. Die Abschließende Betrachtung fasst die Ergebnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und bietet einen Ausblick.
Schlüsselwörter
Innerparteiliche Demokratie, direkte Demokratie, politische Partizipation, Piratenpartei, CDU, Volksparteien, Partizipationsmöglichkeiten, Wandel, Vergleich, Funktionalität, Effizienz, Stabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage des Vergleichs zwischen Piratenpartei und CDU?
Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit etablierte Volksparteien wie die CDU den Trend zur direkten Demokratie mitgehen sollten, um Wähler und Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren.
Welche These vertritt der Autor bezüglich des Modells der Piratenpartei?
Der Autor behauptet, dass das System der Piratenpartei zwar modern ist, aber auf Bundesebene aufgrund von Unvereinbarkeiten mit dem Grundgesetz und anderen Bedingungen als nicht umsetzbar charakterisiert werden muss.
Nach welchen Parametern werden die Parteien verglichen?
Der Vergleich erfolgt anhand der Kriterien Funktionalität, Effizienz und Stabilität der jeweiligen innerparteilichen Strukturen.
Was unterscheidet die innerparteiliche Demokratie der CDU von der der Piratenpartei?
Die CDU wird als traditionelle Volkspartei mit hierarchischen Gliederungen analysiert, während die Piratenpartei als „Partei der direkten Demokratie“ mit neuartigen Partizipationsmöglichkeiten gilt.
Warum ist das Thema „Wandel der politischen Partizipation“ für Volksparteien wichtig?
Angesichts schwindender Wählerbindung müssen Volksparteien prüfen, wie sie Bürger durch direktere Beteiligungsformen wieder stärker aktivieren können, ohne ihre Stabilität zu gefährden.
- Quote paper
- B.A. Philipp Freund (Author), 2014, Innerparteiliche Demokratie im Wandel. Ein Vergleich zwischen der Piratenpartei und der CDU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317784