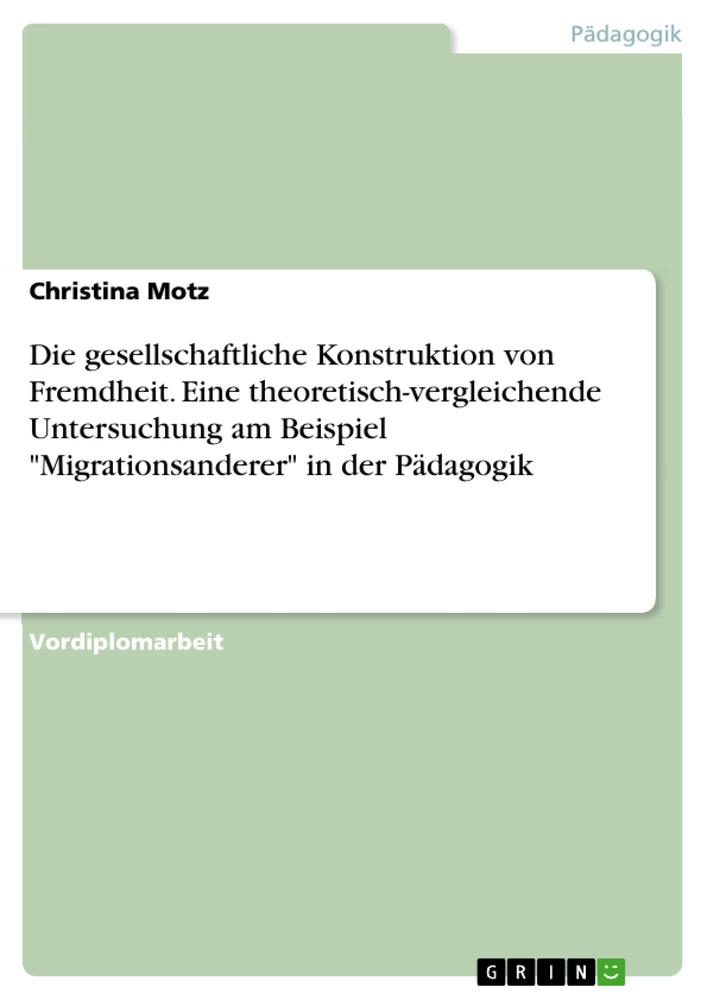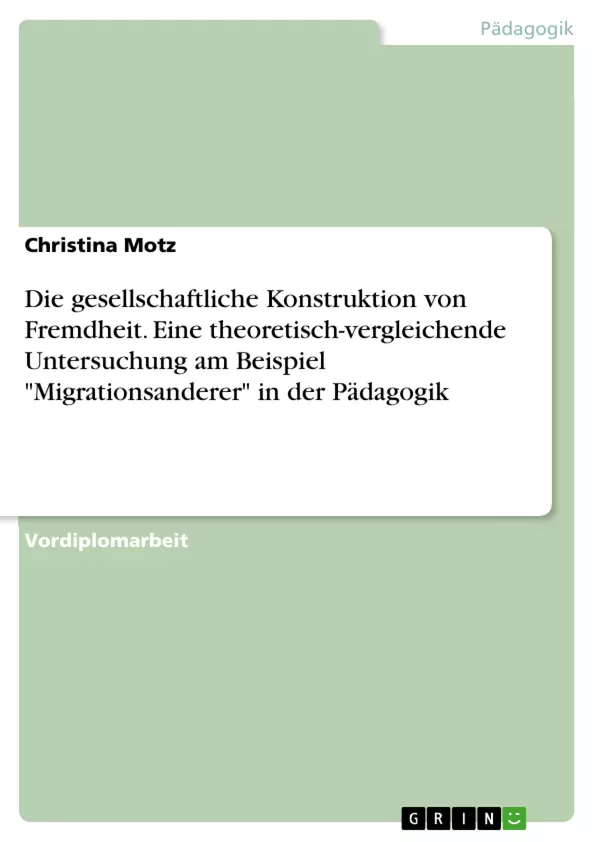Der alltägliche Diskurs über Migration behandelt häufig die Frage nach der Integration von „Migranten“ und wie diese gelingen kann. Dabei wird auch überlegt, welche Programme beziehungsweise migrationspolitischen Entscheidungen, wie beispielsweise staatlich verordnete Integrationskurse, dazu beitragen können. So begegnen uns häufig Begriffe wie “Migranten“, „Ausländer“ und „Zugewanderte“, welche zunächst als fremd, anders und nicht zugehörig erscheinen und daher „Integrationshilfen“ benötigen.
Diese Arbeit soll nicht die Frage, ob und in welcher Form solche Hilfen gerechtfertigt sind beantworten, sondern einige Schritte vorher ansetzen. Es soll erklärt werden, was „Migrationsandere“ zu eben solchen macht und herausgearbeitet werden, dass solche Kategorien und Zuordnungen, obwohl sie konstruiert sind, Auswirkungen auf gesellschaftliches Leben haben.
Dabei setzt sich die Autorin mit zwei verschiedenen theoretischen Ansätzen auseinander. So wird zunächst die Theorie der „gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit“ von Berger und Luckmann dargestellt und anschließend aufgezeigt, dass diese auch Relevanz innerhalb der Migrationspädagogik hat, indem diese Theorie mit der Perspektive Mecherils verglichen wird. Denn auch bei der Beschäftigung mit der Position Mecherlis begegnet man dem Gedanken der gesellschaftlichen Gemachtheit, sowie dem Begriff der Konstruktion. Zwar nicht immer in völliger Eindeutigkeit und Klarheit, jedoch durchaus als eine grundlegende Annahme erkennbar. Der Fokus liegt dabei, wie bereits erwähnt, auf der Konstruktion von „(Migrations-) Anderen“.
Das Ziel dieser Arbeit ist es nun, näher herauszuarbeiten, inwieweit die migrationspädagogische Perspektive Mecherils mit der Idee der gesellschaftlichen Gemachtheit einhergeht. An welchen Stellen ergeben sich Parallelen beziehungsweise Abgrenzungen zwischen beiden Perspektiven? Dabei nimmt die Autorin einen theoretisch-vergleichenden Blickwinkel ein und betrachtet die Relevanz der Annahmen Bergers und Luckmanns für die migrationspädagogische Sicht Mecherils auf die Erzeugung von „Migrationsanderen“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Perspektive von Berger und Luckmann
- Alltagswelt als allgemeine Wirklichkeit
- Die Bedeutung von Typisierungen
- Die Rolle von Sprache und Wissen innerhalb der alltäglichen Wirklichkeit
- Warum erscheint die Wirklichkeit gegeben, obwohl sie gemacht ist?
- Migrationsbericht 2008
- Relevanz des Migrationsberichtes
- Datenquellen des Berichtes
- Überblick zum allgemeinen Migrationsfluss
- Die Perspektive Mecherils
- Der migrationspädagogische Blick
- Wer ist ein/e MigrantIn? - Der Begriff der „Migrationsanderen“
- Gegenüberstellung beider Perspektiven
- Die Perspektive Mecherils im Vergleich mit der Position Bergers und Luckmanns
- Kategorisierung in Form von Zugehörigkeit bzw. Typisierung
- Diskurse bzw. Zeichensysteme als Mittel von Wirklichkeitserzeugung
- Wissen als Machtinstrument gesellschaftlicher Positionierung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die gesellschaftliche Konstruktion von "Migrationsanderen" in der Pädagogik, indem sie die Theorie der "gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit" von Berger und Luckmann mit der Perspektive Mecherils vergleicht. Ziel ist es, die Relevanz der Annahmen Bergers und Luckmann für die migrationspädagogische Sicht Mecherils auf die Erzeugung von "Migrationsanderen" herauszuarbeiten.
- Die Rolle von Typisierungen und Kategorisierung in der Konstruktion von "Migrationsanderen"
- Die Bedeutung von Sprache und Wissen in der Herstellung von Wirklichkeit
- Die Auswirkungen von Diskurspraxis auf die gesellschaftliche Positionierung von "Migrationsanderen"
- Der Einfluss von Wissen als Machtinstrument auf die Konstruktion sozialer Kategorien
- Die Frage, wie die "Wirklichkeit der Alltagswelt" als gegeben erscheint, obwohl sie konstruiert ist.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangsthese der Arbeit vor: Die gesellschaftliche Konstruktion von "Migrationsanderen" und die Relevanz dieser Thematik für die Migrationspädagogik. Kapitel 2 erläutert die Theorie der "gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit" von Berger und Luckmann, wobei die Alltagswelt als allgemeine Wirklichkeit, die Bedeutung von Typisierungen und die Rolle von Sprache und Wissen im Fokus stehen. Kapitel 3 stellt den Migrationsbericht 2008 vor und beleuchtet dessen Relevanz, Datenquellen und einen Überblick zum allgemeinen Migrationsfluss. Kapitel 4 präsentiert die migrationspädagogische Perspektive Mecherils und analysiert den Begriff der "Migrationsanderen". Kapitel 5 vergleicht die Perspektiven von Berger und Luckmann mit der von Mecheril, wobei die Kategorienbildung, Diskurse und Wissen als Machtinstrument im Vordergrund stehen. Das Resümee fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Typisierung, Kategorisierung, Migration, "Migrationsandere", Migrationspädagogik, Wissenssoziologie, Diskursanalyse, Machtinstrument, Alltagswelt.
- Quote paper
- Diplom Christina Motz (Author), 2010, Die gesellschaftliche Konstruktion von Fremdheit. Eine theoretisch-vergleichende Untersuchung am Beispiel "Migrationsanderer" in der Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317854