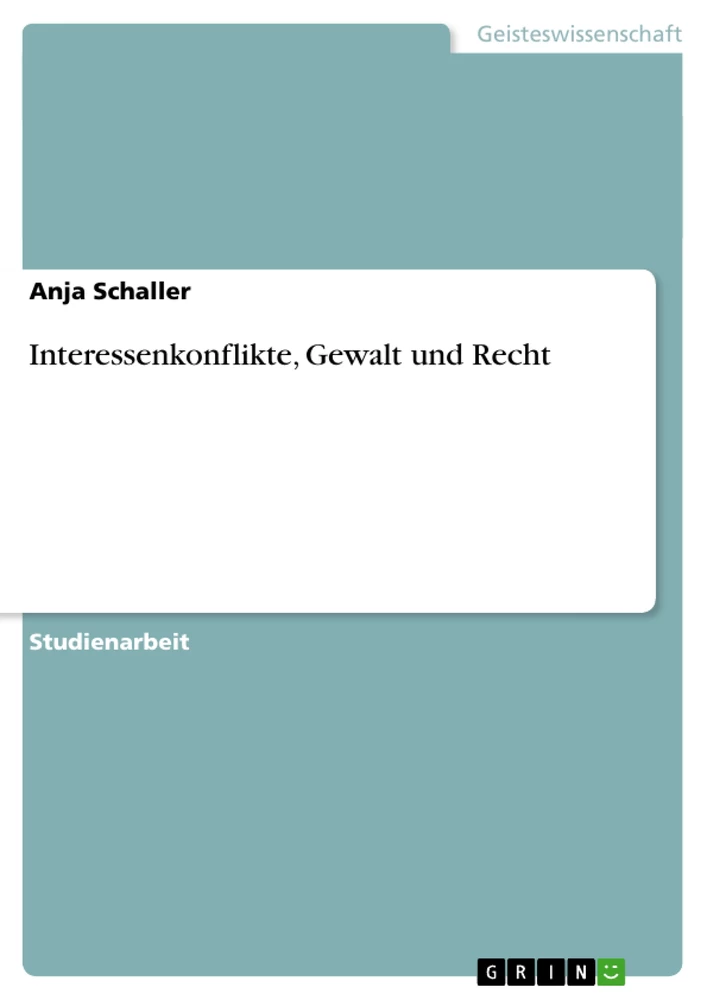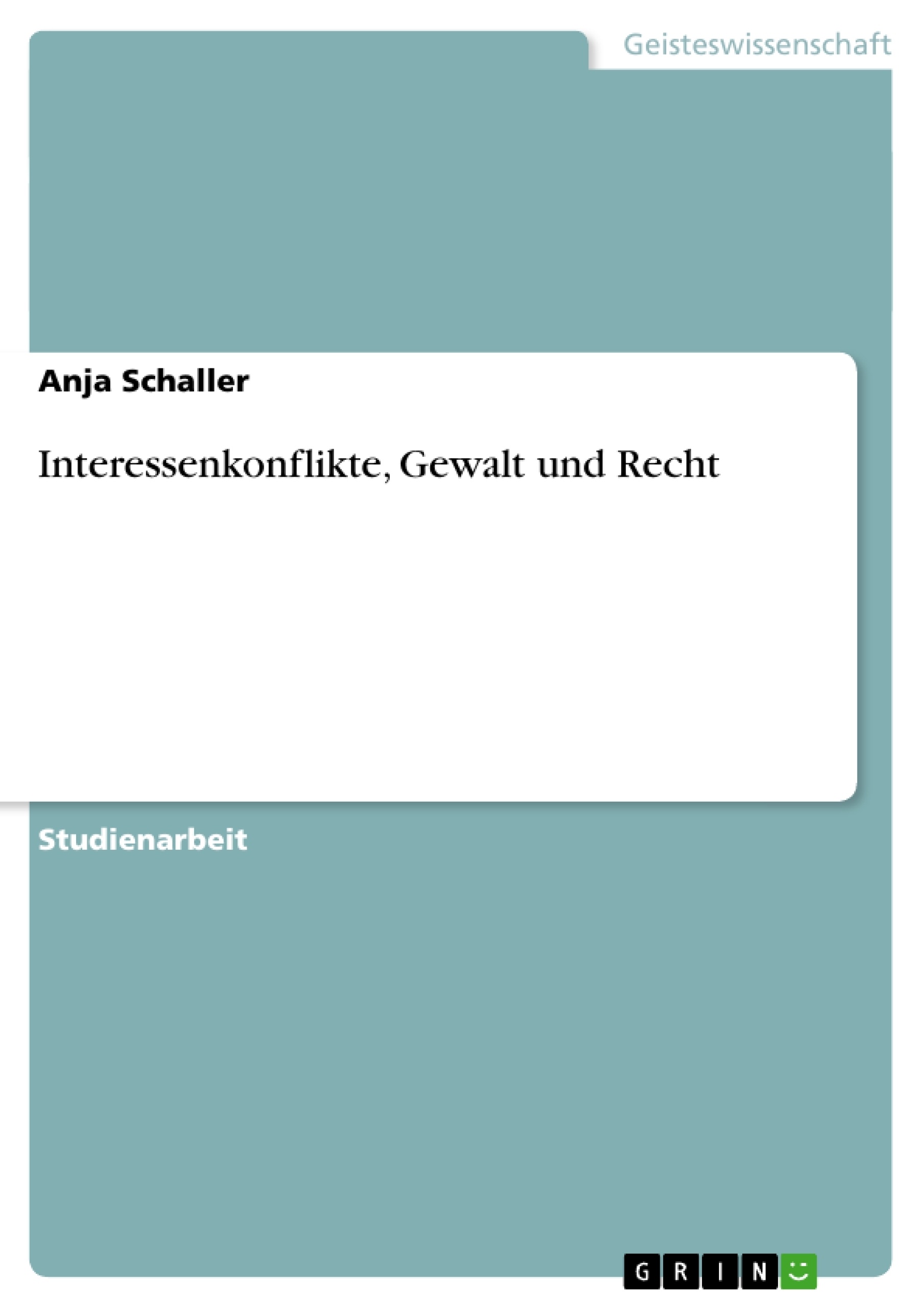Gewaltanwendung in der Familie ist heute immer noch ein heikles und leider auch aktue lles
Thema. Sowohl Gewalt gegen die eigenen Kinder, als auch Gewalt gegenüber dem
jeweiligen Ehepartner sind in der Diskussion nicht zu unterschätzen.
Wenn man denkt, dass Gewalt in der Erziehung nicht weit verbreitet ist, belehren einen die
Zahlen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eines besseren.
Laut deren Angaben werden heute in Deutschland immer noch rund 80 Prozent der Kinder
und Jugendlichen von ihren Eltern geohrfeigt, fast jedes dritte Kind hat schon einmal die
sprichwörtliche Tracht Prügel bekommen und immerhin 150.000 Kinder unter 15 Jahren
werden pro Jahr Opfer körperlicher Misshandlungen. Dies sind allerdings großteils nur
sehr grobe Zahlen, die Dunkelziffer dürfte bei einem solchen Tabuthema weit höher liegen.
Aber auch die Gewalt gegenüber dem Ehepartner, dabei handelt es sich entgegen der weitläufigen
Meinung nicht fast ausschließlich um Gewalt gegenüber Frauen, ist in den deutschen
Haushalten leider immer noch sehr präsent.
Dem gesellschaftlichen Wandel, der sich in großen Teilen der Bevölkerung hin zu einer
gleichberechtigten Partnerschaft und zu einem partnerschaftlichen Miteinander auch gegenüber
den Kindern vollzieht muss auch in der Gesetzgebung Rechnung getragen werden.
Immerhin war es über Jahrhunderte hinweg nicht nur legal, sondern dadurch auch gesellschaftlich
durchaus anerkannt, dass der Vater – als Oberhaupt der Familie – sowohl seine
Kinder, als auch die Ehefrau als ‚Erziehungsmaßnahme’ körperlich züchtigen durfte.
Wie sich dieser Wandel zumindest teilweise vollzogen hat und in welcher Form Gewaltanwendung
in der Familie in der deutschen Rechtsprechung heute behandelt wird, soll in
dieser Arbeit dargestellt werden. Natürlich kann im Rahmen einer solchen Arbeit das breite
Thema der Gewaltanwendung und des Familienrechts nicht erschöpfend dargestellt werden
und einzelne Teilaspekte müssen aus Gründen der begrenzten Möglichkeiten in den
Hintergrund treten. Dennoch soll ein umfassender Überblick über Gewalt und Recht in der
Familie entstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtlicher Hintergrund - Die Entwicklung des Rechts
- Vom elterlichen Züchtigungsrecht zum Misshandlungsverbot
- Das Gewaltschutzgesetz
- Gewalt gegen Kinder
- Der Wertewandel- Ein Wandel der Erziehungsmethoden?
- Rechtliche Konsequenzen des Gewaltverbotes
- Fortschritt durch das Gewaltverbot?
- Gewalt gegen Ehepartner
- Strafrechtliche Schutzmöglichkeiten
- Zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten
- Schutzanordnungen
- Wohnungsüberlassung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung des Rechts im Zusammenhang mit Gewalt in Familien. Sie untersucht den Wandel vom elterlichen Züchtigungsrecht hin zum Misshandlungsverbot, beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen des Gewaltverbots in der Erziehung und geht auf die rechtlichen Schutzmöglichkeiten für Opfer häuslicher Gewalt im Kontext von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaften ein.
- Rechtliche Entwicklungen im Umgang mit Gewalt in Familien
- Wandel der Erziehungsmethoden und rechtliche Folgen
- Schutzmöglichkeiten für Opfer häuslicher Gewalt
- Die Bedeutung des Gewaltschutzgesetzes
- Gesellschaftlicher Wandel und Gleichstellung von Mann und Frau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Gewaltanwendung in Familien als ein heikles und aktuelles Problem dar und liefert statistische Informationen zur Verbreitung von Gewalt gegen Kinder und Ehepartner. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit einer rechtlichen Regulierung und skizziert den Wandel von einer patriarchalischen Familienstruktur hin zu einer gleichberechtigten Partnerschaft.
Kapitel 2 analysiert die Entwicklung des Rechts im Umgang mit Gewalt in Familien. Es beleuchtet den historischen Wandel vom elterlichen Züchtigungsrecht zum Misshandlungsverbot und die Herausforderungen bei der Definition entwürdigender Erziehungsmaßnahmen. Weiterhin wird die Einführung des Gewaltschutzgesetzes und dessen Bedeutung für die Rechte der Partner in der Ehe bzw. Lebensgemeinschaft erläutert.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Thema der Gewalt gegen Kinder. Es thematisiert den Wertewandel in der Erziehung und beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen des Gewaltverbots. Darüber hinaus wird die Frage diskutiert, ob das Gewaltverbot einen tatsächlichen Fortschritt im Schutz von Kindern darstellt.
Kapitel 4 widmet sich der häuslichen Gewalt gegen Ehepartner. Es untersucht die strafrechtlichen und zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten, die Opfern zur Verfügung stehen, wobei insbesondere Schutzanordnungen und die Wohnungsüberlassung im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die Themen Gewalt in Familien, rechtliche Entwicklungen, Erziehungsrecht, Gewaltschutzgesetz, Misshandlungsverbot, körperliche und seelische Gewalt, Schutzmöglichkeiten für Opfer häuslicher Gewalt und Gleichstellung von Mann und Frau.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das elterliche Züchtigungsrecht verändert?
Es fand ein Wandel von einem legalen Züchtigungsrecht hin zu einem strikten Misshandlungsverbot statt, das heute im deutschen Recht verankert ist.
Was ist das Gewaltschutzgesetz?
Das Gewaltschutzgesetz bietet rechtliche Instrumente wie Schutzanordnungen und die Wohnungsüberlassung, um Opfer häuslicher Gewalt vor weiteren Übergriffen zu schützen.
Wie viele Kinder sind in Deutschland von Gewalt betroffen?
Statistiken zeigen, dass rund 80 % der Kinder geohrfeigt werden und etwa 150.000 Kinder unter 15 Jahren pro Jahr Opfer körperlicher Misshandlungen werden.
Gibt es rechtlichen Schutz bei Gewalt gegen Ehepartner?
Ja, die Arbeit beleuchtet sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten, die unabhängig vom Geschlecht des Opfers greifen.
Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche Wandel auf das Familienrecht?
Der Trend zu gleichberechtigten Partnerschaften und gewaltfreier Erziehung zwang den Gesetzgeber dazu, veraltete patriarchalische Strukturen abzubauen.
- Arbeit zitieren
- Anja Schaller (Autor:in), 2004, Interessenkonflikte, Gewalt und Recht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31786