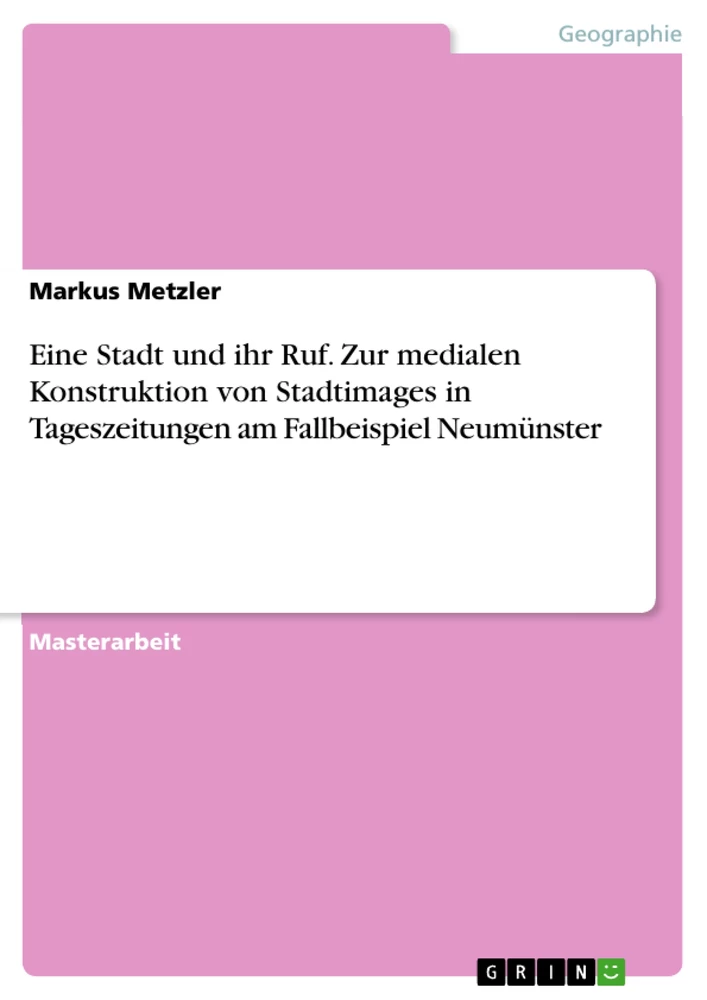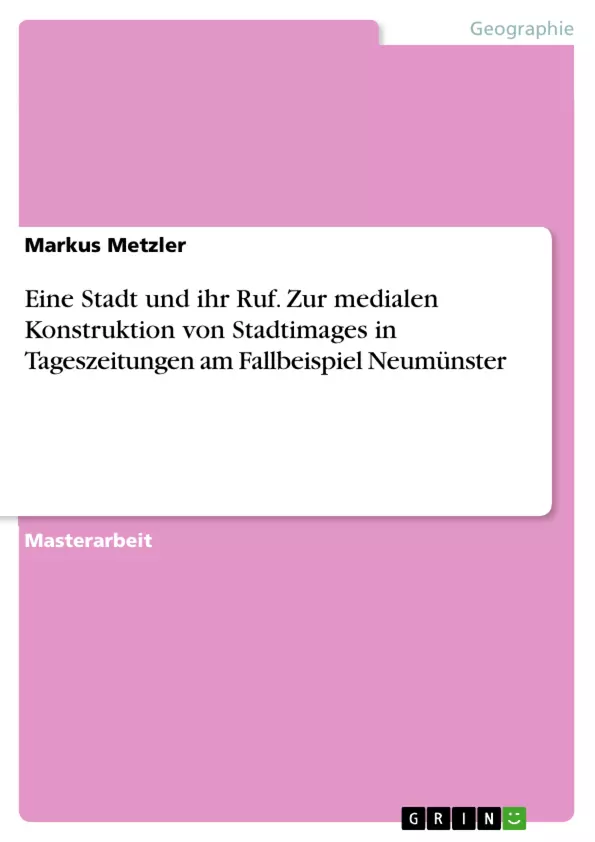Das Image einer Stadt erfährt im Kontext von Vermarktungsstrategien, einer Beeinflussung durch das Stadtmarketing und als Instrument der Stadtplanung gegenwärtig zunehmende Aufmerksamkeit. Das Vielversprechende für das Stadtmarketing ist die Idee, dass Darstellungen und das Image einer Stadt einfacher zu formen sind als die städtische Realsituation. Doch derartige Imagekonstruktionen vollziehen sich nicht ausschließlich auf stadtpolitischer Ebene und sind zudem nur begrenzt steuerbar.
Die mediale Beschreibung von Orten ist untrennbar mit politischen und sozialen Konstruktionen des Images verbunden, denn insbesondere Massenmedien thematisieren bestimmte Sachverhalte, verschweigen andere und sind so direkt in die (Re-)Produktion von Stadtimages und die Aufarbeitung dieser für ein großes Publikum involviert. Der Vermittlung negativer Bilder eines Ortes kommt daher eine herausragende Bedeutung in der Positionierung dieser Städte im interkommunalen, interregionalen oder globalen Wettbewerb um begehrte Bevölkerungsgruppen und deren Ressourcen zu.
Die schleswig-holsteinische Mittelstadt Neumünster wird sowohl aufgrund ihrer jüngeren ökonomischen und sozialen Transformationsprozesse als auch aufgrund ihrer Lage zwischen den Wachstumsräumen Kiel und Hamburg darauf hin untersucht, wie sich Tageszeitungen und deren digitale Ableger hinsichtlich ihrer Bezugsräume und Verortung „innerhalb“ bzw. „außerhalb“ des thematisierten Raums inhaltlich und formell unterscheiden. Erkenntnisse der Medienwirkungsforschung werfen bezüglich der Darstellung Neumünsters als Ereignisort verschiedener negativer Entwicklungen die Frage auf, in welcher Weise individuelle Wahrnehmungs- und Selektionspraktiken von JournalistInnen, die politische Ausrichtung der veröffentlichenden Zeitungen beziehungsweise Verlage und technische Rahmenbedingungen der Plattformen Zeitung und Internet das Zustandekommen imagebildender Diskurse beeinflussen. Ursachen und Prozesse der (Re-)Produktion bestimmter Darstellungsformen einer Stadt stehen ebenso im Fokus wie die kritische Auseinandersetzung mit kommerziellen Zwecken dienenden Imagegestaltungen seitens des Stadtmarketings und die Frage nach einem möglichen Nutzen stigmatisierter Orte im (städte-)räumlichen Wettbewerb.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Bedeutung und Konstruktion des Images
- Das Stadtimage im neoliberalen Wettbewerb
- Massenmedien als „Stigmatisierer“
- Meinungen und Einstellungen - ein Exkurs in die Medienwirkungsforschung
- Agenda-Setting und die Imagekonstruktion nach Karl Ganser
- Die Umsetzung der Fragestellung in ein Forschungskonstrukt
- Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring
- Untersuchte Medien: Die Tageszeitung und die Tageszeitung im Internet
- Operationalisierung und Auswertung der Forschungsfragen
- Analysebeispiel
- Das Fallbeispiel Neumünster
- Ergebnisse der Untersuchung
- Darstellung der Ergebnisse
- Eine Einschätzung der Ergebnislage anhand methodischer und praktischer Schwierigkeiten
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Masterarbeit befasst sich mit der medialen Konstruktion von Stadt-Images in Tageszeitungen. Sie analysiert anhand des Fallbeispiels Neumünster, wie die Stadt in den Medien dargestellt wird und wie diese Darstellungen das Image der Stadt beeinflussen.
- Die Bedeutung von Stadt-Images im neoliberalen Wettbewerb
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Stadt-Images
- Die Relevanz von Medienwirkungsforschung für das Verständnis von Stadt-Images
- Die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse als Methode zur Untersuchung von Stadt-Images in Tageszeitungen
- Die Analyse des Stadt-Images von Neumünster in der Tagespresse
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Stadt-Image“ im Kontext des neoliberalen Wettbewerbs dar und erläutert den Forschungsgegenstand der Arbeit.
- Die Bedeutung und Konstruktion des Images: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Stadt-Images im neoliberalen Wettbewerb und untersucht die Rolle der Massenmedien als „Stigmatisierer“. Es geht auch auf die Medienwirkungsforschung ein und stellt das Konzept des Agenda-Setting nach Karl Ganser vor.
- Die Umsetzung der Fragestellung in ein Forschungskonstrukt: Dieses Kapitel beschreibt die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring und erläutert die Auswahl der untersuchten Medien sowie die Operationalisierung und Auswertung der Forschungsfragen.
- Das Fallbeispiel Neumünster: Dieses Kapitel stellt das Fallbeispiel Neumünster vor und beschreibt den Kontext, in dem die Stadt-Image-Konstruktion untersucht wird.
- Ergebnisse der Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und analysiert die Darstellung von Neumünster in der Tagespresse. Es geht auch auf methodische und praktische Schwierigkeiten ein, die bei der Untersuchung auftreten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Masterarbeit befasst sich mit den zentralen Themen Stadt-Image, Medien, Tageszeitung, qualitative Inhaltsanalyse, Fallbeispiel Neumünster und neoliberaler Wettbewerb. Sie analysiert die Konstruktion von Stadt-Images durch die Medien und erforscht die Rolle der Tageszeitungen in diesem Prozess.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Image einer Stadt medial konstruiert?
Massenmedien wählen bestimmte Themen aus und verschweigen andere, wodurch sie direkt an der Produktion und Stigmatisierung von Stadtimages beteiligt sind.
Welches Fallbeispiel wird in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die mediale Darstellung der schleswig-holsteinischen Mittelstadt Neumünster in Tageszeitungen und deren Online-Portalen.
Was ist das Ziel des Stadtmarketings im neoliberalen Wettbewerb?
Stadtmarketing versucht, ein positives Image zu formen, um begehrte Bevölkerungsgruppen und Ressourcen im interkommunalen Wettbewerb zu gewinnen.
Welche Methode wird zur Untersuchung der Zeitungsartikel genutzt?
Die Untersuchung erfolgt mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring.
Welche Rolle spielt das Agenda-Setting?
Die Arbeit nutzt das Konzept des Agenda-Settings, um zu zeigen, wie Journalisten durch ihre Auswahlpraktiken bestimmen, welche Themen das Bild einer Stadt prägen.
- Quote paper
- Markus Metzler (Author), 2015, Eine Stadt und ihr Ruf. Zur medialen Konstruktion von Stadtimages in Tageszeitungen am Fallbeispiel Neumünster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317911