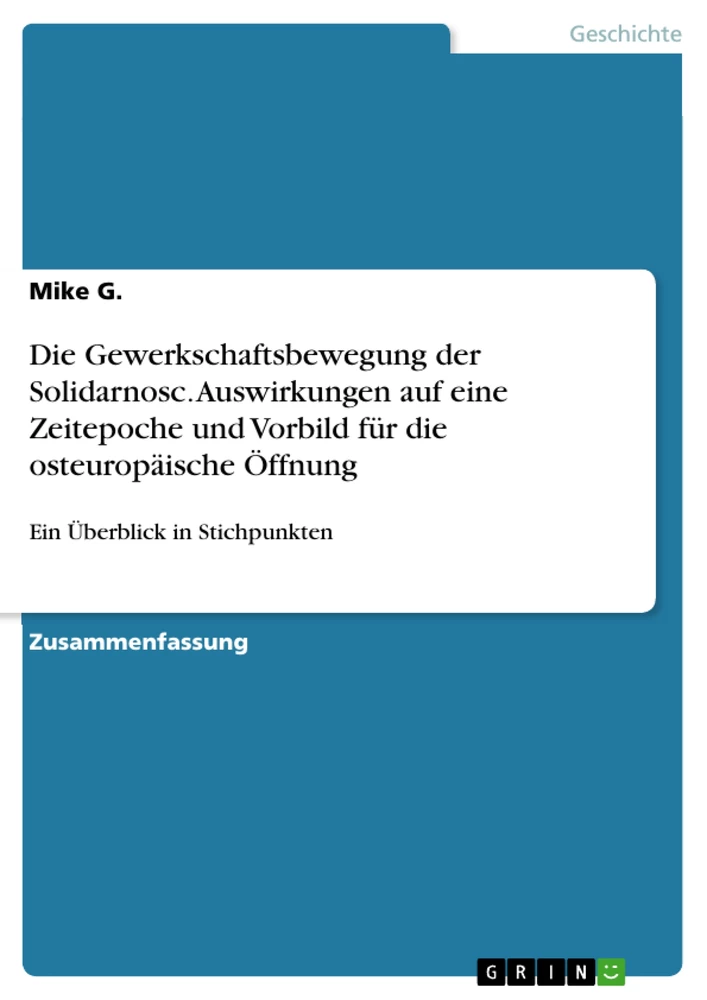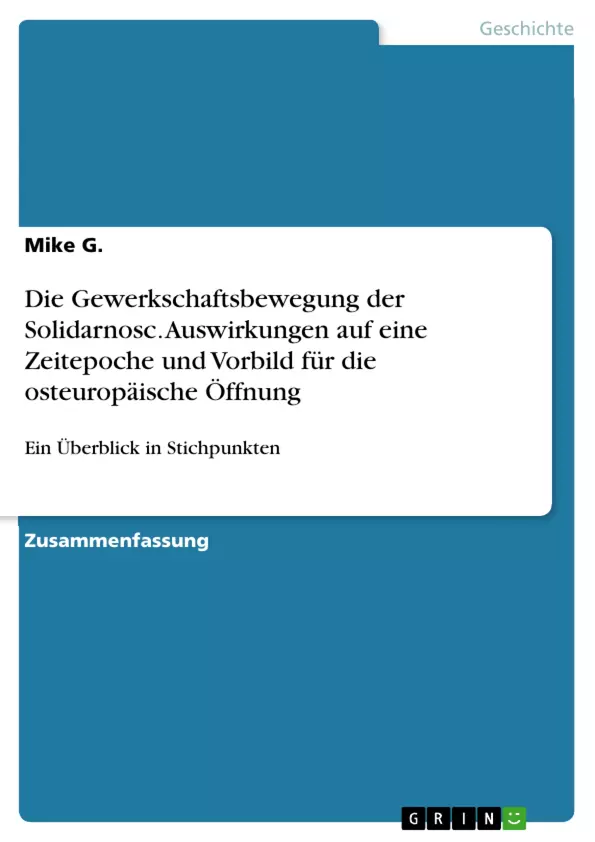Nicht nur die DDR machte eine besondere Entwicklung als sogenannter Blockstaat im Warschauer Pakt durch. Vorbildhaftes Beispiel für alle weiteren Revolutionen in Osteuropa wurde Polen, dessen Gewerkschaftsbewegung „Solidarnosc“ neun Jahre nach ihrer Gründung zu einem „runden Tisch“ führte, welchen es bis dahin noch nie in der Geschichte gegeben hatte.
Diese Arbeit befasst sich näher mit den historischen Umständen und Leistungen der Solidarnosc, welche mit zahlreichen zeitgenössischen Quellen untermauert werden. Diese sind eingebettet in die chronologische, stichwortartige Schilderung der Ereignisse. Hintergrundinformationen und eine abschließende Analyse der ARD in Warschau runden die bloße Wiedergabe von Ereignissen, welche an einigen Stellen auch deutlich bewertet wurde, ab.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Wichtige Voraussetzungen für einen gemeinsamen Zusammenhalt und Protest
- 1970 - 1980: Ereignisse und Entwicklungen
- August 1980: Streiks und Forderungen
- August 1980: Verhandlungen und Abkommen
- September 1980: Gründung der Solidarnosc
- Oktober/November 1980: Statuten der Solidarnosc
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und die frühen Erfolge der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc. Sie beleuchtet die historischen Umstände, die zur Gründung der Solidarnosc führten, und analysiert die wichtigsten Forderungen und Verhandlungen der Bewegung. Der Fokus liegt auf der Rolle der katholischen Kirche, den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Bedeutung der Selbstorganisation der polnischen Arbeiter.
- Die Rolle der katholischen Kirche in der polnischen Gesellschaft
- Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf das polnische politische Bewusstsein
- Die Selbstorganisation der Arbeiter und ihre Bedeutung für den Erfolg der Solidarnosc
- Die Verhandlungen zwischen der Solidarnosc und der polnischen Regierung
- Die Gründung und die frühen Statuten der Solidarnosc
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt den Kontext der Arbeit und hebt die Bedeutung der Solidarnosc als prägendes Beispiel für die osteuropäischen Revolutionen hervor. Es betont die Verwendung zeitgenössischer Quellen und die Kombination aus chronologischer Darstellung der Ereignisse und einer abschließenden Analyse.
Wichtige Voraussetzungen für einen gemeinsamen Zusammenhalt und Protest: Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden Faktoren, die den gemeinsamen Zusammenhalt und den Protest der polnischen Arbeiter ermöglichten. Es analysiert die wichtige Rolle der katholischen Kirche als Hort des Widerstands gegen das staatliche Narrativ und die tiefgreifenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf das polnische Selbstverständnis, insbesondere den Verlust von Freiheit und Autonomie. Der Einfluss deutscher Politiker auf das Abbau des Misstrauens gegenüber Deutschland und die damit ermöglichte stärkere politische Partizipation wird ebenfalls thematisiert.
1970 - 1980: Ereignisse und Entwicklungen: Dieses Kapitel skizziert die wichtigsten Ereignisse zwischen 1970 und 1980, die zum Ausbruch der Streiks führten. Es zeigt, wie die Unterdrückung von Streiks in 1970 und die Polenreise von Papst Johannes Paul II. in 1979 die politische Landschaft Polens beeinflussten und die Grundlage für die spätere Selbstorganisation der Arbeiter legten. Die Reise des Papstes wird besonders hervorgehoben, da sie als ein Schlüsselerlebnis angesehen wird, welches die Fähigkeit der Bevölkerung zur Selbstorganisation demonstrierte – eine Fähigkeit, die für den Erfolg der Solidarnosc unerlässlich war.
August 1980: Streiks und Forderungen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Verlauf der Streiks im August 1980, angefangen bei den Preiserhöhungen für Lebensmittel und der Entlassung wichtiger Akteure in der Leninwerft. Es analysiert die elf ursprünglichen Forderungen der Streikenden in der Leninwerft und die erweiterten 21 Forderungen des zentralen Streikkomitees, die weit über die unmittelbaren Arbeitsbedingungen hinausgingen und grundlegende politische und wirtschaftliche Reformen forderten. Die Forderungen decken ein breites Spektrum an Themen ab, von Lohnforderungen und Arbeitsbedingungen bis hin zu Pressefreiheit und politischen Freiheiten, was die umfassende Natur der Proteste unterstreicht.
August 1980: Verhandlungen und Abkommen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Verhandlungen zwischen dem Streikkomitee und der polnischen Regierung, die zu den Abkommen von Danzig führten. Es analysiert die Zugeständnisse der Regierung, wie die Wiedereinstellung entlassener Arbeiter, Lohnerhöhungen und die Zusage, ein Gesetz gegen die Zensur auszuarbeiten. Die Bedeutung dieser Zugeständnisse wird im Kontext der damaligen politischen und wirtschaftlichen Lage Polens betrachtet, sowie die Bedeutung des Abkommens für die Entstehung und die Anerkennung der Solidarnosc.
September 1980: Gründung der Solidarnosc: Dieses Kapitel beschreibt die Gründung der Solidarnosc als Reaktion auf die Ereignisse im August 1980 und die Reaktion der Regierung. Es zeigt den Übergang von spontanen Streiks zu einer formellen, organisierten Gewerkschaftsbewegung und analysiert die Bedeutung dieses Schrittes für die polnische Gesellschaft und Politik. Das Interview mit der Krankenschwester Pinkowska illustriert die persönlichen Erfahrungen und Motivationen der beteiligten Menschen und unterstreicht den menschlichen Aspekt der Bewegung.
Oktober/November 1980: Statuten der Solidarnosc: Dieses Kapitel präsentiert die Statuten der Solidarnosc und analysiert deren Bedeutung. Es zeigt die Selbstverwaltungsstruktur der Gewerkschaft und ihre Unabhängigkeit von staatlichen Behörden und politischen Parteien auf. Die Statuten unterstreichen das Ziel der Solidarnosc, die sozialen, kulturellen und materiellen Interessen der Arbeiter zu schützen, sowie den Einfluss der Gewerkschaft auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik zu erstreben. Die detaillierte Analyse der einzelnen Paragrafen beleuchtet die Ziele und die Struktur der Organisation.
Schlüsselwörter
Solidarnosc, Polen, Gewerkschaftsbewegung, Streiks, Arbeiterbewegung, Katholische Kirche, Zweiter Weltkrieg, Kommunismus, Sozialismus, Selbstorganisation, Verhandlungen, Demokratisierung, Wirtschaftsreformen, Pressefreiheit, politische Repression.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entstehung der Solidarnosc
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Entstehung und die frühen Erfolge der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den historischen Umständen, den Forderungen und Verhandlungen der Bewegung, sowie der Rolle der katholischen Kirche, den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Bedeutung der Selbstorganisation der polnischen Arbeiter.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehung der Solidarnosc im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Situation in Polen in den Jahren 1970-1980. Es analysiert die Rolle der katholischen Kirche, die Folgen des Zweiten Weltkriegs, die Selbstorganisation der Arbeiter, die Verhandlungen zwischen der Solidarnosc und der Regierung, die Gründung und die Statuten der Gewerkschaft, sowie die Streiks und deren Forderungen im August 1980.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Wichtige Voraussetzungen für einen gemeinsamen Zusammenhalt und Protest, 1970 - 1980: Ereignisse und Entwicklungen, August 1980: Streiks und Forderungen, August 1980: Verhandlungen und Abkommen, September 1980: Gründung der Solidarnosc, Oktober/November 1980: Statuten der Solidarnosc.
Welche Rolle spielte die katholische Kirche?
Die katholische Kirche spielte eine entscheidende Rolle als Hort des Widerstands gegen das staatliche Narrativ und unterstützte indirekt die Selbstorganisation der Arbeiter. Die Polenreise von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1979 wird als Schlüsselerlebnis angesehen, das die Fähigkeit der Bevölkerung zur Selbstorganisation demonstrierte – eine Fähigkeit, die für den Erfolg der Solidarnosc unerlässlich war.
Welche Bedeutung hatte der Zweite Weltkrieg?
Der Zweite Weltkrieg hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das polnische Selbstverständnis, insbesondere den Verlust von Freiheit und Autonomie. Diese Erfahrungen prägten das politische Bewusstsein und trugen zu dem Wunsch nach Selbstbestimmung und Freiheit bei, der die Bewegung Solidarnosc antrieb.
Welche Forderungen stellten die Streikenden im August 1980?
Die elf ursprünglichen Forderungen der Streikenden in der Leninwerft wurden später zu 21 Forderungen des zentralen Streikkomitees erweitert. Diese Forderungen umfassten nicht nur unmittelbare Arbeitsbedingungen wie Lohnerhöhungen, sondern auch grundlegende politische und wirtschaftliche Reformen, wie Pressefreiheit und politische Freiheiten.
Was waren die Ergebnisse der Verhandlungen im August 1980?
Die Verhandlungen zwischen dem Streikkomitee und der polnischen Regierung führten zu den Abkommen von Danzig. Die Regierung machte Zugeständnisse wie die Wiedereinstellung entlassener Arbeiter, Lohnerhöhungen und die Zusage, ein Gesetz gegen die Zensur auszuarbeiten. Diese Zugeständnisse waren von Bedeutung für die Entstehung und Anerkennung der Solidarnosc.
Wie war die Struktur der Solidarnosc?
Die Statuten der Solidarnosc betonten die Selbstverwaltungsstruktur der Gewerkschaft und ihre Unabhängigkeit von staatlichen Behörden und politischen Parteien. Die Gewerkschaft zielte darauf ab, die sozialen, kulturellen und materiellen Interessen der Arbeiter zu schützen und Einfluss auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik auszuüben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments beschreiben, sind: Solidarnosc, Polen, Gewerkschaftsbewegung, Streiks, Arbeiterbewegung, Katholische Kirche, Zweiter Weltkrieg, Kommunismus, Sozialismus, Selbstorganisation, Verhandlungen, Demokratisierung, Wirtschaftsreformen, Pressefreiheit, politische Repression.
- Quote paper
- Mike G. (Author), 2016, Die Gewerkschaftsbewegung der Solidarnosc. Auswirkungen auf eine Zeitepoche und Vorbild für die osteuropäische Öffnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317962