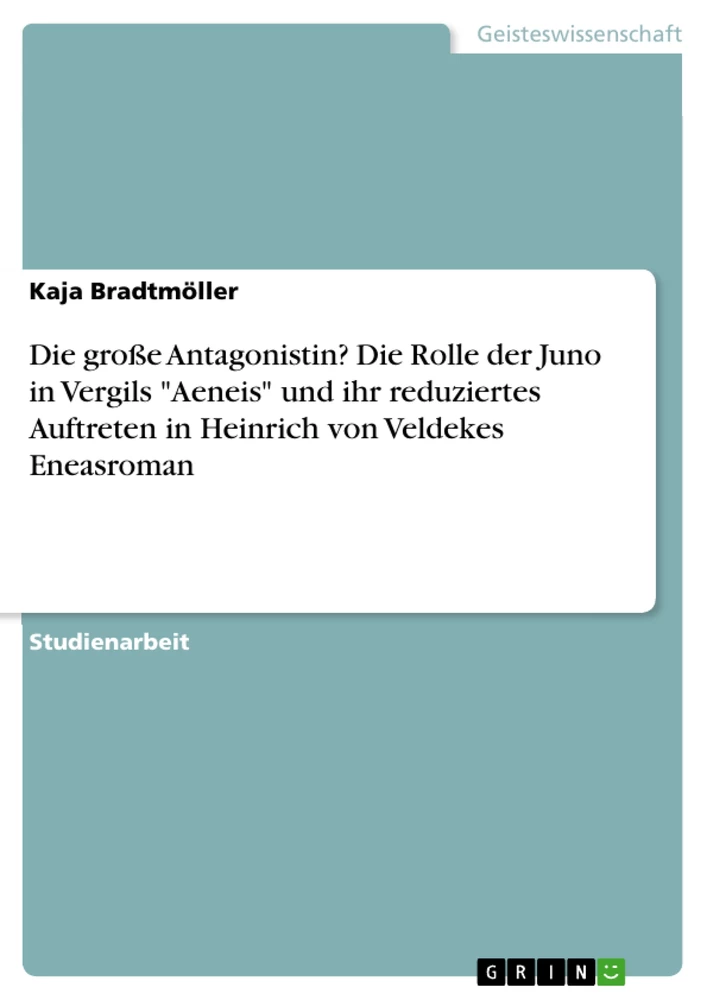Nach Ernst Schmidt ist das Handeln der Juno in der Aeneis „[…] von so grundlegender Bedeutung, daß es die Gesamthandlung vom Anfang von Buch 1 bis zum Ende von Buch 12 begründet […]“. Eine Überschätzung ihrer Bedeutung scheint seines Erachtens nicht möglich. Der mittelalterliche Eneasroman von Heinrich von Veldeke verzichtet demgegenüber größtenteils auf die Figur der Göttin.
Es ergibt sich die Frage, wie der Roman Junos Rolle derart reduzieren kann, wenn sie tatsächlich die treibende Kraft des Epos und Grundstein der Handlung ist. Eine genauere Betrachtung der Juno in der Aeneis scheint notwendig. Wer ist diese Göttin? Wie vollzieht sich diese Juno-Handlung und welche Motive bedingen sie? Weitergehend stellt sich die Frage, warum die höchste Göttin der römischen Kultur die Rolle der Antagonistin in der Aeneis einnimmt und damit die Gründung des römischen Volkes zu verhindern sucht? Diesen Aspekten soll in der vorliegenden Ausarbeitung nachgegangen werden. Dazu wird die Göttin Juno zunächst in der historischen Entwicklung ihres Kultes betrachtet. Es folgt die Untersuchung ihrer Position und Funktion in der Aeneis, die den Schwerpunkt dieser Ausarbeitung bildet, woran sich eine kurzgefasste Betrachtung von Junos Rolle im Eneasroman anschließt. Zuletzt wird noch der Versuch einer Ergründung der Darstellung Junos in beiden literarischen Werken unternommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der Göttin Juno in Kultur und Religion
- Junos Auftreten und Funktion in der Aeneis
- Die Einführung Junos (I,1-33)
- Junos erster Monolog (I, 34-49)
- Junos zweiter Monolog (VII, 286-322)
- Juno und Allecto (VII, 323-345, 540-560)
- Die Götterversammlung (X, 1-117)
- Das Verhältnis zwischen Juno und Jupiter
- Allgemeine Bestimmungen
- Jupiters Ermahnung der Juno (X, 606-644)
- Das letzte Gespräch zwischen Juno und Jupiter (XII, 791-886)
- Zusammenfassung der Textbetrachtung
- Die vergilische Juno und ihre Rezeption in Heinrich von Veldekes Eneasroman
- Ergründung der unterschiedlichen Verwendung Junos in der Aeneis und dem Eneasroman
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht die Rolle der Göttin Juno in Vergils Aeneis und deren reduziertes Auftreten in Heinrich von Veldekes Eneasroman. Sie analysiert die Entwicklung Junos in der römischen Kultur und Religion, untersucht ihre Funktion und Motivation in der Aeneis und analysiert die Unterschiede in ihrer Darstellung in beiden Werken.
- Die Bedeutung der Göttin Juno in der römischen Kultur und Religion
- Die Funktion und Motivation Junos in der Aeneis
- Die Darstellung Junos in Heinrich von Veldekes Eneasroman
- Die Unterschiede in der Verwendung Junos in der Aeneis und dem Eneasroman
- Die Gründe für die reduzierte Rolle Junos im Eneasroman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Ausarbeitung vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Göttin Juno in der römischen Kultur und Religion. Das dritte Kapitel analysiert Junos Auftreten und Funktion in der Aeneis, einschließlich ihrer Motivationen und ihres Verhältnisses zu Jupiter. Das vierte Kapitel betrachtet die Rezeption der vergilischen Juno in Heinrich von Veldekes Eneasroman. Das fünfte Kapitel ergründet die Unterschiede in der Darstellung Junos in beiden Werken. Die Ausarbeitung endet mit einem Fazit.
Schlüsselwörter
Juno, Aeneis, Eneasroman, Heinrich von Veldeke, römische Kultur, Religion, Mythologie, Göttin, Antagonistin, Funktion, Motivation, Rezeption, Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Juno in Vergils „Aeneis“?
Juno ist die große Antagonistin. Ihr Zorn und ihr Handeln begründen die Gesamthandlung von Buch 1 bis 12, da sie versucht, die Gründung Roms durch Aeneas zu verhindern.
Warum ist Junos Rolle im „Eneasroman“ von Heinrich von Veldeke reduziert?
Der mittelalterliche Roman verzichtet weitgehend auf die göttliche Ebene als treibende Kraft, um den Fokus stärker auf menschliche Motive und ritterliche Ideale zu legen.
Was sind die Motive für Junos Zorn in der Aeneis?
Ihre Motive sind die Kränkung durch das Urteil des Paris, ihre Liebe zu Karthago und das Wissen um das Schicksal, dass die Nachfahren der Trojaner Karthago einst zerstören werden.
Wie ist das Verhältnis zwischen Juno und Jupiter?
Jupiter repräsentiert das unabwendbare Schicksal (Fatum), während Juno versucht, dieses Schicksal zu verzögern oder zu beeinflussen, was zu ständigen Konflikten führt.
Was charakterisiert Junos kulturelle Entwicklung?
Die Arbeit betrachtet Juno in der historischen Entwicklung ihres Kultes von einer lokalen Gottheit zur höchsten Göttin der römischen Kultur.
- Quote paper
- Kaja Bradtmöller (Author), 2015, Die große Antagonistin? Die Rolle der Juno in Vergils "Aeneis" und ihr reduziertes Auftreten in Heinrich von Veldekes Eneasroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317990