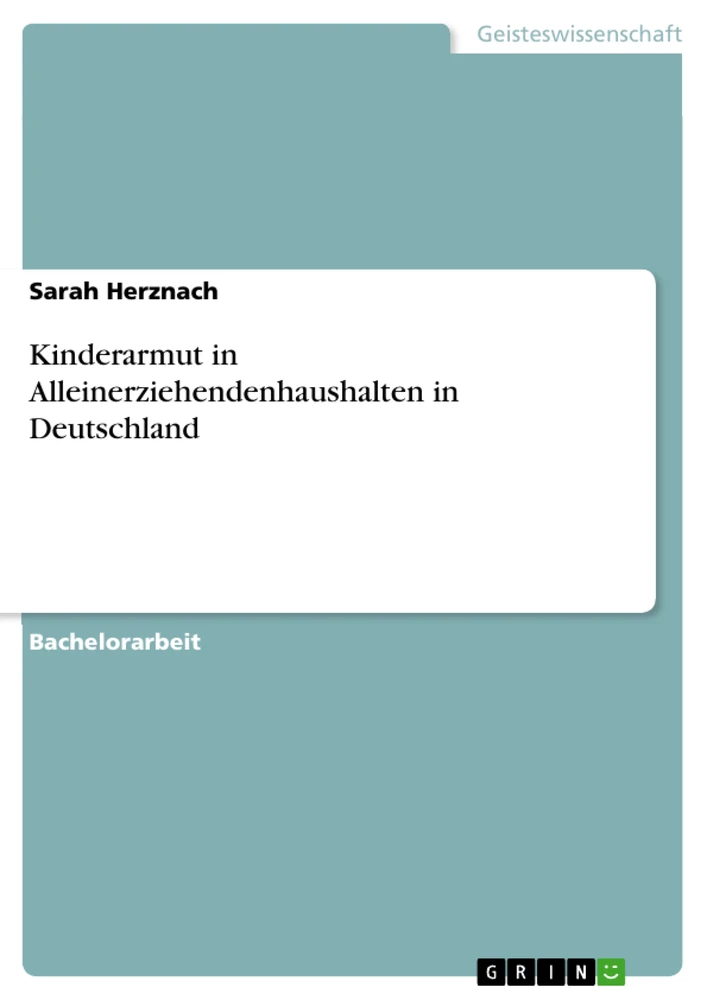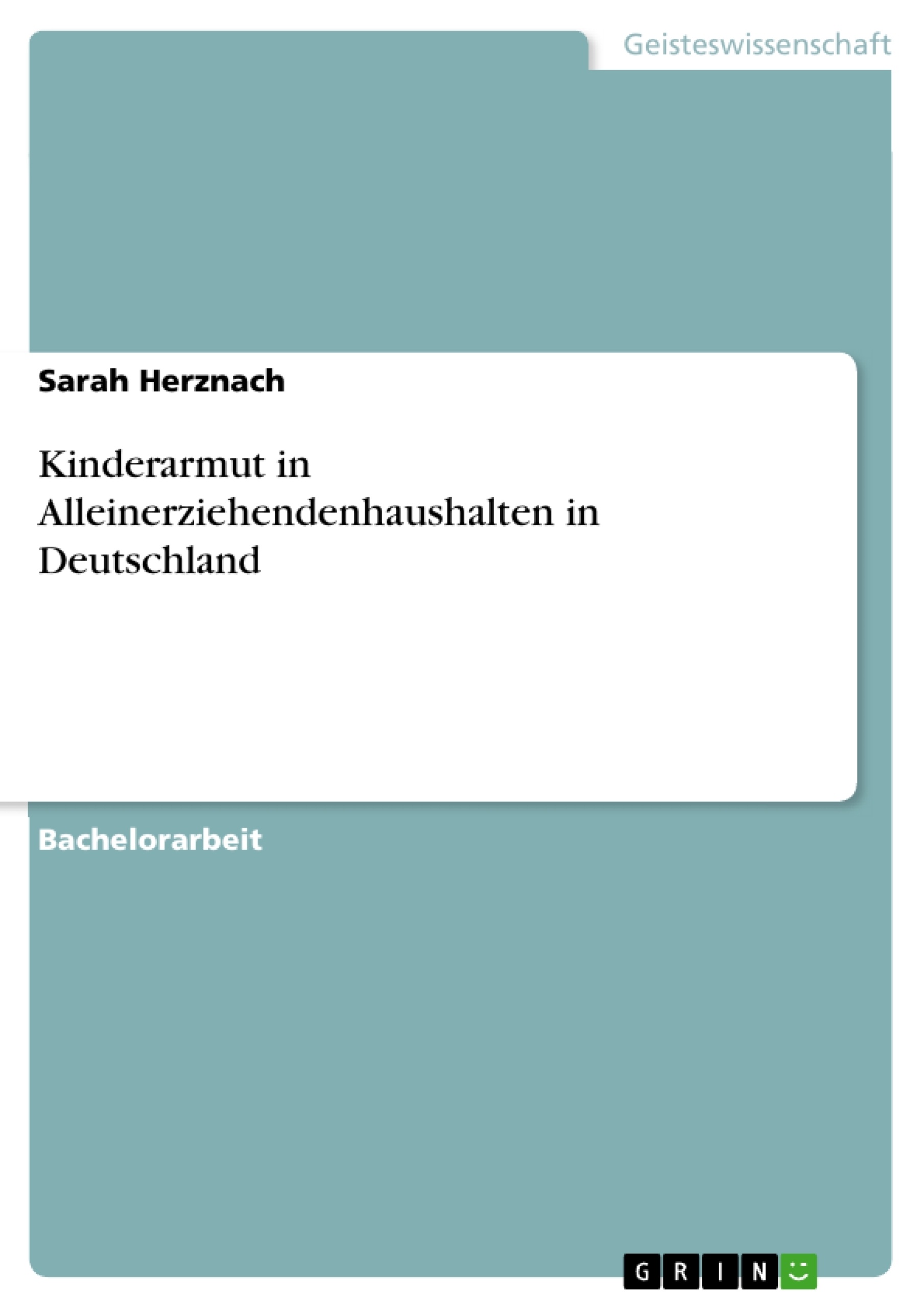Die Kindheit stellt eine wichtige Entwicklungsphase im Leben eines Menschen dar. Die Ereignisse und Umstände, mit denen eine Person in dieser Zeit konfrontiert wird, bestimmen ihren
zukünftigen Lebensverlauf. Erfährt ein Mensch in seiner Kindheit Armut, wirkt sich dies in den meisten Fällen einschränkend auf seine Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen aus (vgl. Holz/Richter-Kornweitz 2010: 48). Als nicht erwerbsfähige Personen sind Kinder nicht in der Lage, eine Armutssituation zu beeinflussen oder mit eigenen Mitteln zu beenden. Daher spielt die Familie neben dem emotionalen auch für das finanzielle Wohl des Kindes die wichtigste Rolle. Oft entscheidet schon die Familienstruktur über die sozialen und materiellen Chancen eines Kindes. Bis heute dominiert in unserer Gesellschaft die traditionelle Kernfamilie, bestehend aus einem Elternpaar und Kindern. Die Kernfamilie wird jedoch, insbesondere durch den Bedeutungsverlust der Institution „Ehe“ bedingt, zunehmend von anderen Familienformen verdrängt. Eine der am schnellsten wachsenden Familienformen ist die Ein- Elternfamilie (vgl. Brodolini 2007: 13). In Deutschland lebt inzwischen jedes fünfte Kind in einem Haushalt mit nur einem Elternteil. Der Anteil der Kinder, die arm oder armutsgefährdet sind, ist in dieser Familienstruktur, wie in den meisten Industrieländern, in Deutschland auffällig hoch. Auch bei einer Erwerbsbeteiligung des alleinerziehenden Elternteils besitzen Ein- Elternfamilien ein enorm hohes Armutsrisiko. Aufgrund dieser Problematik ist die Frage von Interesse, wodurch insbesondere Alleinerziehendenhaushalte einer so großen Gefahr ausgesetzt sind, unterhalb der Armutsgrenze leben zu müssen. Bei der Beantwortung dieser Frage spielt die aktuelle Situation von Ein- Elternfamilien in Deutschland eine wichtige Rolle. Bedeutsam ist, welche Aspekte das höhere Armutsrisiko in Alleinerziehendenhaushalten im Vergleich mit anderen Haushaltsformen bedingen. Des Weiteren ist die Untersuchung unterschiedlicher politischer Ausrichtungen, sozialer Unterstützungsleistungen, und -maßnahmen entscheidend, welche die Situation von Alleinerziehendenhaushalten positiv oder negativ beeinflussen können. Infolge der Analyse der Ursachen des erhöhten Armutsrisikos für diese Familienform, stellt sich schließlich die Frage, wie die Bekämpfung von Armut in Alleinerziehendenhaushalten erfolgreich gelingen kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinderarmut
- Messung relativer (Kinder-) Armut
- Kinderarmut in Deutschland
- Ursachen und Folgen von Kinderarmut
- Ursachen von Kinderarmut
- Folgen von Kinderarmut
- Kinderarmut in Alleinerziehendenhaushalten
- Aktuelle Situation Alleinerziehender in Deutschland
- Erwerbsarbeit in Alleinerziehendenhaushalten
- Leistungen und Maßnahmen der Bundesregierung gegen Kinderarmut
- Transferleistungen
- Direkte allgemeine Transferleistungen
- Transferleistungen für Haushalte von Alleinerziehenden
- Indirekte Maßnahmen gegen Kinderarmut
- Erfolgreiche Bekämpfung von Kinderarmut in Haushalten von Alleinerziehenden - Schweden als Vorbild
- Kinderarmut in verschiedenen Wohlfahrtregimes
- Effektive Sozial- und Familienpolitik
- Die Frauenerwerbsbeteiligung
- Die Betreuungssituation
- Arbeitsanreize für Geringverdienende und Mütter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Problematik der Kinderarmut in Alleinerziehendenhaushalten in Deutschland. Ziel ist es, die Ursachen für das erhöhte Armutsrisiko in dieser Familienstruktur zu analysieren und erfolgreiche Strategien zur Bekämpfung von Kinderarmut aufzuzeigen. Dabei werden verschiedene politische Maßnahmen und ihre Wirksamkeit betrachtet und ein Vergleich mit anderen Wohlfahrtregimes, insbesondere dem schwedischen System, gezogen.
- Kinderarmut in Deutschland
- Ursachen von Kinderarmut in Alleinerziehendenhaushalten
- Politische Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut
- Der Vergleich mit dem schwedischen Wohlfahrtsmodell
- Erfolgreiche Strategien zur Armutsreduzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition von Armut und der Messung relativer Armut anhand des Ressourcenansatzes. Dabei werden auch die Entwicklung und die aktuelle Situation der Kinderarmut in Deutschland beleuchtet. Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Ursachen von Kinderarmut in Haushalten mit Kindern analysiert, sowohl individuelle Risikofaktoren als auch landes- und bevölkerungsstrukturabhängige Einflüsse auf die Armutsrisikoquote. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Problematik der Armutsgefahr für Alleinerziehendenhaushalte in Deutschland, wobei die allgemeine Entwicklung und Struktur dieser Familienform sowie die schwierige Erwerbssituation alleinerziehender Eltern im Vordergrund stehen. Das fünfte Kapitel stellt die wichtigsten Maßnahmen vor, die in Deutschland zur Reduzierung von Kinderarmut in Alleinerziehendenhaushalten beitragen sollen, darunter direkte und indirekte Maßnahmen. Das sechste Kapitel analysiert verschiedene Wohlfahrtregimes und stellt Schweden als Beispiel für ein erfolgreiches sozialdemokratisches System dar, das die Armutsgefahr für Kinder in Alleinerziehendenhaushalten deutlich reduzieren konnte.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Alleinerziehende, Armutsrisiko, Wohlfahrtsstaat, Sozialpolitik, Transferleistungen, Erwerbsarbeit, Schweden, Familienpolitik, Lebenschancen, Entwicklungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Kinder in Alleinerziehendenhaushalten besonders armutsgefährdet?
Hauptgründe sind die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung für nur einen Elternteil sowie oft geringere Einkommen, selbst bei Erwerbstätigkeit.
Wie wird relative Kinderarmut in Deutschland gemessen?
Die Messung erfolgt meist über den Ressourcenansatz, wobei Haushalte als armutsgefährdet gelten, wenn sie weniger als 60 % des mittleren Äquivalenzeinkommens zur Verfügung haben.
Welche Folgen hat Kinderarmut für die Entwicklung?
Armut schränkt die Lebenschancen und Entwicklungsmöglichkeiten massiv ein, was sich negativ auf Bildung, Gesundheit und die soziale Teilhabe auswirkt.
Was macht das schwedische Modell bei der Armutsbekämpfung erfolgreicher?
Schweden setzt auf eine hohe Frauenerwerbsbeteiligung, eine flächendeckende Kinderbetreuung und eine effektive Sozial- und Familienpolitik, die Ein-Eltern-Familien gezielt unterstützt.
Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung gegen Kinderarmut?
Dazu gehören direkte Transferleistungen wie Kindergeld und Unterhaltsvorschuss sowie indirekte Maßnahmen zur Förderung der Erwerbstätigkeit und Betreuungsinfrastruktur.
- Quote paper
- Sarah Herznach (Author), 2012, Kinderarmut in Alleinerziehendenhaushalten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318215