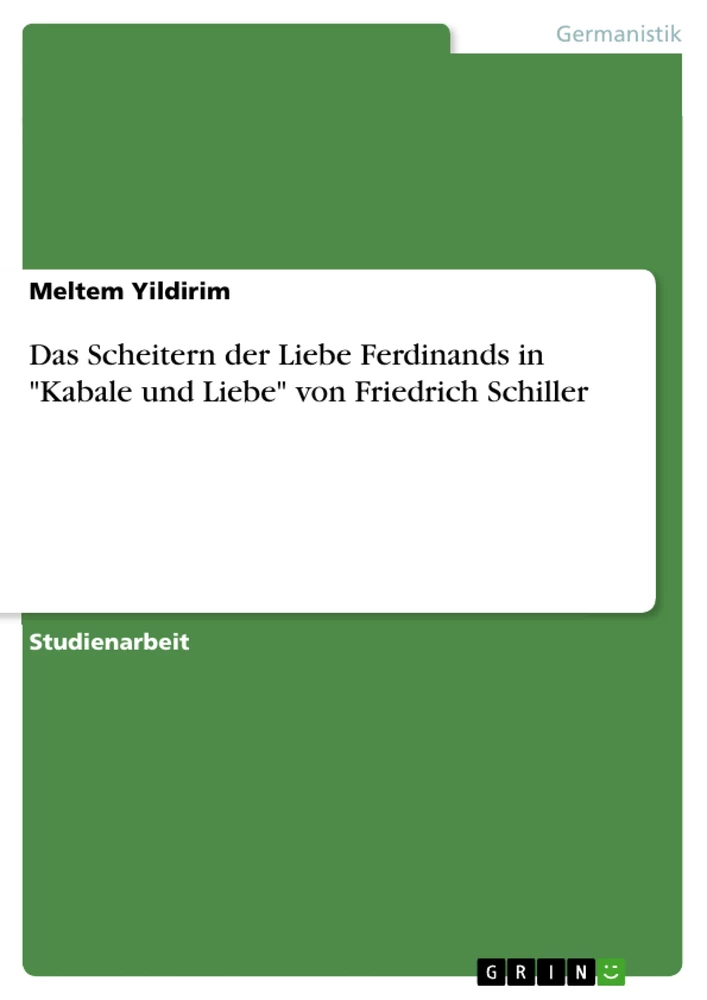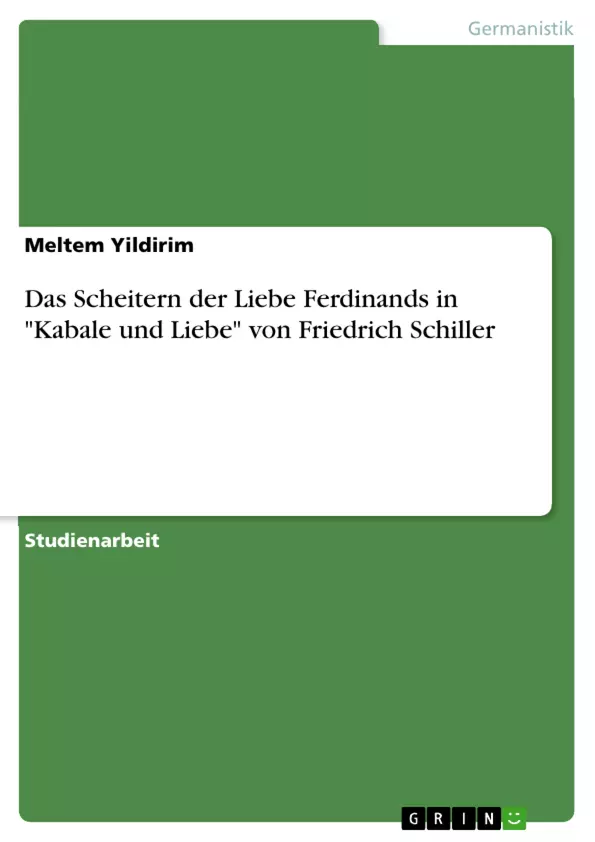Friedrich Schillers 1784 erschienenes Drama „Kabale und Liebe“ stellt die Tragödie der Liebe zwischen der Bürgertochter Luise Miller und dem Sohn des Präsidenten, Major Ferdinand von Walter, dar. Anfänglich scheint ihre Liebe über die ständischen Barrieren erhaben zu sein, doch zuletzt zerbricht sie.
Laut Struck kennzeichnen die Begriffe des Titels „Kabale und Liebe“, die beiden Haupthandlungsstränge, die, vielfach miteinander verwoben, auf die Katastrophe zulaufen würden. Ursprünglich benannte Schiller sein bürgerliches Trauerspiel nach der Hauptfigur Luise Millerin. Durch die Umbenennung des Titels wird die Aufmerksamkeit auf die Intrigen und die Liebe gelenkt. Die Frage ist, ob die Kabale, wie im Titel angedeutet, tatsächlich die entscheidende Rolle spielt oder die Tragödie nur erst ins Rollen bringt.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich darlegen, wie es zum Scheitern der Liebe kommt. Dabei setze ich den Fokus auf Ferdinand, seine Liebe zu Luise und auf die Formen, die diese Liebe annimmt. Auf Luises Position kann im Rahmen dieser Arbeit nur im Rande eingegangen werden. Zunächst stelle ich das Motiv der Liebe dar und veranschauliche anschließend den Begriff des Herzens. Hierbei werden die Erschwernisse der Liebenden erstmals skizziert und das Schlüsselwort des Dramas vorgestellt. Der dritte Teil widmet sich der Analyse der Liebe Ferdinands zu Luise. Anknüpfend wird das Liebesevangelium Ferdinands vorgestellt, in dessen Mittelpunkt Ferdinand als Idealist der Liebe gestellt wird und die Wortwahl der Liebenden von großer Bedeutung ist. Abschließend führe ich im fünften Teil Ferdinands Schuld am Scheitern der Liebe aus und beleuchte zum einen die inneren Schranken des Standes und zum anderen das Problem der Freiheit in Liebesbeziehungen. Ein Fazit schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Die Liebe zwischen Luise und Ferdinand
- Das Motiv der Liebe
- Der Begriff des Herzens
- 2. Ferdinands Liebesevangelium
- 3. Ferdinands Liebe zu Luise
- 4. Ferdinands Schuld
- Ursachen des Scheiterns
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert das Scheitern der Liebe zwischen Luise und Ferdinand in Schillers Drama „Kabale und Liebe". Der Fokus liegt dabei auf Ferdinands Liebe zu Luise und den Formen, die diese Liebe annimmt.
- Die Rolle des Standes und seiner inneren Schranken in Liebesbeziehungen
- Die Konzeption der „Herzenswelt“ im Drama und ihre Bedeutung für die Liebe
- Die Auswirkung der unterschiedlichen Lebensrealitäten auf die Liebe zwischen Luise und Ferdinand
- Die Verbindung von Vernunft und Gefühl im Kontext der Liebe und ihrer Bedeutung für das Drama
- Ferdinands Idealismus in der Liebe und seine Rolle im Scheitern der Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Drama „Kabale und Liebe“ ein und skizziert die zentralen Konflikte zwischen den Liebenden. Kapitel 1 analysiert die Liebe zwischen Luise und Ferdinand und führt den Begriff des Herzens als zentrale Metapher des Dramas ein.
Kapitel 2 widmet sich Ferdinands Liebesevangelium und präsentiert ihn als Idealisten der Liebe. Kapitel 3 untersucht Ferdinands Liebe zu Luise, die durch die ständischen Unterschiede erschwert wird.
Kapitel 4 beleuchtet Ferdinands Schuld am Scheitern der Liebe und analysiert die Ursachen des Scheiterns im Kontext von Standesdenken und Freiheit in Liebesbeziehungen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Liebe, Standesunterschiede, Herzenswelt, Idealismus, Schuld, Freiheit, Drama, „Kabale und Liebe“, Friedrich Schiller, Ferdinand, Luise, Bürgerliches Trauerspiel.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheitert die Liebe in Schillers „Kabale und Liebe“?
Das Scheitern liegt sowohl an den äußeren ständischen Barrieren (Kabale) als auch an Ferdinands inneren Schranken, seinem extremen Idealismus und seinem Misstrauen.
Welche Rolle spielt Ferdinand als „Idealist der Liebe“?
Ferdinand verfolgt ein „Liebesevangelium“, das die Liebe als absolut und überirdisch betrachtet, was ihn jedoch blind für die soziale Realität und Luises Nöte macht.
Was symbolisiert der Begriff des „Herzens“ im Drama?
Das Herz steht für die „Herzenswelt“ der Liebenden, einen privaten Raum der Gefühle, der im krassen Gegensatz zur korrupten Welt der höfischen Intrigen (Kabale) steht.
Trägt Ferdinand eine Mitschuld an der Katastrophe?
Ja, die Arbeit beleuchtet Ferdinands Schuld, da er sich durch die Intrigen manipulieren lässt und letztlich Luises Treue anzweifelt, was zum tragischen Ende führt.
Wie beeinflussen Standesunterschiede die Beziehung?
Die unüberbrückbare Kluft zwischen dem Adel (Ferdinand) und dem Bürgertum (Luise) schafft äußeren Druck, der die Liebe durch politische und familiäre Intrigen zerstört.
- Quote paper
- Meltem Yildirim (Author), 2015, Das Scheitern der Liebe Ferdinands in "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318232