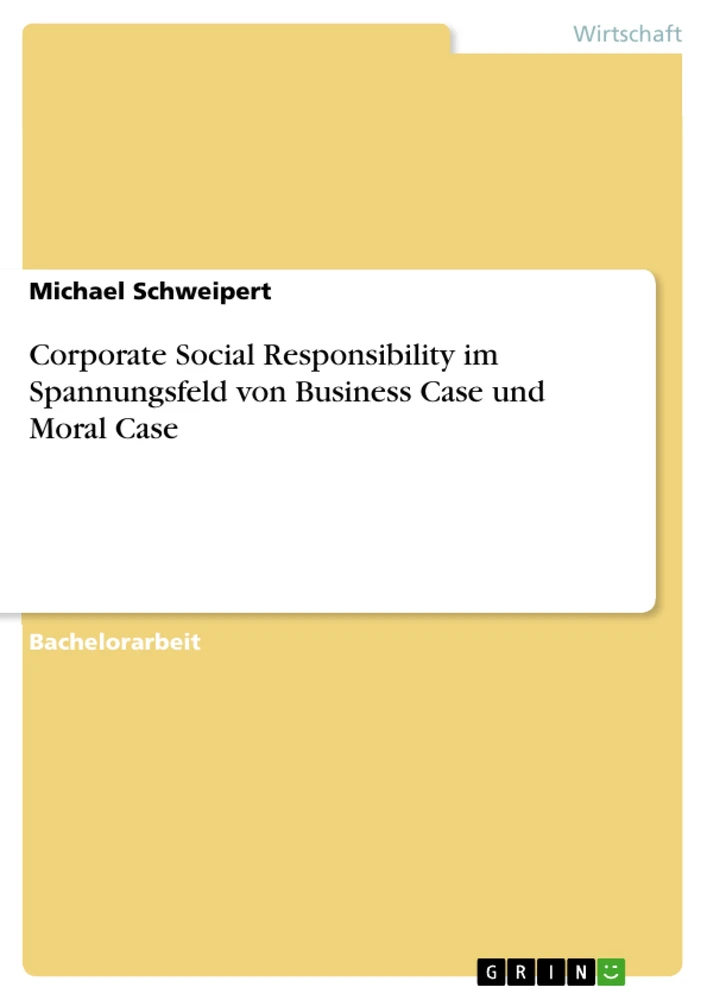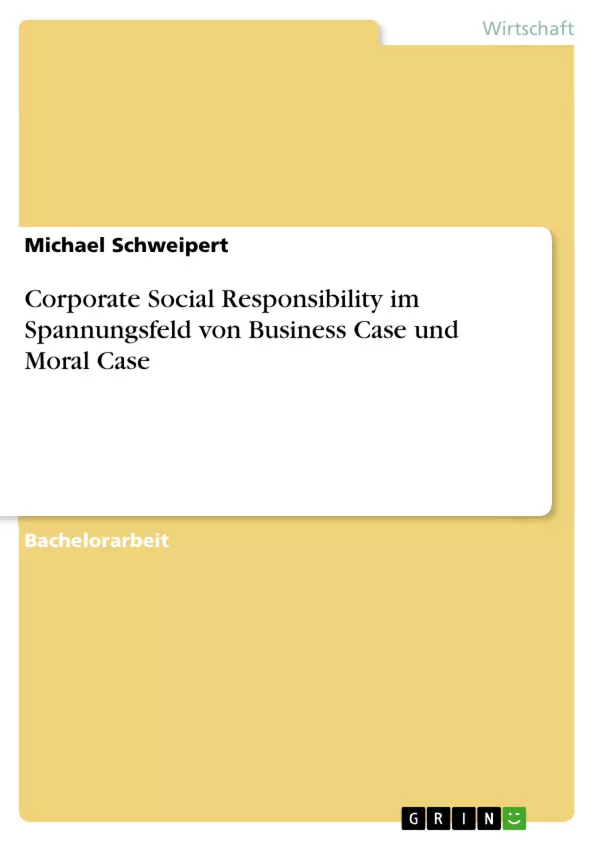Die vorliegende Arbeit wird, nach der Herleitung einer Definition des Untersuchungsgegenstandes CSR und einer Darstellung des Spannungsfeldes zwischen Business Case und Moral Case (Kapitel 2), diese beiden divergenten unternehmensethischen Positionen zu CSR in Kapitel 3 und 4 systematisch darstellen und kritisch würdigen. Anschließend wird in Kapitel 5 mittels einer kritisch vergleichenden Analyse der Versuch eines Brückenschlags zwischen beiden Positionen unternommen.
Weil Unternehmen in hohem Maße zur Verbesserung oder Verschlechterung der ökologischen, sozialen oder ökonomischen Situation einer Gesellschaft beitragen können, sind sie gleichzeitig Adressat großer Hoffnungen und Befürchtungen. In Anbetracht dieser Machtsituation zwischen privater Wirtschaft und Nationalstaaten steigen auch die Erwartungen an den Wirtschaftssektor vermehrt Verantwortung für gesellschaftliche Probleme zu übernehmen und das entstandene Machtvakuum gewissenhaft zu füllen.
Eine Unternehmensethik in diesem Sinne ist dabei nicht frei von inneren Spannungen. Während der Staat über Steuern, Abgaben und die Erhöhung der Staatsverschuldung Einkommen generiert, muss der private Wirtschaftssektor zunächst einmal Gewinn erwirtschaften, um seinen dauerhaften Bestand zu sichern. Lange wurde deshalb die Verknüpfung von finanziellem Erfolg und der Übernahme von Verantwortung als ein Oxymoron bezeichnet. Man müsse sich eben entscheiden, entweder Gewinn oder Ethik. Nach dieser Lesart ist die Übernahme von Verantwortung den guten Zeiten vorbehalten, während in schlechten Zeiten die Moral schlicht nicht zu finanzieren ist.
Im Bewusstsein dieses Problems haben sich zwei divergente Positionen zu CSR herausgebildet. Auf der einen Seite der sog. Business Case, der mittels einer ökonomischen Instrumentalisierung von moralischen Wertvorstellungen aus dem Kostenfaktor Ethik, einen Erfolgsfaktor Ethik machen will. Klug umgesetzte Ethik koste demnach kein Geld, sondern lasse sich vielmehr zum Motor des ökonomischen Erfolgs machen. Auf der anderen Seite steht der sog. Moral Case, der eingesteht: Ja, Ethik kostet Geld! Aber der private Wirtschaftssektor sei eben nicht nur der eigenen Gewinnmaximierung, sondern als gesellschaftliche Institution auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Verantwortbar sei eben nicht der maximale, sondern der legitime Gewinn, welcher oftmals genügend Raum für ein erfolgreiches Wirtschaften lasse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Corporate Social Responsibility – Annäherung an einen Begriff
- Definitionen in Politik, Praxis und Literatur
- Systematisierung von CSR
- Das Spannungsfeld zwischen Business Case und Moral Case
- CSR als Business Case
- Die Theorie des Business Case
- Unternehmerisches Handeln als Verantwortungsgegenstand
- Moralische Konflikte entlang der Wertschöpfungskette
- Die moralische Qualität der Wertschöpfungsaufgabe
- Die Schaffung neuer Märkte
- Social Entrepreneurship – Die Moral als Markenkern
- CSR jenseits der Wertschöpfung
- Mögliche Erfolgswirkungen von CSR
- Vorökonomische Erfolgswirkungen
- Ökonomische Erfolgswirkungen
- Problematik einer empirischen Überprüfung des Business Case
- Der differenzierte CSP-/CFP-Link
- Kritische Würdigung
- CSR als Moral Case
- Kritik am Gewinnprinzip und an der Ideologie des freien Marktes
- Integrative Unternehmensethik
- Das dualistische Grundmodell der Unternehmung
- Der ethische Integrationsgrad
- Der Stakeholder-Ansatz des Responsible Leadership
- Der Integrity Case
- Kritische Würdigung
- Der Brückenschlag zwischen Business Case und Moral Case
- Die normative Unzulänglichkeit des Business Case
- Der moralisch fundierte Business Case
- Fazit
- Definition und Systematisierung von CSR
- Der Business Case: Ökonomische Instrumentalisierung von Ethik
- Der Moral Case: Ethische Verpflichtung und Gemeinwohlorientierung
- Kritische Analyse der beiden Positionen
- Der Brückenschlag zwischen Business Case und Moral Case
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) und analysiert die beiden zentralen Positionen im Spannungsfeld zwischen Business Case und Moral Case. Sie zielt darauf ab, die jeweiligen Argumente und Herausforderungen dieser Ansätze zu beleuchten und mögliche Brücken zwischen ihnen aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der Corporate Social Responsibility und erläutert die Bedeutung des Konzepts im Kontext der globalen Entwicklungen. Kapitel 2 nähert sich dem Begriff CSR anhand von Definitionen aus Politik, Praxis und Literatur und stellt das Spannungsfeld zwischen Business Case und Moral Case dar. In den Kapiteln 3 und 4 werden die beiden Positionen des Business Case und des Moral Case systematisch dargestellt und kritisch gewürdigt. Kapitel 5 schließlich unternimmt einen Versuch, die beiden Positionen mittels einer vergleichenden Analyse zu verbinden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Corporate Social Responsibility, der Unternehmensethik, dem Spannungsfeld zwischen Business Case und Moral Case, den ethischen Aspekten der Wertschöpfungskette, der Kritik am Gewinnprinzip und der Bedeutung des Gemeinwohls.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem Business Case und dem Moral Case bei CSR?
Der Business Case sieht Ethik als Erfolgsfaktor zur Gewinnmaximierung ("Ethik zahlt sich aus"). Der Moral Case hingegen betrachtet Unternehmen als gesellschaftliche Institutionen, die eine ethische Verpflichtung zum Gemeinwohl haben, auch wenn dies Kosten verursacht.
Was bedeutet "legitimer Gewinn" im Kontext des Moral Case?
Ein legitimer Gewinn ist nicht der maximal mögliche Gewinn, sondern ein Ertrag, der unter Einhaltung ethischer Standards und Rücksichtnahme auf die Interessen der Gesellschaft erwirtschaftet wurde.
Wie kann Moral zum Markenkern werden?
Dies geschieht häufig im Social Entrepreneurship, wo die Lösung eines gesellschaftlichen oder ökologischen Problems das primäre Unternehmensziel ist und die Moral somit die Grundlage des Geschäftsmodells bildet.
Warum ist die empirische Überprüfung des Business Case schwierig?
Es ist komplex, einen direkten ursächlichen Zusammenhang zwischen sozialer Verantwortung (CSP) und finanziellem Erfolg (CFP) wissenschaftlich eindeutig nachzuweisen, da viele externe Faktoren eine Rolle spielen.
Was ist das Ziel eines "Brückenschlags" zwischen beiden Positionen?
Der Brückenschlag versucht, die ökonomische Logik des Business Case mit der normativen Fundierung des Moral Case zu verbinden, um eine nachhaltige und glaubwürdige Unternehmensethik zu schaffen.
- Citar trabajo
- Michael Schweipert (Autor), 2016, Corporate Social Responsibility im Spannungsfeld von Business Case und Moral Case, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318353