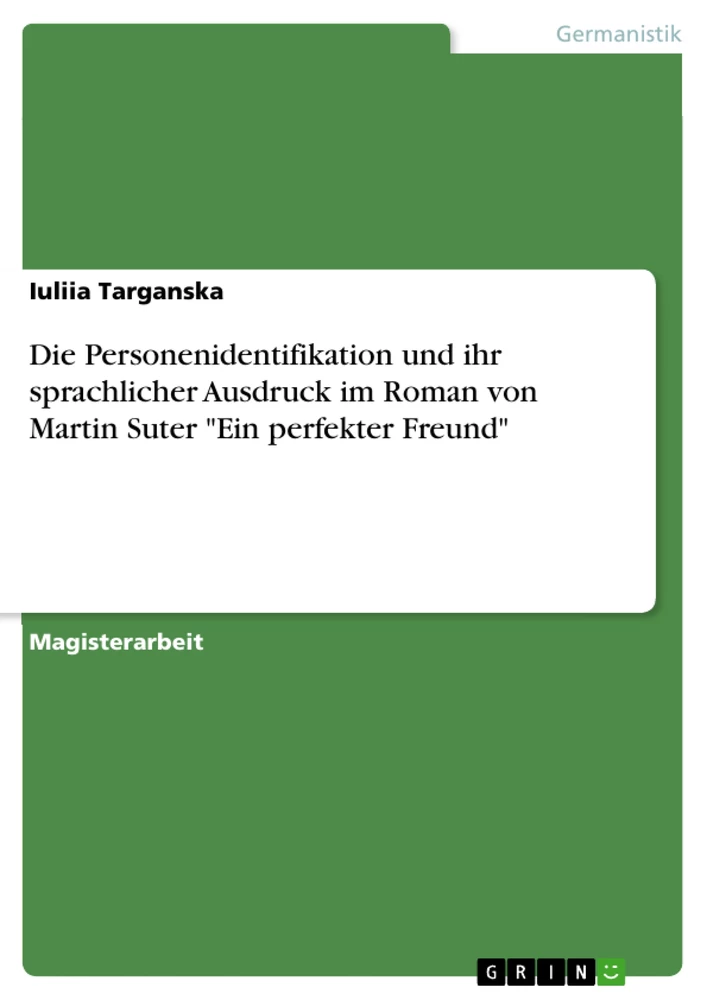Das Ziel der Magisterarbeit ist die Analyse der häufigsten lexikalischen Mittel, die Martin Suter im Roman verwendet, die das Problem der Personenidentifikation ausdrücken.
Dem Ziel entsprechend ist die Magisterarbeit in 2 Teile eingeteilt.
Im theoretischen Teil wird das Problem der Personenidentität in der gegenwärtigen Literaturwissenschaft am Beispiel des Romans von Martin Suter behandelt. Es werden die Identifikationsarten und ihre Voraussetzungen gezeigt, die Beziehungen der Persönlichkeit zu der Gesellschaft im Roman "Ein perfekter Freund“ und Motive als Bestandteile des Themas Identität im Roman betrachtet.
Im praktischen Teil wird die Analyse der sprachlichen Mittel vorgenommen, die zum Ausdruck von Motiven der Personenidentifikation im Roman gebraucht werden. Zuerst werden kurz die sprachlichen Mittel im Werk des Schriftstellers betrachtet. Genauer werden die Mittel zum Ausdruck der Motive analysiert. Hier werden folgende Motive behandelt: die Erlangung des alten Aussehens, die Heilung, das Zurückkehren zur Berufsarbeit und die Wiederherstellung des „Ichs“.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. Das Problem der Identität.
- 1. 1. Martin Suter als Vertreter der Schweizer Gegenwartsliteratur.
- 1.1.1. Die Schweizer Gegenwartsliteratur.
- 1.1.2. Suters psychologischer Roman mit den Elementen eines Kriminalwerkes
- 1.2. Personenidentifizierung als literarisches Problem
- 1.2.1. Arten der Identifikation
- 1.2.2.Gedächtnis und Erinnerung als Voraussetzung der Identifikation
- 1.3. Das Problem der Identität im Roman „Ein perfekter Freund“.
- 1.3.1. Gedächtnis- und Identitätsverlust im Roman
- 1.3.2.Motive des Themas Personenidentifikation.......
- II. Sprachlicher Ausdruck der Personenidentifikation im Roman von M.Suter.
- 2.1. Sprachliche Mittel im Werk von M. Suter.
- 2.2. Sprachlicher Ausdruck der Motive des Themas Identitätsbildung im Roman
- 2.2.1. Das Kernmotiv: Die Erlangung des alten Aussehens
- 2.2.2. Das Kernmotiv: Die Heilung.……………....
- 2.2.3. Das Kernmotiv: Das Zurückkehren zur Berufsarbeit
- 2.2.4. Das Kernmotiv: Die Wiederherstellung des „Ichs“
- Schlussfolgerungen
- Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Magisterarbeit befasst sich mit dem Thema der Personenidentifikation und ihrer sprachlichen Darstellung im Roman „Ein perfekter Freund“ von Martin Suter. Die Forschungsarbeit analysiert die sprachlichen Mittel, die zur Ausdrucksweise des Problems „Personenidentifikation“ im Roman verwendet werden.
- Die Identifikationsarten und ihre Voraussetzungen im Roman
- Die Beziehung der Persönlichkeit zur Gesellschaft im Roman „Ein perfekter Freund“
- Motive als Bestandteile des Themas Identität im Roman
- Die Analyse der sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Motiven der Personenidentifikation
- Die Betrachtung verschiedener Kernmotive im Roman, z.B. die Erlangung des alten Aussehens, die Heilung, das Zurückkehren zur Berufsarbeit und die Wiederherstellung des „Ichs“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung präsentiert das Thema der Magisterarbeit und die Relevanz der Personenidentifikation in der Literatur. Es werden wichtige Wissenschaftler genannt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Problem der Identität. Es werden Martin Suter als Vertreter der Schweizer Gegenwartsliteratur und die Schweizer Gegenwartsliteratur im Allgemeinen behandelt. Es werden die verschiedenen Arten der Identifikation, die Rolle des Gedächtnisses und der Erinnerung sowie die Schwierigkeiten der Identität im Roman „Ein perfekter Freund“ analysiert.
Das zweite Kapitel widmet sich dem sprachlichen Ausdruck der Personenidentifikation. Zuerst werden die sprachlichen Mittel im Werk von Martin Suter allgemein betrachtet. Anschließend werden die sprachlichen Mittel zur Darstellung der verschiedenen Motive des Themas Identität im Roman untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Welches literarische Werk wird in dieser Magisterarbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert den Roman „Ein perfekter Freund“ des Schweizer Autors Martin Suter.
Was ist das zentrale Thema der Untersuchung?
Im Mittelpunkt steht die Personenidentifikation und deren sprachlicher Ausdruck im Kontext von Identitätsverlust und Gedächtnisstörungen.
Welche Rolle spielen Gedächtnis und Erinnerung im Roman?
Gedächtnis und Erinnerung werden als grundlegende Voraussetzungen für die Identifikation einer Person und die Wiederherstellung des „Ichs“ betrachtet.
Welche Motive der Identitätsbildung werden sprachlich untersucht?
Untersucht werden die Motive der Erlangung des alten Aussehens, der Heilung, der Rückkehr zur Berufsarbeit und der psychischen Ich-Wiederherstellung.
Wie wird Martin Suter literarisch eingeordnet?
Suter wird als Vertreter der Schweizer Gegenwartsliteratur betrachtet, der psychologische Romane mit Elementen des Kriminalgenres verbindet.
- Citation du texte
- Iuliia Targanska (Auteur), 2015, Die Personenidentifikation und ihr sprachlicher Ausdruck im Roman von Martin Suter "Ein perfekter Freund", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318372