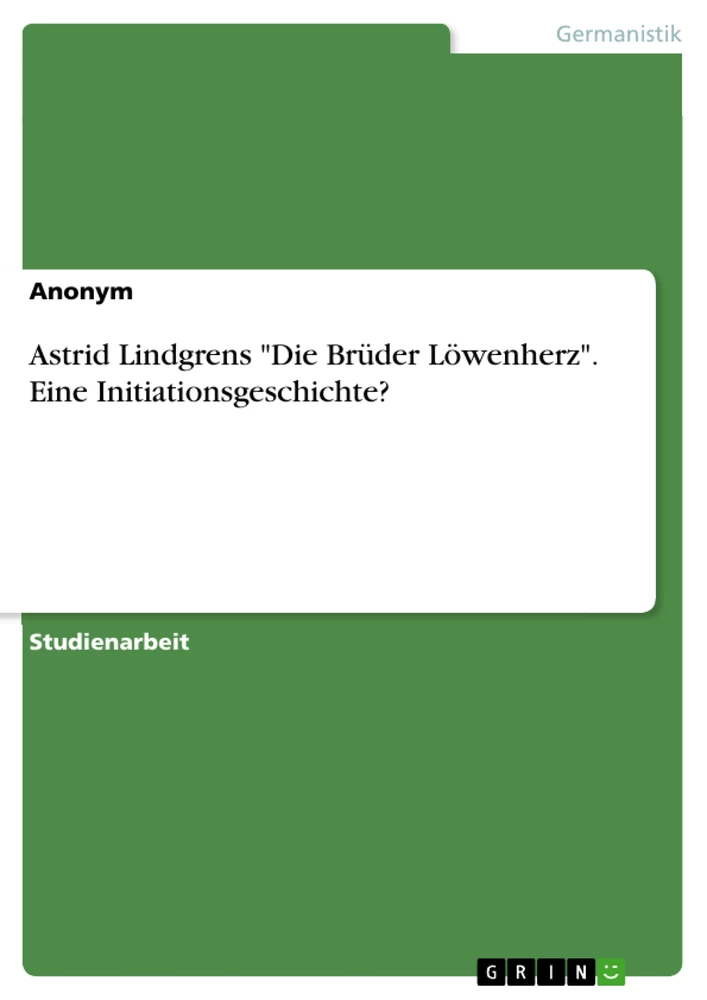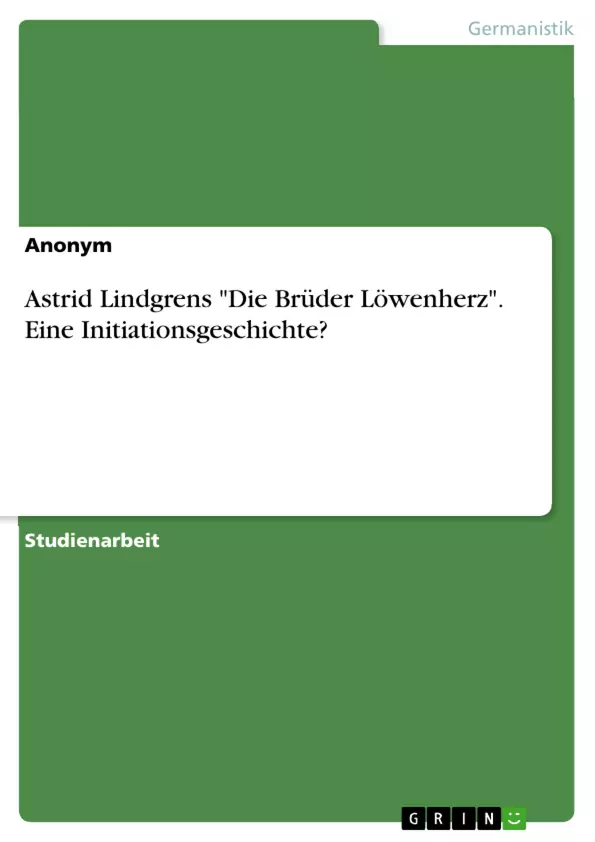In der vorliegenden Arbeit soll der von Astrid Lindgren verfasste Roman „Die Brüder Löwenherz“, anhand diverser Kennzeichen nach Michael Titzmann, dahingehend analysiert werden, inwiefern es sich bei der Geschichte um eine Initiationsgeschichte im Sinne der Definition handelt.
Der Strukturalist und Wissenschaftler Michael Titzmann bildete dazu eine Definition heraus, die auf der Theorie von van Genneps basiert. In Hinblick auf Erzähltexte der Goethezeit und unter Einbezug Genneps Theorien etabliert Michael Titzmann den Begriff „Initiationsgeschichte“. Dabei hat Titzmann „Erzählmuster vorgeschlagen, die strukturell einer Initiation gleichen.“
Damit der Prozess der Initiation in Anlehnung an Titzmann als erfolgreich gilt, müssen drei Schritte im Roman stattfinden. Die erste Phase zeichnet sich durch eine Ablösung von einem sozialen Ausgangssystems aus. Ein soziales Ausgangssystem im Roman kann beispielsweise die Herkunftsfamilie darstellen. Im zweiten Schritt findet die Phase des Experimentierens statt, wobei hier „der Initiand jedoch der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt“ ist und der Initiand gleichzeitig entweder eine Selbstfindung oder einen Selbstverlust erlebt. Der Endzustand und somit die letzte Phase in einer Initiationsgeschichte bildet die soziale Reintegration, nachdem sich der Initiand „kurzzeitig in einen außersozialen Zustand“ begeben hat.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Handlung
- Erzähltextstruktur
- Zentrale Figuren
- Karl Löwe (Krümel)
- Jonathan Löwe (Löwenherz)
- Bewertung und Einordnung weiterer Figuren
- Motive und Symbolik
- Topographie und semantische Räume
- Initiationsmuster im Roman
- Phase der Ablösung vom sozialen Ausgangssystem
- Phase des Experimentierens
- Soziale Reintegration
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der vorliegende Essay analysiert den Roman „Die Brüder Löwenherz“ von Astrid Lindgren mit dem Ziel, die Geschichte als eine Initiationsgeschichte im Sinne von Michael Titzmann zu interpretieren und zu beleuchten. Dabei werden die Elemente der Erzähltextstruktur und die zentralen Figuren sowie deren Entwicklung im Kontext der Handlung analysiert.
- Der Umgang mit dem Thema Tod und Sterben in der Kinderliteratur
- Die Darstellung von Bruderliebe und Freundschaft
- Die Analyse von Initiationsmustern in der Geschichte
- Die Bedeutung von Fantasie und Flucht in die Traumwelt
- Die Herausarbeitung des Kontrasts zwischen der realen Welt und der Fantasiewelt Nangijala
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik des Romans „Die Brüder Löwenherz“ ein und beleuchtet die Bedeutung des Buches im Kontext der Kinder- und Jugendliteratur. Sie analysiert die Textsorte Phantastik und definiert den Begriff im Vergleich zum Märchen.
Die Handlung des Romans wird detailliert nacherzählt und zeigt die Brüder Karl und Jonathan in ihrem Alltag und ihrer besonderen Beziehung zueinander. Das Sterben des jüngeren Bruders Karl und dessen Reise ins Land Nangijala bildet den zentralen Konflikt der Geschichte.
Im Kapitel zur Erzähltextstruktur wird die Chronologie und die zeitdeckende Darstellung des Romans beleuchtet. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Karl erzählt, wobei die Ich-Erzählsituation eine kindliche und naive Sichtweise vermittelt.
Die zentralen Figuren Karl und Jonathan werden näher vorgestellt und ihre Entwicklung im Verlauf der Geschichte wird dargestellt. Weitere wichtige Figuren und deren Bedeutung im Kontext des Romans werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Essays sind: „Die Brüder Löwenherz“, Astrid Lindgren, Initiationsgeschichte, Phantastik, Kinder- und Jugendliteratur, Tod, Sterben, Bruderliebe, Freundschaft, Nangijala, Traumwelt, Reintegration, Selbstfindung, Figurenanalyse, Erzähltextstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Gilt „Die Brüder Löwenherz“ als Initiationsgeschichte?
Ja, die Arbeit analysiert den Roman nach den Kriterien von Michael Titzmann und zeigt auf, wie die Brüder Phasen der Ablösung, des Experimentierens und der Reintegration durchlaufen.
Was ist das Land Nangijala?
Nangijala ist eine phantastische Welt, in die die Brüder nach ihrem Tod gelangen. Sie dient als Ort der Abenteuer, aber auch der Bewährung und Selbstfindung.
Wie geht Astrid Lindgren mit dem Thema Tod um?
Lindgren bricht das Tabu des Todes in der Kinderliteratur, indem sie ihn als Beginn einer neuen Reise darstellt, ohne dabei die Ängste und die Trauer zu verschweigen.
Wer ist der Ich-Erzähler im Roman?
Die Geschichte wird aus der Perspektive des jüngeren Bruders Karl (genannt „Krümel“) erzählt, was eine naive und kindliche Sichtweise ermöglicht.
Welche Rolle spielt Jonathan Löwenherz für seinen Bruder?
Jonathan ist die Beschützerfigur und das Vorbild. Er nimmt Karl die Angst vor dem Sterben und führt ihn durch die Gefahren in Nangijala.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Astrid Lindgrens "Die Brüder Löwenherz". Eine Initiationsgeschichte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318416