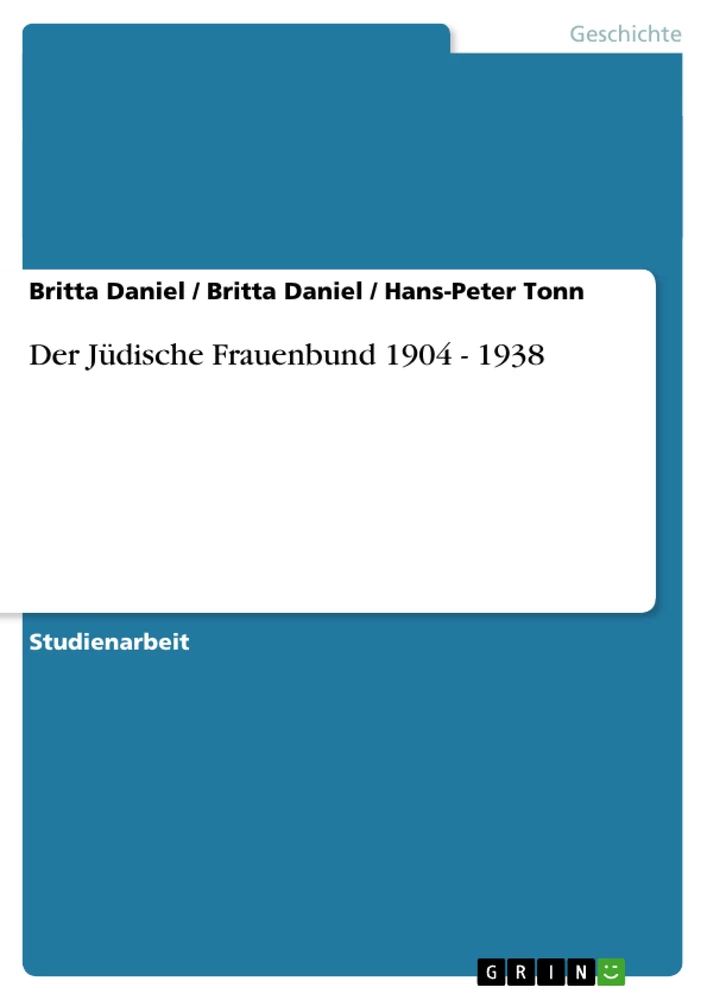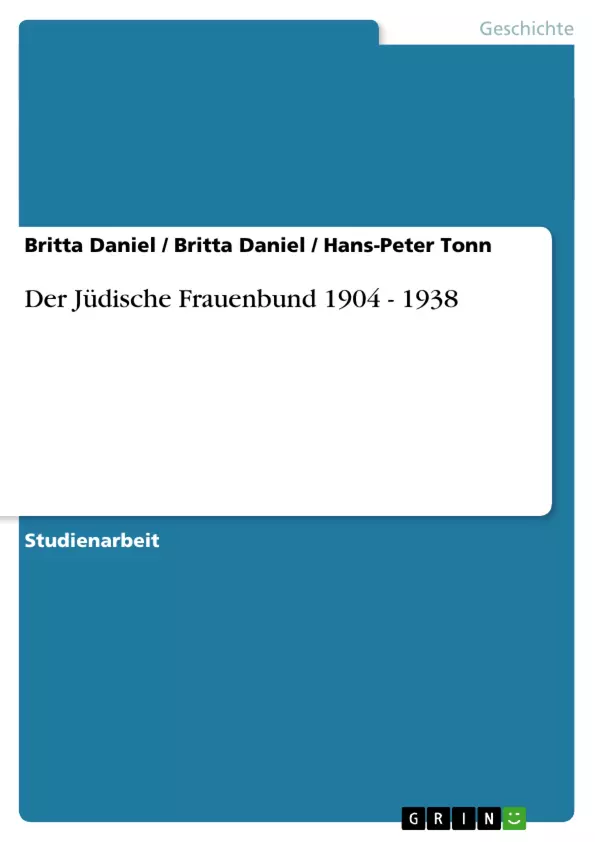Das Thema der vorliegenden Studienleistung ist der Jüdische Frauenbund von 1904 bis 1938 in Deutschland und seine Bedeutung für die Soziale Arbeit.
Oft werden im Zusammenhang mit der Geschichte Sozialer Arbeit Namen wie Alice Salomon genannt, berühmte Frauennamen, mit denen sogar Schulen betitelt werden. Kaum jemand kennt jedoch die Geschichte dieser Frauen und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit. Im Rahmen dieser Studienleistung wollen wir einige von ihnen näher vorstellen.
Bereits bei der Literaturrecherche in der Bibliothek wie auch im Internet stellten wir fest, dass es zum Jüdischen Frauenbund bis heute sehr wenige Publikationen gibt. Zu den wichtigsten Publikationen gehören nach unserer Ansicht die 1981 erschienene ausführliche Darstellung von Marion Kaplan, "Jüdinnen in der deutschen Frauenbewegung" von Irmgard Maya Fassmann und "Bürgerliche Frauenbewegung und Antisemitismus" von Mechthild Bereswill und Leonie Wagner.
Zu Beginn unserer Studienleistung werden wir auf ethnische Hintergründe der jüdischen Religion eingehen, die für die Gründung des jüdischen Frauenbundes von Bedeutung waren. Im zweiten Kapitel werden wir die Geschichte des Jüdischen Frauenbundes von 1904 bis 1938 zusammenfassen, um dann im dritten Kapitel näher auf die Organisationsstruktur und die Ziele des jüdischen Frauenbundes einzugehen.
Im vierten Kapitel möchten wir die Gründerpersönlichkeit der Bertha Pappenheim näher vorstellen, da sie eine sehr prägende Rolle im Jüdischen Frauenbund einnahm.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frauen und Wohltätigkeit im Judentum
- Die Stellung der Frau im Judentum
- Die Bedeutung der "Wohltätigkeit" in der jüdischen Religion
- Geschichte des Jüdischen Frauenbundes
- Vorläufer des jüdischen Frauenbundes
- Gründung des jüdischen Frauenbundes
- Organisation des Jüdischen Frauenbundes
- Aufbau und Finanzierung des Jüdischen Frauenbundes
- Ziele des Jüdischen Frauenbundes
- Bertha Pappenheim - Gründerin des Jüdischen Frauenbundes
- Fazit
- Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienleistung untersucht den Jüdischen Frauenbund (1904-1938) in Deutschland und seine Bedeutung für die Soziale Arbeit. Sie beleuchtet die historischen, sozialen und religiösen Hintergründe der Gründung und Entwicklung des Bundes, fokussiert auf die Rolle jüdischer Frauen in der Wohlfahrtspflege und präsentiert die Bedeutung von Bertha Pappenheim als Gründerin. Die Arbeit basiert auf einer limitierten, aber sorgfältig ausgewählten Literaturbasis und Online-Ressourcen.
- Die Stellung der Frau im Judentum im 19. Jahrhundert
- Die Rolle von Wohltätigkeit und sozialem Engagement im jüdischen Glauben
- Die Geschichte und Entwicklung des Jüdischen Frauenbundes
- Die Organisationsstruktur und Ziele des Jüdischen Frauenbundes
- Die Bedeutung von Bertha Pappenheim für den Jüdischen Frauenbund
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert das Thema der Studienarbeit – den Jüdischen Frauenbund von 1904 bis 1938 – und seine Relevanz für die Soziale Arbeit. Sie beschreibt die Schwierigkeiten bei der Literaturrecherche und benennt wichtige Quellen, inklusive Internetressourcen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, wobei die einzelnen Kapitel und ihre Inhalte kurz vorgestellt werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Knappheit an Publikationen zum Thema und der Bedeutung des 100-jährigen Jubiläums des Bundes für ein mögliches breiteres Medieninteresse.
Frauen und Wohltätigkeit im Judentum: Dieses Kapitel analysiert die Situation jüdischer Frauen im 19. Jahrhundert, besonders aus der bürgerlichen Schicht, und ihre Rolle im Kontext von Religion und gesellschaftlichen Normen. Es wird die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau im orthodoxen Judentum detailliert dargestellt, wobei die Rolle der Frau als "Priesterin des Hauses" und ihre Aufgaben bezüglich religiöser Rituale und Haushaltsführung hervorgehoben werden. Der Text beleuchtet die Ausgrenzung von Frauen aus Bildung und Beruf, die Bedeutung der Wohltätigkeit als Möglichkeit des gesellschaftlichen Engagements und die Herausforderungen, denen Frauen im Kontext von Ehe und Scheidung begegneten. Der Wandel in der Haushaltsführung durch den technischen Fortschritt und die damit einhergehende Veränderung der Rolle der Frau im Bürgertum werden ebenso betrachtet.
Geschichte des Jüdischen Frauenbundes: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Jüdischen Frauenbundes, beginnend mit seinen Vorläufern im 19. Jahrhundert. Es werden frühe Wohltätigkeitsorganisationen und Frauengruppen beschrieben, die sich mit Armenfürsorge, Krankenpflege und der Versorgung verstorbener Frauen befassten. Die Gründung von Brautausstattungsvereinen wird im Kontext der gesellschaftlichen Normen und der eingeschränkten beruflichen Möglichkeiten für Frauen erklärt. Der Einfluss emanzipatorischer Bestrebungen und die Rolle von Persönlichkeiten wie Rosa Vogelstein werden im Hinblick auf die Herausbildung des Jüdischen Frauenbundes diskutiert.
Schlüsselwörter
Jüdischer Frauenbund, Soziale Arbeit, jüdische Frauen, Wohltätigkeit, Bertha Pappenheim, 19. Jahrhundert, Judentum, Emanzipation, bürgerliche Gesellschaft, religiöse Tradition, Geschichte der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Jüdischen Frauenbund (1904-1938)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Studienarbeit untersucht den Jüdischen Frauenbund in Deutschland von 1904 bis 1938 und seine Bedeutung für die Soziale Arbeit. Sie beleuchtet die historischen, sozialen und religiösen Hintergründe seiner Gründung und Entwicklung, fokussiert auf die Rolle jüdischer Frauen in der Wohlfahrtspflege und die Bedeutung Bertha Pappenheims als Gründerin.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Stellung der Frau im Judentum des 19. Jahrhunderts, die Rolle von Wohltätigkeit und sozialem Engagement im jüdischen Glauben, die Geschichte und Entwicklung des Jüdischen Frauenbundes, seine Organisationsstruktur und Ziele sowie die Bedeutung Bertha Pappenheims für den Bund. Die Schwierigkeiten der Literaturrecherche und die Knappheit an Publikationen zum Thema werden ebenfalls angesprochen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Frauen und Wohltätigkeit im Judentum, Geschichte des Jüdischen Frauenbundes, Organisation des Jüdischen Frauenbundes, Bertha Pappenheim - Gründerin des Jüdischen Frauenbundes, Fazit und Quellenangaben. Jedes Kapitel wird kurz in der Zusammenfassung der Kapitel beschrieben.
Wie wird die Situation jüdischer Frauen im 19. Jahrhundert dargestellt?
Das Kapitel "Frauen und Wohltätigkeit im Judentum" analysiert die Situation jüdischer Frauen im 19. Jahrhundert, insbesondere aus der bürgerlichen Schicht, und ihre Rolle im Kontext von Religion und gesellschaftlichen Normen. Es beschreibt die traditionelle Arbeitsteilung, die Ausgrenzung von Frauen aus Bildung und Beruf und die Bedeutung der Wohltätigkeit als Möglichkeit des gesellschaftlichen Engagements.
Welche Rolle spielte die Wohltätigkeit im Judentum?
Die Arbeit betont die Bedeutung der Wohltätigkeit ("Zedaka") im jüdischen Glauben und zeigt auf, wie sie für jüdische Frauen eine Möglichkeit des gesellschaftlichen Engagements darstellte, trotz ihrer eingeschränkten Möglichkeiten in Bildung und Beruf. Der Wandel in der Haushaltsführung durch den technischen Fortschritt und die damit einhergehende Veränderung der Rolle der Frau im Bürgertum werden ebenfalls betrachtet.
Wie wird die Geschichte des Jüdischen Frauenbundes dargestellt?
Das Kapitel zur Geschichte des Jüdischen Frauenbundes beschreibt die Entwicklung des Bundes, beginnend mit seinen Vorläufern im 19. Jahrhundert. Es werden frühe Wohltätigkeitsorganisationen und Frauengruppen beschrieben und der Einfluss emanzipatorischer Bestrebungen sowie die Rolle von Persönlichkeiten wie Rosa Vogelstein diskutiert.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer limitierten, aber sorgfältig ausgewählten Literaturbasis und Online-Ressourcen. Die Einleitung erwähnt die Schwierigkeiten bei der Literaturrecherche und benennt wichtige Quellen, inklusive Internetressourcen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jüdischer Frauenbund, Soziale Arbeit, jüdische Frauen, Wohltätigkeit, Bertha Pappenheim, 19. Jahrhundert, Judentum, Emanzipation, bürgerliche Gesellschaft, religiöse Tradition, Geschichte der Sozialen Arbeit.
Welche Bedeutung hat Bertha Pappenheim für den Jüdischen Frauenbund?
Die Arbeit hebt die Bedeutung Bertha Pappenheims als Gründerin des Jüdischen Frauenbundes hervor und untersucht ihre Rolle im Kontext der Geschichte und Entwicklung des Bundes.
Welche Ziele verfolgte der Jüdische Frauenbund?
Die Ziele des Jüdischen Frauenbundes werden im Kapitel zur Organisation des Bundes beschrieben. Die Arbeit analysiert den Aufbau und die Finanzierung des Bundes sowie seine konkreten Ziele in der sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Britta Daniel (Author), Britta Daniel (Author), Hans-Peter Tonn (Author), 2004, Der Jüdische Frauenbund 1904 - 1938, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31849