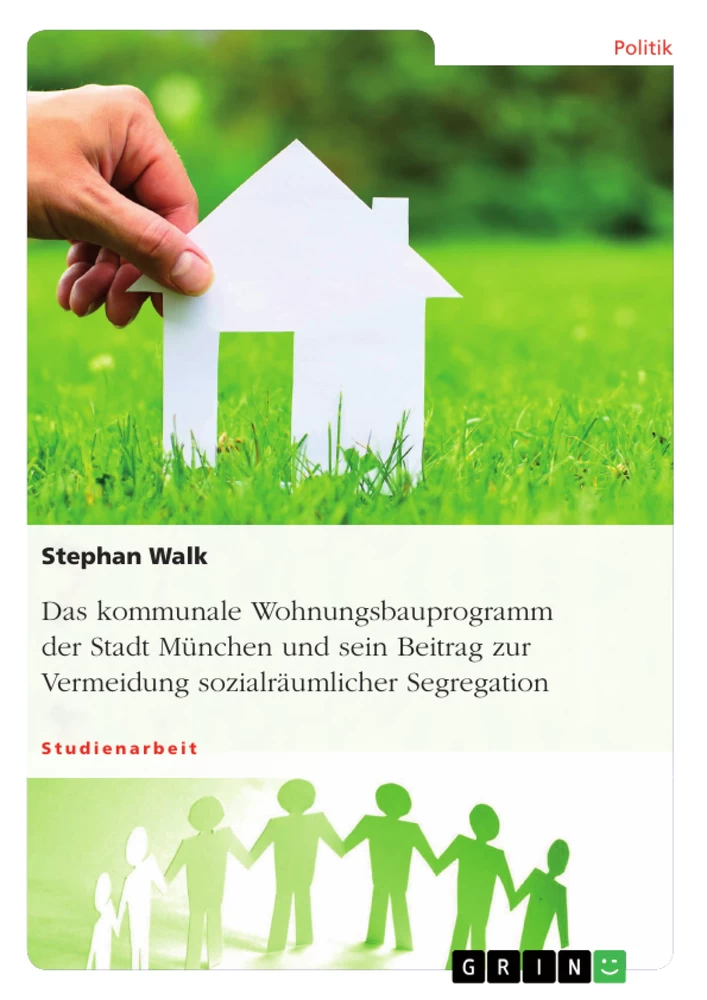Die vorliegende Hausarbeit soll die Frage, wie das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München sozialräumlicher Segregation entgegenwirkt, beantworten. Dabei wird es zunächst sinnvoll sein, zu klären, was sozialräumliche Segregation ist und wie sie entsteht, um sodann auf das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München mit seinen unterschiedlichen Teilprogrammen, die sich an differente Zielgruppen richten, einzugehen.
Abschließend soll die Frage beleuchtet werden, welchen konkreten Beiträge das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München zur Vermeidung von sozialräumlicher Segregation leistet. Angrenzend daran möchte ich die Schnittstellen der Profession Soziale Arbeit beleuchten und gebe eine persönliche Einschätzung für den wohnungsbaupolitischen Handlungsbedarf in der Zukunft ab.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1.0. Einleitung
- 2.0. Was ist sozialräumliche Segregation und wie entsteht sie?
- 3.0. Das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München im Fokus
- 4.0. Der sozialräumlichen Segregation in München entgegenwirken, mithilfe des KomPro - wie geht das konkret?
- 5.0. Wo sind für die Soziale Arbeit Schnittstellen im Zusammenhang mit der Vermeidung von Segregation?
- 6.0. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit analysiert, wie das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München sozialräumlicher Segregation entgegenwirkt. Sie untersucht zunächst das Phänomen der sozialräumlichen Segregation und beleuchtet die Entstehung dieses Problems. Anschließend befasst sich die Arbeit mit den verschiedenen Teilprogrammen des kommunalen Wohnungsbauprogramms der Stadt München und deren Zielgruppen. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, welche Beiträge das Programm zur Vermeidung von Segregation leistet. Des Weiteren werden die Schnittstellen der professionellen Sozialen Arbeit in diesem Kontext beleuchtet und eine Einschätzung bezüglich eines weiteren Handlungsbedarfs in der Wohnungsbaupolitik abgegeben.
- Sozialräumliche Segregation als Problemfeld
- Das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München
- Beiträge des Wohnungsbauprogramms zur Vermeidung von Segregation
- Schnittstellen der Sozialen Arbeit im Zusammenhang mit Segregation
- Handlungsbedarf in der Wohnungsbaupolitik
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1.0: Einleitung Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung dar: Wie wirkt das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München sozialräumlicher Segregation entgegen? Zudem werden die wesentlichen Inhalte und die Struktur der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2.0: Was ist sozialräumliche Segregation und wie entsteht sie? Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialräumlichen Segregation und erläutert die Entstehungsursachen dieses Phänomens. Es werden verschiedene Formen der Segregation (soziale, demographische, ethnische) und deren Ursachen im städtischen Sozialraum analysiert. Zudem werden die Folgen der Segregation für die betroffenen Bevölkerungsgruppen beleuchtet.
- Kapitel 3.0: Das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München im Fokus Dieses Kapitel befasst sich mit dem kommunalen Wohnungsbauprogramm der Stadt München und seinen verschiedenen Teilprogrammen. Es analysiert die Zielgruppen der Programme und die konkreten Maßnahmen zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum.
- Kapitel 4.0: Der sozialräumlichen Segregation in München entgegenwirken, mithilfe des KomPro - wie geht das konkret? Dieses Kapitel untersucht, wie das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München konkret zur Vermeidung von Segregation beiträgt. Es werden die konkreten Maßnahmen des Programms und deren Auswirkungen auf die räumliche Verteilung und die Lebensbedingungen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen analysiert.
- Kapitel 5.0: Wo sind für die Soziale Arbeit Schnittstellen im Zusammenhang mit der Vermeidung von Segregation? Dieses Kapitel beleuchtet die Schnittstellen der Profession Soziale Arbeit im Zusammenhang mit der Vermeidung von Segregation. Es werden die Aufgaben und Herausforderungen der Sozialen Arbeit in diesem Bereich analysiert und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen dieser Hausarbeit sind sozialräumliche Segregation, kommunales Wohnungsbauprogramm, Stadt München, bezahlbarer Wohnraum, Gentrifizierung, Wohnungslosigkeit, Soziale Arbeit, Handlungsbedarf, Wohnungsbaupolitik.
- Quote paper
- Stephan Walk (Author), 2016, Das kommunale Wohnungsbauprogramm der Stadt München und sein Beitrag zur Vermeidung sozialräumlicher Segregation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318604