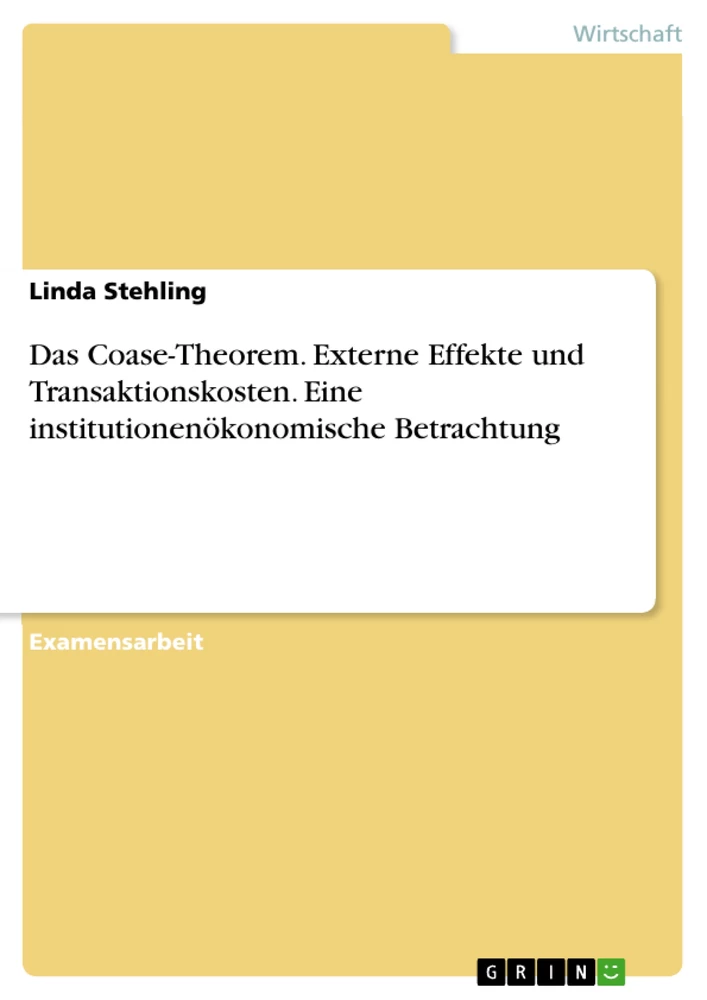Der von Ronald H. Coase 1960 verfasste und im Journal of Political Economy erschienene Aufsatz „The Problem of Social Cost“ , für den er u. a. den Nobelpreis im Jahre 1991 erhielt, sorgte damals für einen Durchbruch, indem er behauptete, dass externe Effekte, auf die in Kapitel 2 dieser Arbeit genauer eingegangen wird, unter bestimmten Voraussetzungen dezentral internalisiert werden können. Diese Auszeichnung resultierte zum einen aus dem Aufsatz „The Nature of the Firm“ aus dem Jahre 1937, zum anderen aus dem Aufsatz „The Problem of Social Cost“, der in der vorliegenden Arbeit thematisiert wird.
Der Aufsatz „The Problem of Social Cost“ wurde nach der Meinung von Coase nicht immer richtig interpretiert.
"[…] I am hopeful that this introductory essay, which deals with some of the main points raised by commentators and restates my argument, will help to make my position more understandable. But I do not believe that a failure of exposition is the main reason why economists have found my argument so difficult to assimilate.“
Aus diesem Grund ist es Ziel dieser Arbeit u. a., die zentralen Thesen von Coase so darzustellen, dass die fundamentalen Gedanken seiner Argumentation verdeutlicht werden.
Die Behauptung von Coase bezüglich der externen Effekte löste das bis dahin vorherrschende von Arthur C. Pigou interventionistisch begründete Verständnis über Prozesspolitik aus dem Jahre 1920 ab. Gemäß Pigou rechtfertigen externe Effekte Markteingriffe, die den Verursachern negativer externer Effekte die sogenannte „Pigou-Steuer“ auferlegen, welche dem verursachten Schaden zu entsprechen hat. In seinem Aufsatz „The Problem of Social Cost“ geht Coase in mehreren Kapiteln auf Pigous Lehrmeinung ein und übt Kritik daran.
Die Ideen des Coaseschen Aufsatzes waren nicht gänzlich neu, da er bereits in dem 1959 von ihm erschienen Artikel „The Federal Communications Commission“ implizit einige Fragestellungen bezüglich der Internalisierung externer Effekte diskutiert. Aufgrund diverser Stellungnahmen behandelt er dies aber nun in aller Ausführlichkeit in dem Aufsatz „The Problem of Social Cost“. Die vorliegende Arbeit fokussiert neben der ökonomischen Perspektive des Coase-Theorems insbesondere dessen Auswirkungen auf die Wissenschaft und die Neue Institutionenökonomik. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der institutionenökonomischen Analyse des Rechts.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Klärung des Begriffs der externen Effekte
- 3 Die Kritik von Coase an Pigou
- 4 Das Beispiel von Coase
- 4.1 Nichtexistenz von Transaktionskosten
- 4.1.1 Das Preissystem mit und ohne Schadenshaftung
- 4.1.2 Veranschaulichung der Ergebnisse anhand verschiedener Beispiele
- 4.2 Existenz von Transaktionskosten
- 4.3 Gültigkeit des Coase-Theorems aus agrarökonomischer Sicht
- 4.4 Kritik an dem Coase-Theorem
- 4.1 Nichtexistenz von Transaktionskosten
- 5 Mathematische Darstellung negativer externer Effekte anhand des Beispiels von Coase
- 6 Betrachtung des Coase-Theorems aus der Perspektive anderer Wissenschaftler
- 6.1 Furubotn und Richter
- 6.1.1 Transaktionskosten nach Furubotn und Richter
- 6.1.2 Eigentumslehre nach Furubotn und Richter
- 6.1.3 Internalisierung externer Effekte nach Furubotn und Richter
- 6.2 Richard Posner
- 6.2.1 Posners Verständnis über die ökonomische Analyse des Rechts
- 6.2.2 Posners Verständnis über Transaktionskosten
- 6.2.3 Eigentumslehre nach Posner
- 6.1 Furubotn und Richter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Coase-Theorem aus institutionenökonomischer Perspektive. Ziel ist die Darstellung der zentralen Thesen von Coase und die Verdeutlichung seiner Argumentation, insbesondere im Vergleich zu Pigous interventionistischem Ansatz. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Theorems auf die Wissenschaft und die Neue Institutionenökonomik.
- Das Coase-Theorem und seine Kritik an Pigou
- Die Rolle von Transaktionskosten im Coase-Theorem
- Die Bedeutung von Eigentumsrechten für die Internalisierung externer Effekte
- Agrarökonomische Implikationen des Coase-Theorems
- Vergleichende Analyse der Perspektiven von Furubotn/Richter und Posner
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit führt in das Coase-Theorem ein, hebt dessen Bedeutung und den Durchbruch gegenüber dem Verständnis von Pigou hervor. Sie erläutert die Zielsetzung, die darauf abzielt, die zentralen Thesen von Coase verständlich darzustellen und dessen Kritik an Pigou zu beleuchten. Die Arbeit kündigt die Analyse des Coase-Theorems aus ökonomischer und institutionenökonomischer Sicht an, sowie die Betrachtung der Perspektiven anderer Wissenschaftler wie Furubotn, Richter und Posner.
2 Klärung des Begriffs der externen Effekte: Dieses Kapitel definiert externe Effekte im Kontext der Wohlfahrtsökonomik, basierend auf Pigous Konzept der Abweichung zwischen sozialem und privatem Wertgrenzprodukt. Es erklärt den Unterschied zwischen positiven und negativen externen Effekten und illustriert diese mit Beispielen. Der Fokus liegt auf negativen Produktionsexternalitäten, die im Coase-Theorem zentral sind.
3 Die Kritik von Coase an Pigou: Dieses Kapitel präsentiert Coases umfassende Kritik an Pigous Ansatz zur Internalisierung externer Effekte. Coase bemängelt Pigous eindimensionale Betrachtungsweise, die Vernachlässigung alternativer sozialer Arrangements und die unzureichende Abwägung von Vor- und Nachteilen. Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Lösungsansätze und deren ökonomische Konsequenzen.
4 Das Beispiel von Coase: Dieses Kapitel analysiert Coases Modell mit und ohne Schadenshaftung, wobei es zunächst von der Nichtexistenz von Transaktionskosten ausgeht. Es beschreibt das Beispiel des Viehzüchters und des Farmers, um die Problematik und die Lösungsansätze zu veranschaulichen. Es werden verschiedene Szenarien durchgespielt und Zahlenbeispiele zur Illustration verwendet. Die Existenz von Transaktionskosten und ihre Auswirkungen werden ebenfalls behandelt, ebenso die agrarökonomische Perspektive und die Kritik an dem Theorem.
5 Mathematische Darstellung negativer externer Effekte anhand des Beispiels von Coase: Dieses Kapitel bietet eine mathematische Modellierung negativer externer Effekte, basierend auf Varians „Grundzüge der Mikroökonomik“. Es überträgt das Beispiel des Viehzüchters und des Farmers in ein mathematisches Modell und zeigt die Ineffizienzen bei individueller Gewinnmaximierung im Vergleich zur gemeinsamen Gewinnmaximierung auf. Die Bedeutung eines vollständigen Marktes wird hier erneut hervorgehoben.
6 Betrachtung des Coase-Theorems aus der Perspektive anderer Wissenschaftler: Dieses Kapitel präsentiert die Ansichten von Furubotn und Richter sowie Posner zum Coase-Theorem. Es vergleicht ihre Perspektiven mit dem Originalansatz und analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Transaktionskosten, Eigentumsrechte und der Rolle des Staates. Die Kapitel beleuchtet die Erweiterungen und Kritiken der genannten Wissenschaftler zum Coase-Theorem.
Schlüsselwörter
Coase-Theorem, externe Effekte, Transaktionskosten, Eigentumsrechte, Internalisierung, Pigou-Steuer, Wohlfahrtsökonomie, Neue Institutionenökonomik, ökonomische Analyse des Rechts, Property-Rights-Ansatz, Furubotn, Richter, Posner, Agrarökonomie, Pareto-Optimalität.
Häufig gestellte Fragen zum Coase-Theorem
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Coase-Theorem aus institutionenökonomischer Sicht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Darstellung der zentralen Thesen von Coase, seiner Kritik an Pigou und der Analyse des Theorems unter Berücksichtigung von Transaktionskosten, Eigentumsrechten und den Perspektiven weiterer Wissenschaftler wie Furubotn, Richter und Posner.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: das Coase-Theorem und seine Kritik an Pigou; die Rolle von Transaktionskosten im Coase-Theorem; die Bedeutung von Eigentumsrechten für die Internalisierung externer Effekte; agrarökonomische Implikationen des Coase-Theorems; ein Vergleich der Perspektiven von Furubotn/Richter und Posner; eine mathematische Modellierung negativer externer Effekte anhand des Coase-Beispiels; sowie eine detaillierte Klärung des Begriffs der externen Effekte.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Klärung des Begriffs der externen Effekte, Die Kritik von Coase an Pigou, Das Beispiel von Coase (inklusive Unterkapiteln zu Transaktionskosten und agrarökonomischer Perspektive), Mathematische Darstellung negativer externer Effekte und Betrachtung des Coase-Theorems aus der Perspektive anderer Wissenschaftler (Furubotn/Richter und Posner).
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung ist die verständliche Darstellung der zentralen Thesen des Coase-Theorems und die Verdeutlichung seiner Argumentation im Vergleich zu Pigous Ansatz. Das Dokument untersucht die Auswirkungen des Theorems auf die Wissenschaft und die Neue Institutionenökonomik. Es soll ein umfassendes Verständnis des Coase-Theorems und seiner Relevanz vermitteln.
Welche Wissenschaftler werden neben Coase betrachtet?
Neben Coase werden die Perspektiven von Ronald Coase, Arthur Pigou, Armen Alchian, Harold Demsetz, Eirik Furubotn, Rudolf Richter und Richard Posner auf das Coase-Theorem und verwandte Konzepte betrachtet und verglichen. Der Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichen Ansätzen zur Behandlung von Transaktionskosten und Eigentumsrechten.
Welche Rolle spielen Transaktionskosten im Dokument?
Transaktionskosten spielen eine zentrale Rolle im Dokument, da sie maßgeblich die Anwendbarkeit und die Ergebnisse des Coase-Theorems beeinflussen. Das Dokument untersucht, wie die Existenz und Höhe von Transaktionskosten die Fähigkeit der beteiligten Parteien beeinflussen, effiziente Lösungen für externe Effekte zu finden. Es wird analysiert, wie unterschiedliche Transaktionskostenszenarien die Ergebnisse des Coase-Theorems verändern.
Welche Rolle spielen Eigentumsrechte im Dokument?
Eigentumsrechte sind ein weiterer wichtiger Aspekt des Dokuments. Das Dokument analysiert, wie klar definierte und durchsetzbare Eigentumsrechte die Internalisierung externer Effekte erleichtern können. Der Zusammenhang zwischen Eigentumsrechten, Transaktionskosten und der Effizienz von Lösungen wird im Detail beleuchtet.
Welche mathematischen Methoden werden verwendet?
Das Dokument beinhaltet eine mathematische Modellierung negativer externer Effekte, die auf Varians „Grundzüge der Mikroökonomik“ basiert. Dieses Modell veranschaulicht die Ineffizienzen bei individueller Gewinnmaximierung im Vergleich zur gemeinsamen Gewinnmaximierung.
Welche agrarökonomischen Aspekte werden behandelt?
Das Dokument analysiert die Gültigkeit des Coase-Theorems aus agrarökonomischer Sicht, indem es das klassische Beispiel von Coase (Viehzüchter und Landwirt) verwendet und die Problematik und Lösungsansätze aus dieser Perspektive beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments beschreiben sind: Coase-Theorem, externe Effekte, Transaktionskosten, Eigentumsrechte, Internalisierung, Pigou-Steuer, Wohlfahrtsökonomie, Neue Institutionenökonomik, ökonomische Analyse des Rechts, Property-Rights-Ansatz, Furubotn, Richter, Posner, Agrarökonomie, Pareto-Optimalität.
- Quote paper
- Linda Stehling (Author), 2014, Das Coase-Theorem. Externe Effekte und Transaktionskosten. Eine institutionenökonomische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318633