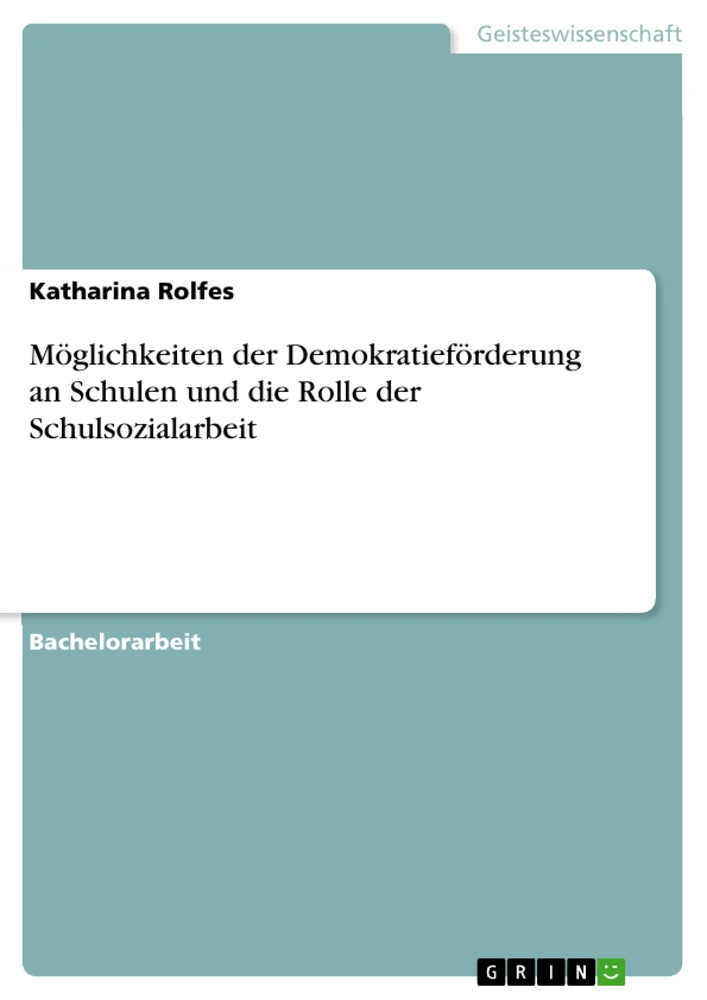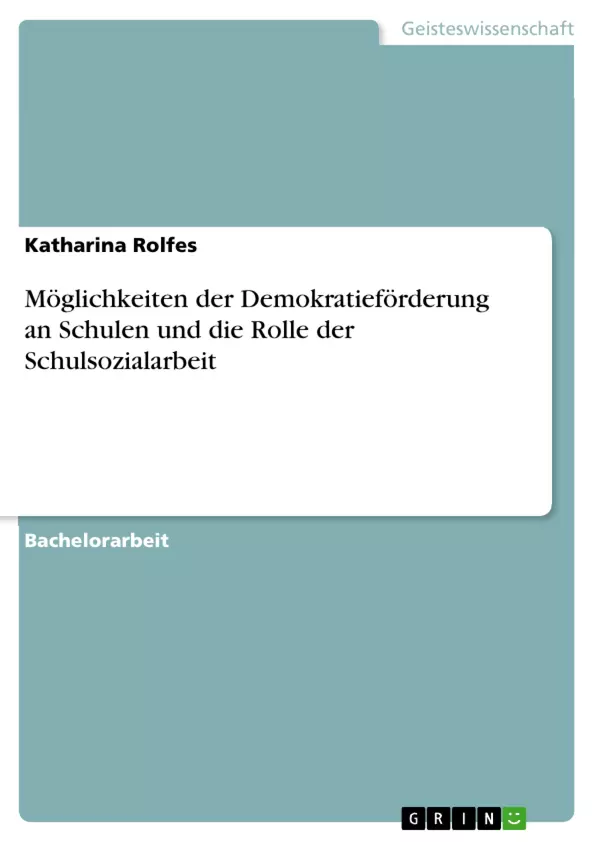Im Rahmen dieser Arbeit werden die Möglichkeiten und Grenzen von Demokratieförderung an der Schule aus Sicht der Schulsozialarbeit dargestellt und kritisch beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden zunächst die rechtlichen und konzeptionellen Grundlagen der jeweiligen Handlungs- und Spannungsfelder für die Schulsozialarbeit dargestellt.
Diese stellen eine wichtige Voraussetzung für weitere Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema dar. Das dritte Kapitel widmet sich den Lebenswelten von Zielgruppen und sozialpädagogischen Fachleuten. Hier wird der schulische Alltag von Lehrpersonal, Schüler_innen und Schulsozialarbeiter_innen aus einer lebensweltorientierten Perspektive beschrieben.
Im Hauptteil wird gezeigt, wie die außerschulische Jugendarbeit im Rahmen von Demokratieerziehung an Schulen als Ressource genutzt werden kann. Ziele, Aufgaben und Methoden der Jugendarbeit werden im vierten Kapitel herausgearbeitet, um Grundlagen und Rahmenbedingungen abzuleiten, die für die praktische Umsetzung nötig sind. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Fragen, ob und wie diese aus der Jugendarbeit abgeleiteten Bildungsprozesse am Standort Schule umgesetzt werden können, wie die Grundkonflikte zwischen verschiedenen Aufträgen und Professionen überwunden werden können und welche Funktion Jugendarbeit an formalen Bildungsorten innehat. Eine Auswahl an gelingenden Praxisbeispielen im sechsten Kapitel veranschaulicht exemplarisch die Möglichkeiten von Demokratieförderung an Schulen und die Rolle der Schulsozialarbeit unter Berücksichtigung des zuvor erarbeiteten Demokratieverständnisses aus der Jugendarbeit. Verschiedene Methoden zur Themenbearbeitung bildungspolitischer Fragen aus der Lebenswelt der Jugendlichen sowie eine Auswahl an Beteiligungsformen werden hier umrissen. Das siebte Kapitel befasst sich mit kooperationsbezogenen Standards sowie personellen, finanziellen und räumlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung und zur Qualitätssicherung der Schulsozialarbeit.
Anschließend folgt im achten Kapitel die Wirksamkeitskontrolle, wo die Berliner Wirksamkeits- und Qualitätsdialoge sowie die Evaluation Politischer Bildungsarbeit mit Jugendlichen thematisiert werden. Die Arbeit schließt mit einem Resümee der zentralen Thesen und Ergebnisse im neunten und einem Ausblick im zehnten Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtliche Grundlagen und die Bedeutung der Schulsozialarbeit
- Rechtliche Grundlagen
- Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Die Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung
- Die Bedeutung der Schulsozialarbeit
- Definition
- Entstehung und Entwicklung
- Aufgaben der Schulsozialarbeit
- Lebenswelten von Schüler_innen, Lehrkräften und Schulsozialarbeiter_innen. Der schulische Alltag
- Lebenswelt Schule: Lehrkräfte als Zielgruppe
- Lebenswelt Schule: Schüler_innen als Zielgruppe
- Lebenswelt Schule: Schulsozialarbeiter_innen als Akteur_innen
- Demokratieerziehung in der offenen Jugendarbeit: Aus der Jugendarbeit lernen? Nutzen einer Ressource
- Demokratieerziehung in der offenen Jugendarbeit: Prinzipien, Ziele und Methoden
- Demokratieerziehung in der offenen Jugendarbeit: Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Praxis
- Grundlagen: Wie gelingen Zugänge, insbesondere zu bildungsfernen Jugendlichen?
- Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Praxis
- Jugendarbeit vs. Schule: Wo und wie können die aus der Jugendarbeit abgeleiteten Bildungsprozesse in der Institution Schule stattfinden?
- Jugendarbeit vs. Schule: Der Grundkonflikt
- Jugendarbeit vs. Schule: Vom Objekt zum Subjekt. Umdenken im Politikunterricht
- Die Funktion von Jugendarbeit an formalen Bildungsorten: Plädoyer für einen ganzheitlichen Bildungsbegriff
- Möglichkeiten der Demokratieförderung an Schulen und die Rolle der Schulsozialarbeit: Gelingende Praxisbeispiele
- Themenbearbeitung: Möglichkeiten der Demokratieförderung durch Themen
- Beispielthemen: Rechtsextremismus und Migration
- Beispielthema: Homophobie
- Beteiligungsformen. Möglichkeiten der Demokratieförderung durch Beteiligung
- Das Wahlrecht als zentrale Demokratienorm
- Mitbestimmung und Meinungsfreiheit als zentrale Demokratienormen
- Das Projekt Kleine Kiezreporter als Beteiligungsform: Non-formales Lernen an non-formalen Bildungsorten
- Formale Standards und Rahmenbedingungen zur Umsetzung
- Personelle, finanzielle und räumliche Rahmenbedingungen
- Interne Kooperation als Standard: Vernetzung mit Schule
- Externe Kooperation als Standard: Vernetzung mit Einrichtungen
- Evaluation und Wirksamkeit
- Die Berliner Wirksamkeits- und Qualitätsdialoge
- Evaluation Politischer Bildungsarbeit mit Jugendlichen
- Resümee
- Ausblick. Schulsozialarbeit und die Möglichkeiten einer jugendarbeitgestützten Demokratieförderung. Chancen, Stolpersteine und weitere Herausforderungen
- Chancen und Möglichkeiten: Aus der Jugendarbeit lernen
- Stolpersteine und andere Schwierigkeiten
- Weitere Herausforderungen: Die Flüchtlingssituation als aktuelle Herausforderung an Schule und Jugendhilfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen von Demokratieförderung an Schulen aus der Perspektive der Schulsozialarbeit. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Rolle der Schulsozialarbeit im Bildungssystem, beleuchtet die Lebenswelten von Schüler_innen, Lehrkräften und Schulsozialarbeiter_innen, und untersucht, wie die außerschulische Jugendarbeit im Rahmen von Demokratieerziehung an Schulen als Ressource genutzt werden kann.
- Rechtliche Grundlagen und Bedeutung der Schulsozialarbeit
- Lebenswelten von Schüler_innen, Lehrkräften und Schulsozialarbeiter_innen
- Möglichkeiten und Grenzen der Demokratieförderung an Schulen
- Rolle der Schulsozialarbeit in der Demokratieförderung
- Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit und Jugendarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Demokratieförderung an Schulen ein und betont die Bedeutung der Schulsozialarbeit in diesem Zusammenhang. Das zweite Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen der Schulsozialarbeit, insbesondere das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und die Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung. Das dritte Kapitel beschreibt die Lebenswelten von Schüler_innen, Lehrkräften und Schulsozialarbeiter_innen im schulischen Alltag. Das vierte Kapitel untersucht die Prinzipien, Ziele und Methoden der Demokratieerziehung in der offenen Jugendarbeit und die Möglichkeiten, diese für die Schulsozialarbeit zu nutzen.
Im fünften Kapitel wird der Grundkonflikt zwischen Jugendarbeit und Schule analysiert und die Frage, ob und wie die aus der Jugendarbeit abgeleiteten Bildungsprozesse in der Institution Schule umgesetzt werden können. Das sechste Kapitel bietet verschiedene Praxisbeispiele für die Demokratieförderung an Schulen, die die Rolle der Schulsozialarbeit unter Berücksichtigung des Demokratieverständnisses aus der Jugendarbeit veranschaulichen. Das siebte Kapitel befasst sich mit den formalen Standards und Rahmenbedingungen für die Schulsozialarbeit, einschließlich personeller, finanzieller und räumlicher Ressourcen, sowie der Bedeutung von interner und externer Kooperation.
Schlüsselwörter
Demokratieförderung, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit, Politische Bildung, Lebenswelten, Bildungsprozesse, Praxisbeispiele, Standards, Rahmenbedingungen, Evaluation, Wirksamkeit, Flüchtlingssituation
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit bei der Demokratieförderung?
Schulsozialarbeit fungiert als Brücke zwischen Schule und Jugendhilfe und nutzt Methoden der außerschulischen Jugendarbeit, um Beteiligung und politisches Bewusstsein zu stärken.
Was sind die rechtlichen Grundlagen der Schulsozialarbeit?
Die Arbeit basiert auf dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie den Kinder- und Jugendberichten der Bundesregierung.
Wie kann Demokratieerziehung im Schulalltag praktisch aussehen?
Durch Projektarbeit zu Themen wie Rechtsextremismus, Migration oder Homophobie sowie durch konkrete Beteiligungsformen wie das Projekt „Kleine Kiezreporter“.
Was ist der „Grundkonflikt“ zwischen Jugendarbeit und Schule?
Der Konflikt besteht oft zwischen dem formalen Bildungsauftrag der Schule und dem non-formalen, freiwilligen Ansatz der Jugendarbeit.
Wie wird die Wirksamkeit politischer Bildungsarbeit überprüft?
In Berlin werden hierfür beispielsweise die „Berliner Wirksamkeits- und Qualitätsdialoge“ zur Evaluation genutzt.
- Quote paper
- Katharina Rolfes (Author), 2016, Möglichkeiten der Demokratieförderung an Schulen und die Rolle der Schulsozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318857