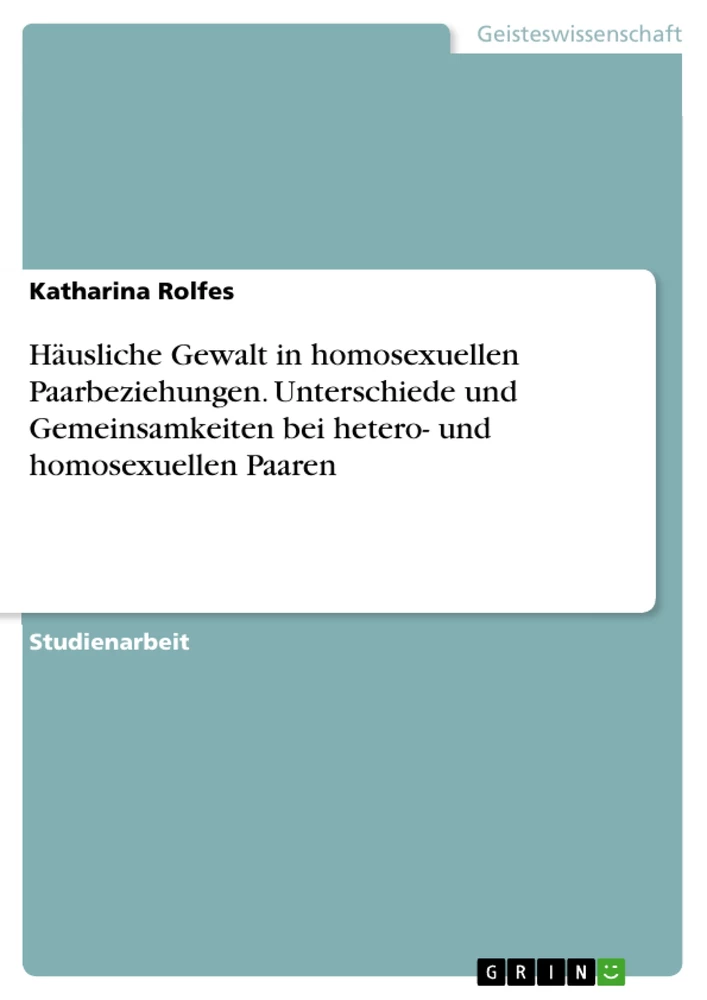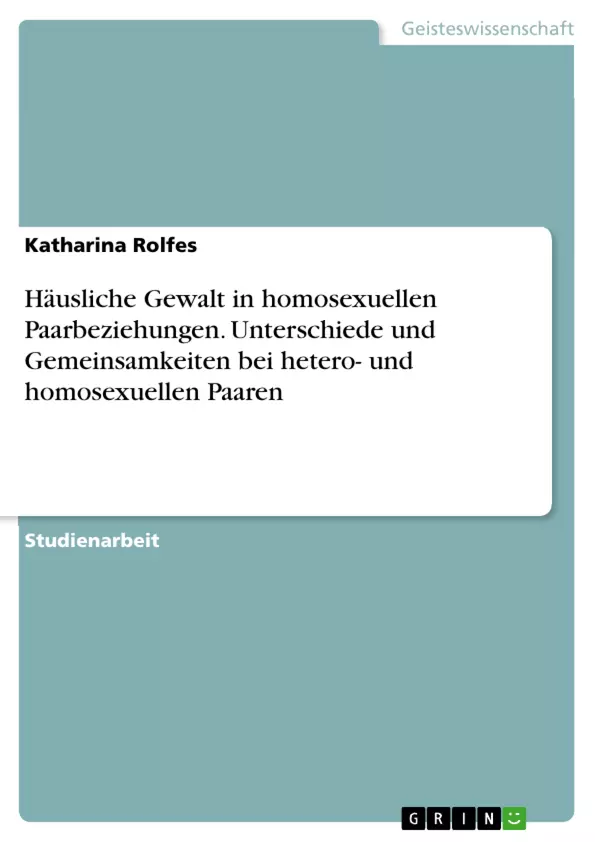Vor dem Hintergrund geschlechtertheoretischer Ansätze und Überlegungen setzt sich diese Arbeit mit dem Thema Häuslicher Gewalt in homosexuellen Paarbeziehungen auseinander. Durch einen Vergleich von Gewalterfahrungen hetero- und homosexueller Paare wird sich der zentralen Fragestellung angenähert: Gibt es Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten bei der Manifestation von Häuslicher Gewalt bei hetero-und homosexuellen Paaren? Wie sehen diese Unterschiede/Gemeinsamkeiten aus und welche Ursachen liegen zugrunde?
Durch die Diskussion relevanter Gendertheorien (Heteronormativität, Heterosexismus, Homophobie, Dekonstruktivismus und die Bedeutung der Zweigeschlechterordnung) werden die abgeleiteten Ergebnisse in einen übergeordneten Zusammenhang gebracht.
Die Definition themenrelevanter Begriffe und die Darstellung von Ausmaß, Formen/Dimensionen und Auswirkungen Häuslicher Gewalt legen in Kapitel 2 wesentliche Grundsteine für diese Arbeit. Das 3. Kapitel stellt mit der Vorstellung und Diskussion von relevanten Studien- und Forschungsergebnissen einen der beiden Schwerpunkte dar. Mithilfe anschaulicher Beispiele aus Interviews und Fragebögen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede Häuslicher Gewalt in hetero-und homosexuellen Paarbeziehungen miteinander verglichen. Da Häusliche Gewalt immer vor dem Hintergrund von Gewalt im Geschlechterverhältnis betrachtet werden muss, wird die Thematik im 4. Kapitel auf der Grundlage einer geschlechtssensiblen Perspektive in einen größeren Kontext gesetzt.
Aus gendersensibler Perspektive wird sich der Frage nach Ursachen Häuslicher Gewalt angenähert. Formen struktureller Diskriminierung in der Gesellschaft, aktuelle Rechtslage und Rechtsschutz sexueller Minderheiten, Homophobie in der Gesellschaft und Reaktionen der Betroffenen werden in Ausschnitten besprochen. Schließlich wird der theoretische Hintergrund von struktureller Diskriminierung erläutert: Wie beeinflusst das in der Gesellschaft verankerte heterosexuelle Verständnis von Häuslicher Gewalt Schutz- und Hilfemaßnahmen? Die Arbeit schließt im 5. Kapitel mit Überlegungen, Forderungen und Handlungsempfehlungen zur Prävention und Intervention auf den Ebenen von Politik, Justiz, Behörden und sozialen Einrichtungen. Im Fazit werden Empfehlungen für die Praxis in der Sozialen Arbeit formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Begriffsdefinition
- Ausmaß Häuslicher Gewalt
- Formen Häuslicher Gewalt
- Auswirkungen Häuslicher Gewalt
- Vergleich Häuslicher Gewalt in hetero- und homosexuellen Paarbeziehungen
- Die britische Studie von 2006
- Erfahrungen Häuslicher Gewalt bei gleichgeschlechtlichen Paaren
- Vergleich Häuslicher Gewalt in gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Paarbeziehungen
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Fokus: Unterschiede bei der Suche nach Hilfe
- Zusammenfassung
- Gewalt im Geschlechterverhältnis: Einbettung der Problematik in einen geschlechtertheoretischen Kontext
- Ursachen Häuslicher Gewalt mit geschlechtssensibler Perspektive
- Der geschlechtertheoretische Kontext: Strukturelle Diskriminierung von LSBTI Menschen
- Rechtliche Grundlagen
- Lebenswelten der Betroffenen. Wie denkt die Mehrheitsgesellschaft? Was sagen die Betroffenen?
- Theoretischer Hintergrund der strukturellen Diskriminierung. Heteronormativität und Heterosexualität als gesellschaftliche Norm
- Wie beeinflusst das in der Gesellschaft verankerte heterosexuelle Verständnis von Häuslicher Gewalt Schutz- und Hilfemaßnahmen?
- Möglichkeiten der Prävention und Intervention
- Allgemein
- Forderungen an Politik, Behörden und soziale Dienste
- Fazit: Empfehlungen für die Praxis in der Sozialen Arbeit. Haltungen und Werte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Häuslicher Gewalt in homosexuellen Paarbeziehungen und setzt dabei einen geschlechtertheoretischen Fokus. Sie untersucht, ob und wie sich die Manifestation von Häuslicher Gewalt in hetero- und homosexuellen Paaren unterscheidet und welche Ursachen diesen Unterschieden zugrunde liegen. Die Arbeit analysiert relevante Gendertheorien und stellt die Ergebnisse in einen übergeordneten Zusammenhang.
- Häusliche Gewalt in gleichgeschlechtlichen Paarbeziehungen im Vergleich zu heterosexuellen Beziehungen
- Die Rolle von Gendertheorien (Heteronormativität, Heterosexismus, Homophobie) im Kontext von Häuslicher Gewalt
- Strukturelle Diskriminierung von LSBTI Menschen und ihre Auswirkungen auf die Prävention und Intervention von Häuslicher Gewalt
- Möglichkeiten der Prävention und Intervention von Häuslicher Gewalt in homosexuellen Paarbeziehungen
- Empfehlungen für die Praxis in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 definiert den Begriff Häusliche Gewalt und beleuchtet das Ausmaß, die Formen und die Auswirkungen dieser Gewaltform. Kapitel 3 vergleicht Häusliche Gewalt in hetero- und homosexuellen Paarbeziehungen anhand von Studien und Forschungsergebnissen. Kapitel 4 beleuchtet die Problematik von Häuslicher Gewalt im Kontext von Gendertheorien und analysiert strukturelle Diskriminierung von LSBTI Menschen. Kapitel 5 beschäftigt sich mit Präventions- und Interventionsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen und formuliert Handlungsempfehlungen für die Praxis in der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, homosexuelle Paarbeziehungen, Gendertheorien, Heteronormativität, Heterosexismus, Homophobie, strukturelle Diskriminierung, LSBTI, Prävention, Intervention, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es häusliche Gewalt auch in homosexuellen Beziehungen?
Ja, häusliche Gewalt tritt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ähnlich häufig auf wie in heterosexuellen Beziehungen, wird jedoch oft weniger thematisiert.
Was sind die Besonderheiten bei Gewalt in LSBTI-Beziehungen?
Besonderheiten sind z.B. das Drohen mit einem Zwangs-Outing oder die Ausnutzung von internalisierter Homophobie als Machtmittel.
Warum suchen homosexuelle Opfer seltener Hilfe?
Angst vor Diskriminierung durch Behörden, fehlende spezialisierte Schutzeinrichtungen und die Sorge, das Ansehen der LSBTI-Community zu schädigen, sind häufige Gründe.
Was bedeutet Heteronormativität im Kontext von Gewalt?
Es beschreibt die gesellschaftliche Annahme, dass häusliche Gewalt primär ein Problem von 'männlichen Tätern' und 'weiblichen Opfern' ist, was andere Konstellationen unsichtbar macht.
Welche Forderungen stellt die Arbeit an die Politik?
Gefordert werden eine bessere Sensibilisierung von Polizei und Justiz sowie der Ausbau von geschlechtsspezifischen Schutzräumen für alle Identitäten.
- Citar trabajo
- Katharina Rolfes (Autor), 2016, Häusliche Gewalt in homosexuellen Paarbeziehungen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei hetero- und homosexuellen Paaren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318858