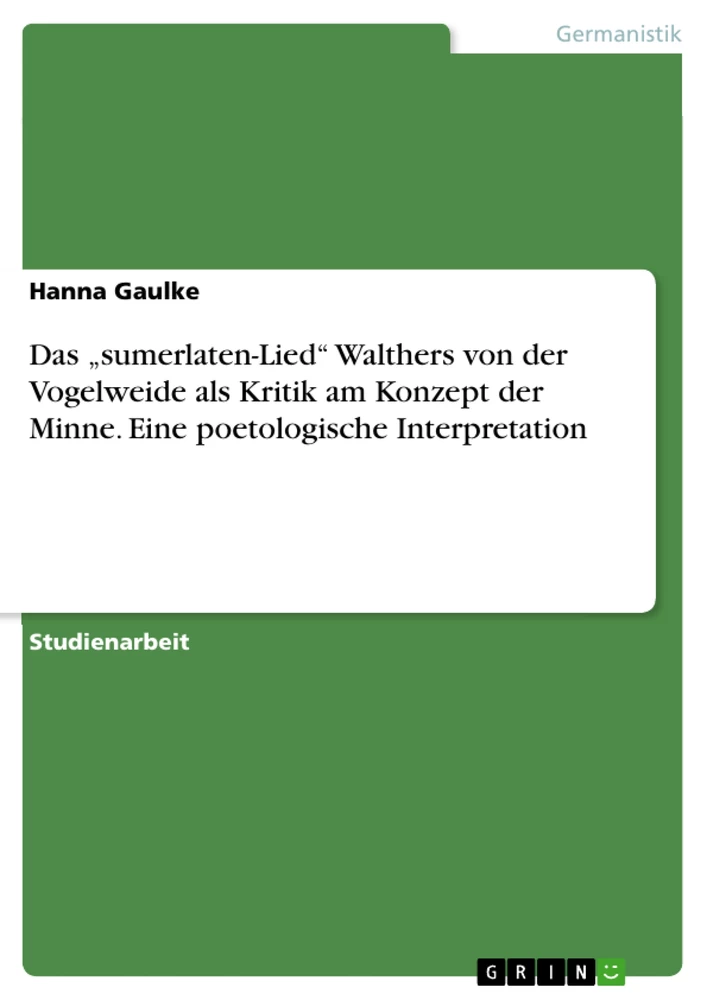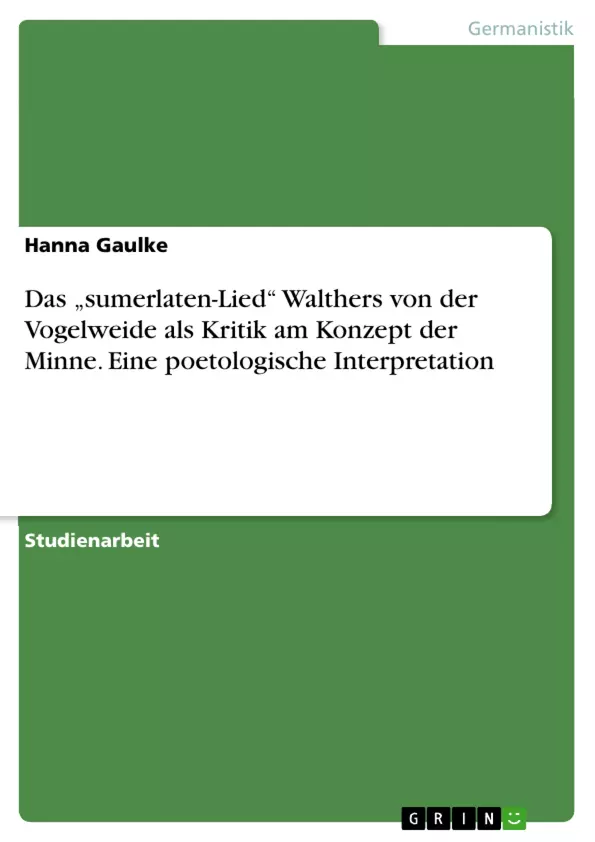Blickt man auf die jahrhundertelange Rezeptionsgeschichte von Walthers von der Vogelweide Textkorpus zurück, so bleibt scheinbar kaum noch etwas zu sagen. Dennoch beschäftigen sich Forscher aus dem Bereich der Mediävistik wiederholt mit Walthers Liedern. Schließlich haben die letzten Jahrzehnte immer wieder neue Erkenntnisse zu den Dichtern des Mittelalters und deren Werken gebracht. Nicht zuletzt ist es auch immer wieder interessant Techniken aus anderen Forschungsdisziplinen auf die mittelalterliche Literatur zu übertragen um so neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Auch in Hinblick auf die poetologische Lesart von Walthers Liedern, hat sich in den letzten Jahren in der Forschung vieles getan. Versuchte man früher die Deutung der Lyrik auf die rein textliche Lesart zu beschränken, zeigt sich inzwischen, dass es durchaus legitim ist, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Deshalb haben sich in den letzten Jahren einige Forscher mit der Möglichkeit einer poetologischen Lesart von Walthers Liedern beschäftigt. Auch die vorliegende Hausarbeit hat sich diese zum Thema gemacht. Um den Rahmen nicht zu sprengen, soll hauptsächlich Walthers so genanntes „sumerlaten-Lied“ L 72, 31 im Mittelpunkt der Analyse stehen.
Zu Beginn werde ich in einem theoretischen Teil den aktuellen Forschungsstand darlegen. Die wichtigsten Thesen zur poetologischen Dichtung werden dabei kurz umrissen. Außerdem werde ich im Folgenden einige weitere Grundlagen für die Arbeit präsentieren. Interessant sind im Zusammenhang mit dem gewählten Lied zum Beispiel die Aufführungssituation des Dichters im Mittelalter sowie die Frage nach Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
Anschließend folgt die ausführliche Analyse des gewählten Liedes. Dabei werde ich versuchen verschiedene Lesarten zu berücksichtigen. Im Vordergrund sollen natürlich die poetologischen Anklänge stehen. In weiten Teilen schließe ich mich Ricarda Bauschke-Hartungs Thesen dazu an, werde diese aber natürlich er-läutern und ergänzen. Alles ist der Frage untergeordnet: Wie gelingt es Walther im Liebesdiskurs seine eigene Kunst zu reflektieren? Auch wenn dies manchmal bestritten wird, so bin ich doch der Ansicht, dass Walther gerade im „sumerlaten- Lied“ mit den Konventionen der „Hohen Minne“ spielt und so gewissermaßen Kritik an der Dichtkunst seiner Zeit übt. Wie Walther dies anstellt, werde ich nun auf den folgenden Seiten versuchen herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung und aktueller Stand der Forschung
- 2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit: der Vortrag von Dichtung
- 3. Kunstreflexion
- 4. Poetologischer Minnesang und Walthers Rolle
- 5. Das so genannte „sumerlaten-Lied“
- 5.1 Form
- 5.2 Paraphrase und Interpretation
- 5.3 Die Gattung
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Hausarbeit analysiert Walthers von der Vogelweide so genanntes "sumerlaten-Lied" im Kontext des poetologischen Minnesangs, um die Frage zu beantworten, wie Walther im Liebesdiskurs seine eigene Kunst reflektiert. Sie stellt die wichtigsten Thesen zur poetologischen Dichtung vor, beleuchtet die Aufführungssituation im Mittelalter und untersucht die Rolle von Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
- Poetischer Minnesang im Werk Walthers
- Reflexion der eigenen Kunst im Liebesdiskurs
- Mündlichkeit und Schriftlichkeit als Medien der Literaturrezeption im Mittelalter
- Die Rolle des "sumerlaten-Liedes" als Beispiel für poetologischen Minnesang
- Analyse der Form, Paraphrase und Interpretation des Liedes
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt den aktuellen Forschungsstand zur poetologischen Deutung von Walthers Liedern dar und erläutert die zentralen Argumente von Ricarda Bauschke-Hartung, Theodor Nolte und Eva Kiepe-Willms. Kapitel 2 widmet sich der Rolle von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Rezeption von Literatur im Mittelalter. Die Analyse des "sumerlaten-Liedes" im fünften Kapitel beleuchtet die Form, Paraphrase und Interpretation des Liedes sowie seine Bedeutung als Beispiel für poetologischen Minnesang.
Schlüsselwörter (Keywords)
Minnesang, Poetologie, Walther von der Vogelweide, "sumerlaten-Lied", Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Mittelalter, Kunstreflexion, Liebesdiskurs, Tradition, Innovation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "sumerlaten-Lied" von Walther von der Vogelweide?
Es ist ein mittelhochdeutsches Lied (L 72, 31), das in dieser Arbeit als poetologische Kritik am Konzept der "Hohen Minne" interpretiert wird.
Was bedeutet eine "poetologische Interpretation"?
Dabei wird untersucht, wie der Dichter innerhalb seines Werkes über die eigene Kunst, die Dichtkunst seiner Zeit und deren Regeln reflektiert.
Wie kritisiert Walther die Minne-Konventionen?
Er spielt mit den starren Regeln der Hohen Minne und nutzt den Liebesdiskurs, um die Künstlichkeit und die Grenzen der zeitgenössischen Lyrik aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt Mündlichkeit und Schriftlichkeit?
Die Arbeit beleuchtet die Aufführungssituation im Mittelalter, in der Lieder primär mündlich vorgetragen wurden, was die Rezeption und Kunstreflexion beeinflusste.
An welche Forschungsthesen knüpft die Arbeit an?
Die Analyse stützt sich maßgeblich auf die Thesen von Ricarda Bauschke-Hartung zur poetologischen Dichtung Walthers.
- Quote paper
- Hanna Gaulke (Author), 2013, Das „sumerlaten-Lied“ Walthers von der Vogelweide als Kritik am Konzept der Minne. Eine poetologische Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319268