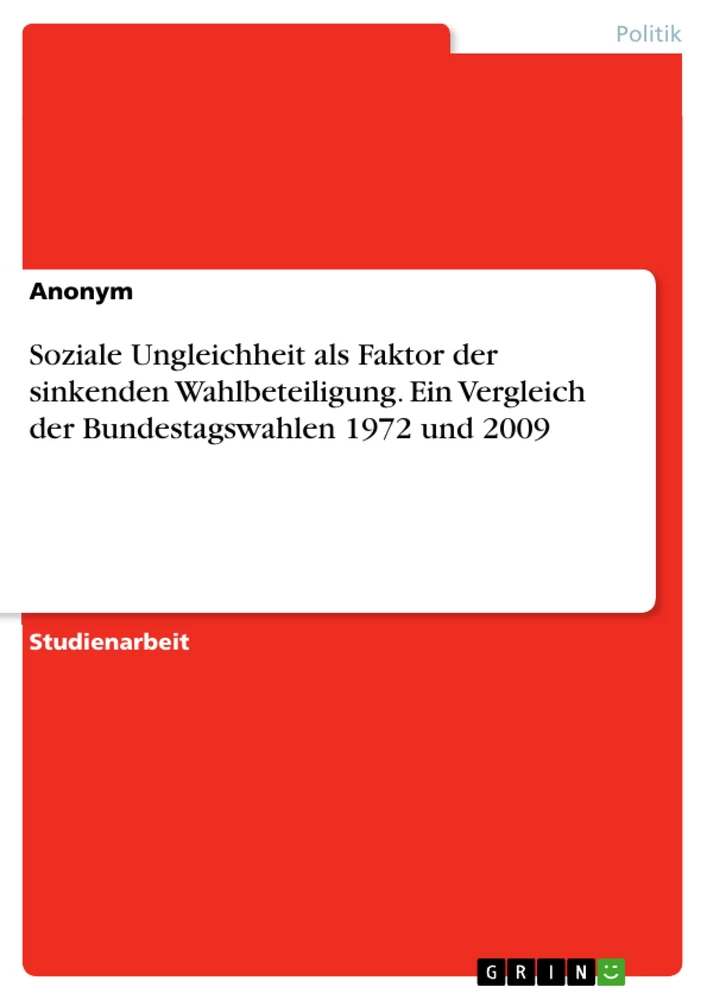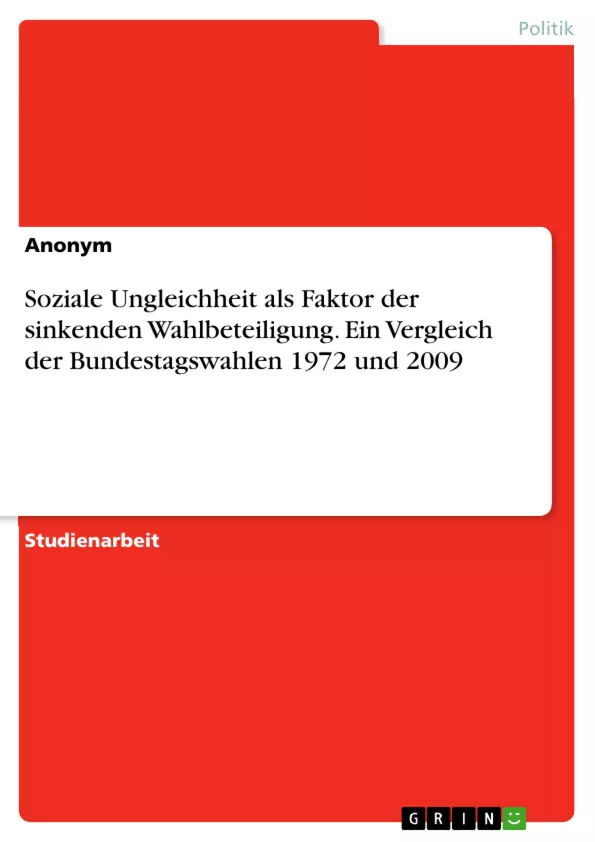Diese Arbeit widmet sich dem Frage, warum die Wahlbeteiligung in Deutschland stetig sinkt und welchen Einfluss die soziale Selektivität hierauf hat. Die konkrete Frage hierbei lautet: welche Faktoren erklären die sinkende Wahlbeteiligung und somit die steigende Anzahl von Nichtwählern? Es wird die Hypothese aufgestellt, dass die sinkende Wahlbeteiligung in enger Korrelation zu der zunehmenden sozialen Ungleichheit in Deutschland steht.
Ein immer größer werdender Teil der deutschen Bevölkerung entscheidet sich gegen die Möglichkeit der aktiven Partizipation und bleibt am Wahltag der Wahlurne fern. Dieser Zustand ist alarmierend, da es sich bei Wahlen um den zentralen Legitimationsmechanismus repräsentativer Demokratien handelt.
Noch nie war die Wahlbeteiligung so niedrig wie bei den beiden Bundestagswahlen 2009 (70,8%) und 2013 (71,5%). Doch ein stetig voranschreitender Trend hin zu einer immer niedriger werdenden Wahlbeteiligung ist schon länger zu beobachten. Diese Entwicklung gilt nicht nur für Bundestagswahlen, sondern ebenfalls für Landtags- und Kommunalwahlen.
Zwar ist die deutsche Wahlbeteiligung im Vergleich zu anderen Nationen noch sehr hoch, doch ebenso hoch ist auch die Geschwindigkeit, mit der der Rückgang voranschreitet. Dies ist vor allem deshalb erstaunlich, weil Deutschland ein besonders beteiligungsfreundliches Wahlsystem hat: die Registrierung von Wahlberechtigten erfolgt automatisch, Briefwahl ist möglich, die Wahlen finden an Sonntagen statt und das System der Verhältniswahl führt nur zu wenigen verlorenen Stimmen.
Neben politischer Beteiligung durch Wahlen gehört auch die politische Gleichheit zu den elementarsten Prinzipien einer Demokratie. Diese Gleichheit ist nicht nur als Rechtsanspruch zu verstehen, sondern realisiert sich eben auch durch politische Partizipation innerhalb eines demokratischen Systems. Trotz der rechtlichen Gleichheit besteht in Deutschland im Hinblick auf politische Partizipation eine erhebliche soziale Selektivität.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Rationalistischer Erklärungsansatz
- 2.2 Soziologischer Erklärungsansatz
- 2.3 Sozialpsychologischer Erklärungsansatz
- 3. Hypothesenbildung
- 4. Empirischer Teil
- 4.1 Bundestagswahlen 1972 und 2009 im Vergleich
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der sinkenden Wahlbeteiligung in Deutschland und untersucht den Einfluss der sozialen Ungleichheit auf diesen Trend. Sie analysiert die Bundestagswahlen 1972 und 2009, um die Hypothese zu überprüfen, dass die zunehmende soziale Ungleichheit zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung führt.
- Soziale Ungleichheit als Faktor der sinkenden Wahlbeteiligung
- Vergleich der Bundestagswahlen 1972 und 2009
- Rationalistischer, soziologischer und sozialpsychologischer Erklärungsansatz für Wahlverhalten
- Bedeutung von Einkommen und Bildung als Ressourcen für politische Partizipation
- Analyse der Unterschiede in der Wahlbeteiligung zwischen den beiden Wahljahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sinkenden Wahlbeteiligung in Deutschland ein und stellt die Forschungsfrage nach den Einflussfaktoren der steigenden Anzahl von Nichtwählern. Die Hypothese wird formuliert, dass die soziale Ungleichheit in enger Korrelation zur sinkenden Wahlbeteiligung steht.
Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Nichtwählerforschung und stellt die drei klassischen Wahlverhaltenstheorien vor: den rationalistischen, den soziologischen und den sozialpsychologischen Ansatz. Es wird geprüft, welche Theorie am besten geeignet ist, die vermuteten Zusammenhänge zwischen Wahlbeteiligung und sozialer Ungleichheit zu untersuchen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der empirischen Untersuchung der Bundestagswahlen 1972 und 2009. Der Vergleich dieser Wahlen soll Aufschluss darüber geben, unter welchen Bedingungen die stark divergierenden Wahlbeteiligungen zustande gekommen sind und ob sich die Hypothese der Abhängigkeit von der sozialen Struktur bestätigen lässt.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Forschungsfrage und der Hypothese.
Schlüsselwörter
Wahlbeteiligung, soziale Ungleichheit, Nichtwählerforschung, Bundestagswahlen, Rational-Choice-Ansatz, soziologischer Ansatz, sozialpsychologischer Ansatz, Einkommen, Bildung, politische Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Warum sinkt die Wahlbeteiligung in Deutschland?
Die Arbeit zeigt auf, dass die sinkende Wahlbeteiligung in engem Zusammenhang mit der zunehmenden sozialen Ungleichheit steht. Menschen mit geringerem Einkommen und niedrigerer Bildung nehmen seltener an Wahlen teil.
Was ist soziale Selektivität bei Wahlen?
Soziale Selektivität bedeutet, dass die Wählerschaft kein getreues Abbild der Gesellschaft mehr ist, da bestimmte soziale Schichten (v. a. sozial benachteiligte) an der Wahlurne unterrepräsentiert sind.
Wie unterschied sich die Wahlbeteiligung 1972 von 2009?
1972 lag die Wahlbeteiligung bei einem Rekordwert von 91,1 %, während sie 2009 auf 70,8 % sank. Dieser Rückgang verdeutlicht den Trend zur politischen Apathie in bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Was besagt der rationalistische Erklärungsansatz für Nichtwähler?
Dieser Ansatz (Rational Choice) geht davon aus, dass Bürger Kosten (Aufwand) und Nutzen (Einfluss der Stimme) abwägen. Wenn der Nutzen als zu gering empfunden wird, bleiben sie der Wahl fern.
Welche Rolle spielen Bildung und Einkommen für die politische Partizipation?
Bildung und Einkommen sind wichtige Ressourcen. Sie vermitteln das nötige Wissen, um politische Zusammenhänge zu verstehen, und fördern das Gefühl, durch die eigene Stimme etwas bewirken zu können.
Warum ist eine niedrige Wahlbeteiligung ein Problem für die Demokratie?
Wahlen sind der zentrale Legitimationsmechanismus. Wenn große Teile der Bevölkerung nicht mehr wählen, verliert das politische System an Repräsentativität und demokratischer Legitimation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Soziale Ungleichheit als Faktor der sinkenden Wahlbeteiligung. Ein Vergleich der Bundestagswahlen 1972 und 2009, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319290