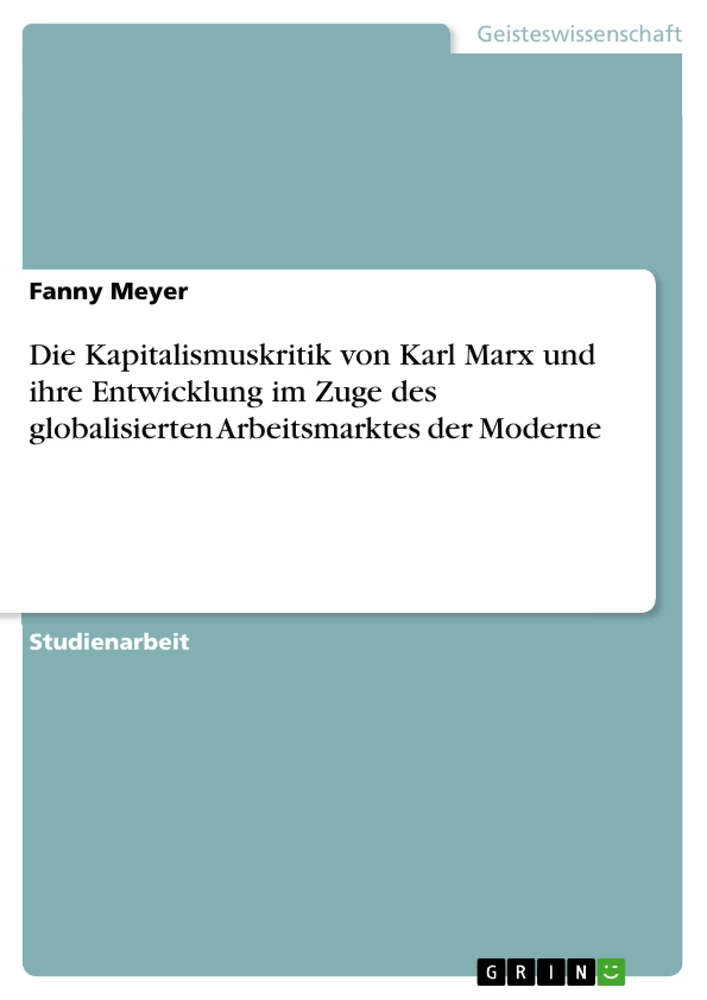Diese Hausarbeit soll einen Überblick über die Kapitalismustheorie von Karl Marx geben und einen Vergleich zu zeitgenössischen Kapitalismustheorien ziehen.
Zu Beginn wird die Entstehung des Kapitals nach Marx vorgestellt, welches den Akkumulationsprozess des Kapitals, die Verwandlung von Mehrwert in Kapital und das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation beinhaltet. Des Weiteren wird, im Hinblick auf moderne Theorien, die Arbeitsentwertung nach Marx vorgestellt. In Folge der Marx’schen Theorie wird der Bogen zu modernen Theorien gespannt.
Es wird gefragt, mit welchen Effekten auf den Arbeitsmarkt sich die Kapitalismuskritik nach Marx in der Moderne, unter Berücksichtigung der Globalisierung, entwickelt hat. Dazu werden Aspekte des Flexiblen Kapitalismus, der Elitennetzwerke, der Globalisierung und der Computerisierung erläutert. Als Ergebnis soll eine aktuelle Analyse des gegenwärtigen Arbeitsmarktes entstehen, der sowohl Aspekte von Marx‘ Kapitalismustheorie als auch historische Entwicklungen aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Karl Marx' Kapitalismuskritik
- 1.1 Allgemeine Thesen und Definition des Kapitalismus
- 1.2 Entstehung des Geldes aus dem Warenverkehr
- 1.3 Verwandlung von Geld in Kapital
- 1.4 Der Akkumulationsprozess des Kapitals
- 1.5 Verwandlung von Mehrwert in Kapital
- 1.6 Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation
- Kapitel 2: Moderne Kapitalismuseffekte
- 2.1 Ausgangspunkt Arbeit
- 2.2 Flexibler Kapitalismus
- 2.3 Elitennetzwerk
- 2.4 Globalisierung
- 2.5 Computerisierung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit soll einen Überblick über Karl Marx' Kapitalismustheorie geben und einen Vergleich zu zeitgenössischen Kapitalismustheorien ziehen. Zu Beginn wird die Entstehung des Kapitals nach Marx vorgestellt, welches den Akkumulationsprozess des Kapitals, die Verwandlung von Mehrwert in Kapital und das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation beinhaltet. Desweiteren wird, im Hinblick auf moderne Theorien, die Arbeitsentwertung nach Marx vorgestellt. In Folge der Marx'schen Theorie wird der Bogen zu modernen Theorien gespannt. Es wird gefragt, mit welchen Effekten auf den Arbeitsmarkt sich die Kapitalismuskritik nach Marx in der Moderne, unter Berücksichtigung der Globalisierung, entwickelt hat. Dazu werden Aspekte des Flexiblen Kapitalismus, der Elitennetzwerke, der Globalisierung und der Computerisierung erläutert. Als Ergebnis soll eine aktuelle Analyse des gegenwärtigen Arbeitsmarktes entstehen, der sowohl Aspekte von Marx' Kapitalismustheorie als auch historische Entwicklungen aufzeigt.
- Die Entstehung des Kapitals nach Marx
- Die Arbeitsentwertung nach Marx
- Moderne Kapitalismuskritik im Kontext der Globalisierung
- Aspekte des Flexiblen Kapitalismus, der Elitennetzwerke, der Globalisierung und der Computerisierung
- Aktuelle Analyse des gegenwärtigen Arbeitsmarktes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Ziele und den Aufbau der Hausarbeit. Kapitel 1 konzentriert sich auf Karl Marx' Kapitalismuskritik und analysiert die Entstehung des Kapitals, den Akkumulationsprozess, die Verwandlung von Mehrwert in Kapital und das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Kapitel 2 beleuchtet die Auswirkungen des Kapitalismus auf den modernen Arbeitsmarkt, wobei Aspekte wie der flexible Kapitalismus, Elitennetzwerke, Globalisierung und Computerisierung im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Kapitalismus, Marx, Kapitalismuskritik, Akkumulation, Mehrwert, Arbeitsentwertung, flexibler Kapitalismus, Elitennetzwerke, Globalisierung, Computerisierung, Arbeitsmarkt.
- Quote paper
- Fanny Meyer (Author), 2014, Die Kapitalismuskritik von Karl Marx und ihre Entwicklung im Zuge des globalisierten Arbeitsmarktes der Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319314