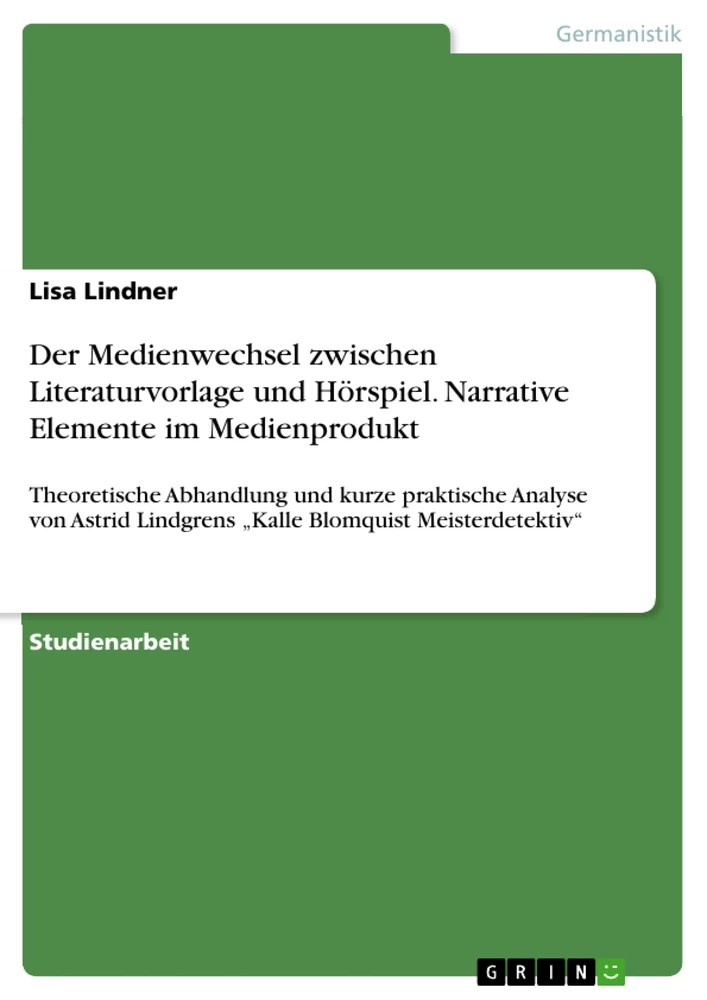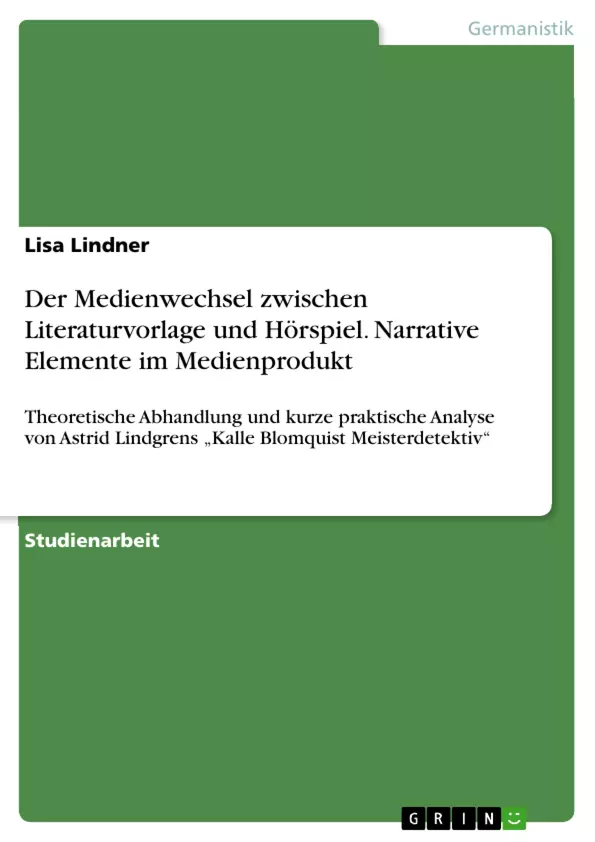Der hier vorliegende Aufsatz soll sich in erster Linie mit den Zusammenhängen zwischen Literatur und Hörspiel beschäftigen. „Die mediale Vervielfältigung verbreitet [dabei] das schon erreichte (Millionen-)Publikum. Schrift ist deshalb nicht mehr der alleinige Garant von Sinngenerierungen im Bereich der Literatur-Ästhetik.“ So verhält es sich auch bei dem für eine praktische Analyse ausgewählten und dem theoretischen Ansatz nachgestellten Beispiel der bekannten schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren und ihrem Helden, dem mutigen und unerschrockenen Detektiv in jugendlichem Alter Kalle Blomquist.
Längst ist Kalle Blomquist seiner literarischen Vorlage entsprungen und kleidet sich fortan in den Gewändern verschiedener Medienprodukte, ein Phänomen, das sich unter dem Begriff des Medienverbundes zusammenfassen lässt, ein aus Einzelmedien bestehendes System, das aus einem originären narrativen Text hervorgegangen ist. Zwischen Text und Einzelmedien herrscht eine intramediale oder intermediale Beziehung zueinander, aber auch untereinander. Der hier thematisierte Medienwechsel selbst meint die Transformation eines medienspezifisch fixierten Produkts in ein anderes Medium. Die Einzelmedien des Medienverbundes umfassen also sowohl Phänomene, die nur ein Medium involvieren, also auch Phänomene, die Mediengrenzen überschreiten, wie etwa den Medienwechsel. Durch den Medienverbund sollen Inhalte und Themen in ihrer Gesamtheit erfasst werden können.
1946 erstmals in schwedischer Originalsprache erschienen, ist Kalle Blomquist mittlerweile einer der bekanntesten und beliebtesten Charaktere Astrid Lindgrens. Seine Popularität spiegelt sich vor allem darin wieder, dass bereits zwei Hörspielfassungen im aktuellen Programm des Oetinger Verlags aufgenommen wurden. Die Produzenten Rose Marie Schwerin und Kurt Vethake bedienen sich in ihren jeweiligen Adaptionen ganz unterschiedlichen Mitteln, um narrative Strukturen der bekannten Literaturvorlage ins Medium Hörspiel zu transponieren. Zu Erörtern inwiefern sich die jeweiligen, fast zwei Jahrzehnte auseinander liegende Hörspiele hinsichtlich ihrer narrativen Element von Literaturvorlage und auch voneinander abgrenzen, hat sich dieser Aufsatz daher im Folgenden zur Aufgabe gemacht.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- 1. Handschrift, Buchdruck, technische und digitale Medien – die Urszenen des Medienwechsels in ihrer historischen Abfolge
- 2. Narrative Strukturen im Roman
- 2.1 Erzählinstanzen im Roman
- 2.2 Kommunikationsstrukturen im Textgefüge
- 2.3 Zeitdimensionen im narrativen Diskurs - Roman
- 2.4 Gestaltung von Raum und Distanz im Roman
- 2.5 Aufgabenfelder von Fokalisierung und Perspektive
- 3. Narrative Strukturen im Hörspiel
- 3.1 Die Literatur und das Hörspiel
- 3.2 Erzählinstanzen im Hörspiel
- 3.3 Erzeugung von Raumdimensionen durch Akustik
- 3.4 Zeitdimensionen im narrativen Diskurs – Hörspiel
- 4. Kurze theoretische Analyse am Beispiel „Kalle Blomquist Meisterdetektiv“
- 4.1 Astrid Lindgren: Kalle Blomquist Meisterdetektiv - das Buch
- 4.2 Rose Marie Schwerins Hörspieladaption (1954)
- 4.3 Kurt Vethakes Hörspieladaption (1973)
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Medienwechsels und untersucht dessen Auswirkungen auf narrative Strukturen, insbesondere im Kontext des Romans und des Hörspiels. Am Beispiel von Astrid Lindgrens „Kalle Blomquist Meisterdetektiv“ wird der Medienwechsel vom Buch zum Hörspiel analysiert. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entwicklungen der Medien und die besonderen Herausforderungen, die sich aus dem Übergang von einem Medium ins andere ergeben.
- Historische Entwicklung des Medienwechsels
- Narrative Strukturen im Roman und im Hörspiel
- Transponierung von narrativen Elementen zwischen Literatur und Hörspiel
- Analyse der Hörspieladaptionen von „Kalle Blomquist Meisterdetektiv“
- Der Einfluss von Medien auf die Wahrnehmung von literarischen Werken
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Medienwechsels und stellt den Fokus der Arbeit auf den Übergang vom Roman zum Hörspiel dar.
- Kapitel 1 analysiert die historischen Etappen des Medienwechsels von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit bis hin zu den digitalen Medien.
- Kapitel 2 untersucht die narrative Struktur im Roman und beleuchtet wichtige Elemente wie Erzählinstanzen, Kommunikationsstrukturen, Zeitdimensionen und Raumgestaltung.
- Kapitel 3 widmet sich den spezifischen narrativen Strukturen im Hörspiel, unter Berücksichtigung von Erzählinstanzen, der Erzeugung von Raum durch Akustik und der Darstellung von Zeit.
- Kapitel 4 analysiert den Medienwechsel am Beispiel von Astrid Lindgrens „Kalle Blomquist Meisterdetektiv“, indem es die Buchvorlage mit den Hörspieladaptionen von Rose Marie Schwerin und Kurt Vethake vergleicht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Medienwechsel, Roman, Hörspiel, narrative Strukturen, Erzählinstanzen, Raumgestaltung, Zeitdimensionen, Medienverbund, Astrid Lindgren, Kalle Blomquist Meisterdetektiv, Hörspieladaption.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Medienwechsel" in der Literaturwissenschaft?
Ein Medienwechsel meint die Transformation eines medienspezifisch fixierten Produkts (z. B. eines Romans) in ein anderes Medium (z. B. ein Hörspiel).
Was ist ein Medienverbund?
Ein Medienverbund ist ein System aus Einzelmedien, die aus einem originären narrativen Text hervorgegangen sind und in intermedialer Beziehung zueinander stehen.
Welches Beispiel wird für die Analyse des Medienwechsels genutzt?
Die Arbeit analysiert den Wechsel vom Roman zum Hörspiel am Beispiel von Astrid Lindgrens "Kalle Blomquist Meisterdetektiv".
Wie wird Raum im Hörspiel im Vergleich zum Roman erzeugt?
Während der Roman Raum durch sprachliche Deskription gestaltet, nutzt das Hörspiel akustische Mittel und Sounddesign, um Raumdimensionen für den Hörer erfahrbar zu machen.
Welche Hörspieladaptionen von Kalle Blomquist werden verglichen?
Es werden die Adaption von Rose Marie Schwerin aus dem Jahr 1954 und die von Kurt Vethake aus dem Jahr 1973 untersucht.
Was sind Erzählinstanzen im Kontext von Medien?
Erzählinstanzen sind die Vermittler der Geschichte. Im Roman ist dies oft ein Erzähler, im Hörspiel kann diese Funktion durch Stimmen, Dialoge oder eine Erzählerstimme übernommen werden.
- Quote paper
- Lisa Lindner (Author), 2015, Der Medienwechsel zwischen Literaturvorlage und Hörspiel. Narrative Elemente im Medienprodukt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319362