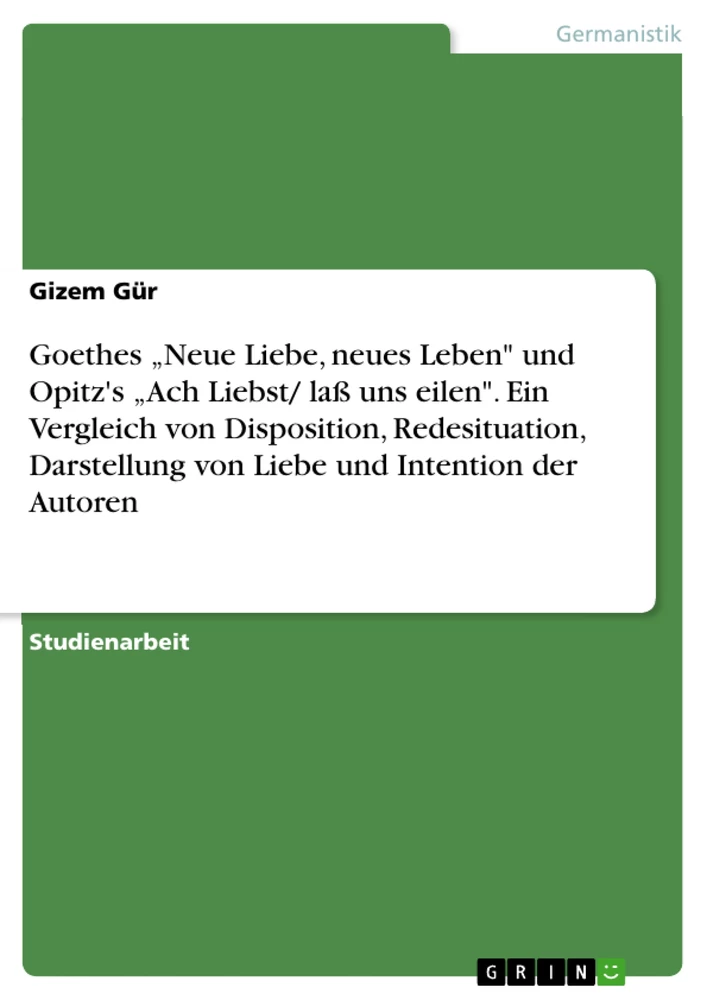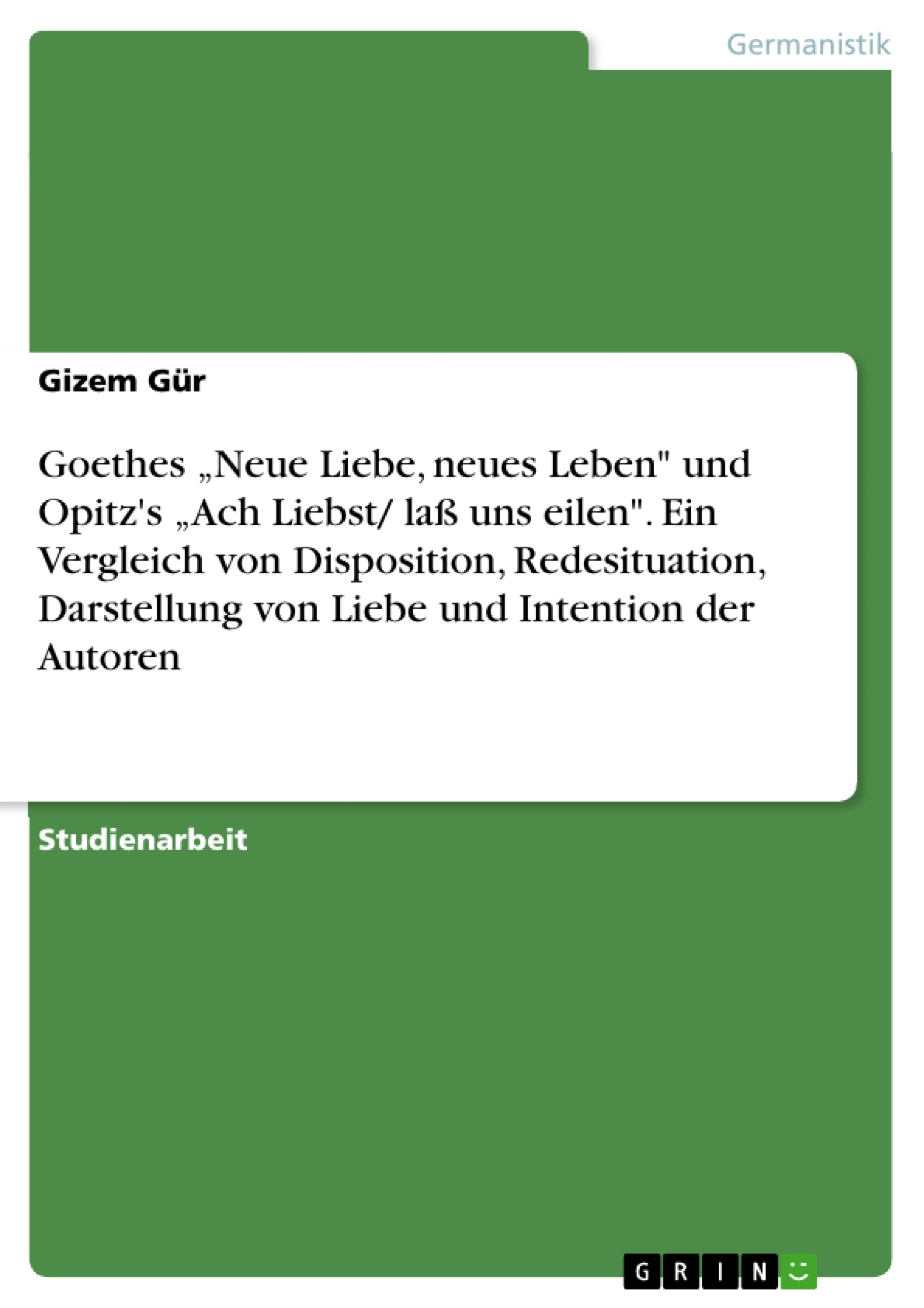Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 3
2. „Neue Liebe, neues Leben“ 4
2.1 Entstehungskontext der „ Neue Liebe, neues leben“ 4
2.2 Metrik und Thematik 4
2.3 Innere Konflikt von Goethe in Bezug auf die fesselnde Liebe 5
3. „Ach Liebste/ laß uns eilen“ 9
3.1 Metrik und Thematik 9
3.2 Innerer Konflikt von Opitz in Bezug auf die Geliebte 9
4. Vergleich der „Neue Liebe, neues Leben“ mit „Ach Liebste/ laß uns eilen“ 12
4.1 Einleitende Bemerkungen 12
4.2 Unterschiede in Dispositionen und Redesituation 12
5. Intention der Autoren in Bezug auf die Gedichte 14
6. Quellen und Literaturverzeichnis 16
1. Einleitung
Die Bedeutung der Gedichte ist sehr groß und sie entwickeln sich mit der Zeit immer weiter. Man trifft in der Literaturgeschichte auf verschieden Formen, wie auch im Zitat genannt: „Literaturgeschichte gibt es heute in mancherlei Varianten“ , diese Varianten sind Hauptsächlich von der jeweiligen Epoche beeinflusst.
Auffallend ist, dass Gedichte einer Epoche zuzuordnen sind, wie in unserem Fall „Ach Liebste/ laß uns eilen“ in die Epoche des Barock und „Neue Liebe, neues Leben“ in die des Sturm und Drang . Durch die Nennung der Epochen möchte ich verdeutlichen, dass Gedichte nicht einfach aus dem nichts entstehen, sondern eine Struktur haben, die sie beeinflusst. Bestimmte geschichtliche Eigenschaften führen dazu dass die Autoren der Zeit entsprechend handeln.
Den Hauptgegenstand der vorliegenden Hausarbeit bildet der Vergleich der Gedichte von Johann Wolfgang Goethes „Neue Liebe, neues Leben“ mit dem von Martin Opitz „ Ah Liebste/ laß uns eilen“.
Zuerst wird das Gedicht „Neue Liebe, neues Leben“ analysiert mit Berücksichtigung auf die Punkte der Entstehung, Metrik und
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. „Neue Liebe, neues Leben“
- 2.1 Entstehungskontext des Gedichts „Neue Liebe, neues Leben“
- 2.2 Metrik und Thematik
- 2.3 Innere Konflikt von Goethe in Bezug auf die fesselnde Liebe
- 3. „Ach Liebste/ laß uns eilen“
- 3.1 Metrik und Thematik
- 3.2 Innerer Konflikt von Opitz in Bezug auf die Geliebte
- 4. Vergleich der „Neue Liebe, neues Leben“ mit „Ach Liebste/ laß uns eilen“
- 4.1 Einleitende Bemerkungen
- 4.2 Unterschiede in Dispositionen und Redesituation
- 5. Intention der Autoren in Bezug auf die Gedichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, die Gedichte „Neue Liebe, neues Leben“ von Johann Wolfgang Goethe und „Ach Liebste/ laß uns eilen“ von Martin Opitz vergleichend zu analysieren. Durch die Betrachtung von Entstehungskontext, Metrik, Thematik und inneren Konflikten der Autoren soll die jeweilige Intention und Relevanz der Werke in der Geschichte der Dichtung erfasst werden.
- Vergleich der Entstehungskontexte beider Gedichte und ihrer Einflüsse
- Analyse der Metrik und Thematik der Gedichte
- Untersuchung der inneren Konflikte der Autoren in Bezug auf die Liebe
- Vergleich der Dispositionen und Redesituationen der Gedichte
- Interpretation der Intention der Autoren und ihrer Relevanz in der Geschichte der Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung der Gedichte in der Literaturgeschichte.
- Das Kapitel „Neue Liebe, neues Leben“ beleuchtet den Entstehungskontext des Gedichts, seine Metrik, Thematik sowie den inneren Konflikt Goethes in Bezug auf die Liebe.
- Das Kapitel „Ach Liebste/ laß uns eilen“ widmet sich der Analyse von Opitz' Gedicht hinsichtlich Metrik, Thematik und dem inneren Konflikt des Autors im Bezug auf seine Geliebte.
- Das Kapitel „Vergleich der „Neue Liebe, neues Leben“ mit „Ach Liebste/ laß uns eilen““ vergleicht die Gedichte hinsichtlich Dispositionen und Redesituationen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Johann Wolfgang Goethe, Martin Opitz, „Neue Liebe, neues Leben“, „Ach Liebste/ laß uns eilen“, Sturm und Drang, Barock, Metrik, Thematik, innerer Konflikt, Disposition, Redesituation, Intention.
Häufig gestellte Fragen
Welche literarischen Epochen werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Gedicht „Ach Liebste/ laß uns eilen“ von Martin Opitz aus der Epoche des Barock mit Goethes „Neue Liebe, neues Leben“ aus der Zeit des Sturm und Drang.
Was ist der zentrale Gegenstand der Analyse von Goethes Gedicht?
Im Fokus stehen der Entstehungskontext, die Metrik sowie der innere Konflikt Goethes im Hinblick auf eine fesselnde Liebe.
Welche Aspekte werden bei Martin Opitz untersucht?
Untersucht werden die Metrik, die Thematik und der spezifische innere Konflikt des Autors in Bezug auf die angesprochene Geliebte.
Welche Unterschiede in der Redesituation werden thematisiert?
Die Arbeit arbeitet die Unterschiede in der Disposition und der Redesituation heraus, die durch die unterschiedlichen gesellschaftlichen und literarischen Hintergründe der Epochen bedingt sind.
Welche Rolle spielt die Intention der Autoren in diesem Vergleich?
Es wird analysiert, welche Absichten Opitz und Goethe mit ihren Werken verfolgten und wie diese ihre Relevanz in der Geschichte der Dichtung begründen.
- Quote paper
- Gizem Gür (Author), 2014, Goethes „Neue Liebe, neues Leben" und Opitz's „Ach Liebst/ laß uns eilen". Ein Vergleich von Disposition, Redesituation, Darstellung von Liebe und Intention der Autoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319392