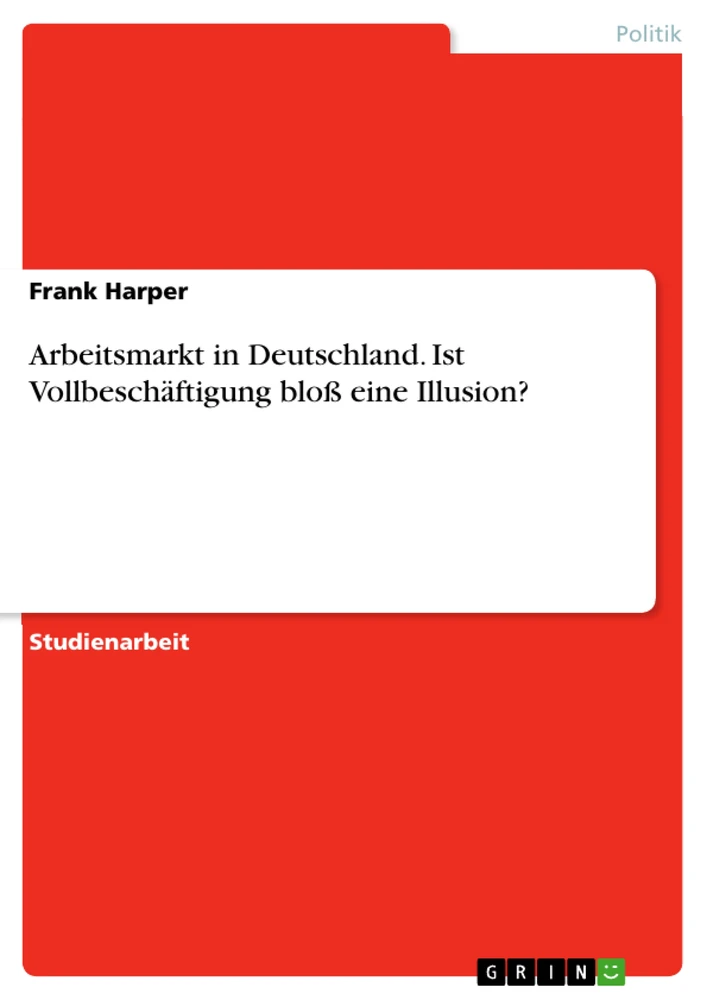Die vorliegende Arbeit behandelt den Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland. Dabei möchte ich vorwiegend der Frage nachgehen, ob die Bundesrepublik ein weiteres Mal dazu in der Lage ist – so wie zum Ende der 1950er Jahre – eine Vollbeschäftigung herzustellen.
Für eine möglichst gute Verständlichkeit befasse ich mich zunächst mit der aktuellen Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt, wobei die Wirtschaftslage ebenso beleuchtet wird. Dabei bleiben die Erläuterungen auf der Makroebene des Staates.
Im Weiteren beleuchte ich einige wichtige theoretische Positionen zur Vollbeschäftigung. Dabei beziehe ich mich besonders auf das volkswirtschaftliche Modell der Neoklassik. Darüber hinaus werden Theorien des US-amerikanischen Soziologen Jeremy Rifkin erörtert, der als ebenso anerkannter Ökonom verschiedene Thesen zum Ende der Arbeit geliefert hat.
Das dritte Kapitel handelt von der Entwicklung der Arbeitslosigkeit und des Arbeitsmarktes der Bundesrepublik seit den 1950er Jahren. Es beschreibt auch die Entwicklung einer nachfrageorientierten Politik hin zu einer angebotsorientierten Politik. Dies dient dem Vergleich mit der heutigen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage der BRD und als empirischer Beleg dafür, ob Rifkins Hauptthese, „das Ende der Arbeit durch Technisierung der Welt“, realitätsnah ist.
Schließlich erläutere ich welche Maßnahmen der Staat in die Wege geleitet hat, um die Arbeitslosigkeit - zum Ziele der Vollbeschäftigung - zu verringern. Außerdem wird behandelt, ob jene Maßnahmen seit ihrer Einführung nennenswerte Erfolge aufweisen können und ob es Faktoren zur Senkung der Arbeitslosigkeit gibt, auf die der Staat kaum Einfluss üben kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bundesrepublik Deutschland - Betrachtung des Arbeitsmarktes heute
- Theoretische Positionen zur Erreichung der Vollbeschäftigung
- Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der BRD seit der Nachkriegszeit
- Staatliche Interventionen zur Realisierung der Vollbeschäftigung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit der Bundesrepublik Deutschland, erneut eine Vollbeschäftigung zu erreichen, ähnlich wie Ende der 1950er Jahre. Die "Agenda 2010" und die damit verbundenen politischen Maßnahmen bilden einen wichtigen Kontext. Die Arbeit analysiert die aktuelle Lage des deutschen Arbeitsmarktes, relevante theoretische Positionen zur Vollbeschäftigung, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit seit der Nachkriegszeit und staatliche Interventionen zur Senkung der Arbeitslosigkeit.
- Analyse des aktuellen deutschen Arbeitsmarktes
- Theoretische Ansätze zur Erreichung der Vollbeschäftigung (Neoklassik, Rifkin)
- Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der BRD seit den 1950er Jahren
- Staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
- Faktoren, die die Arbeitslosigkeit beeinflussen (z.B. Technisierung)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Möglichkeit der Wiederherstellung einer Vollbeschäftigung in Deutschland, angelehnt an die Situation Ende der 1950er Jahre. Die "Agenda 2010" und aktuelle politische Entwicklungen bilden den Kontext. Die Analyse betrachtet den aktuellen Arbeitsmarkt, theoretische Ansätze zur Vollbeschäftigung, die historische Entwicklung der Arbeitslosigkeit und staatliche Maßnahmen.
Bundesrepublik Deutschland - Betrachtung des Arbeitsmarktes heute: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Lage des deutschen Arbeitsmarktes im Jahr 2013. Es werden die Erwerbstätigenzahl, die Arbeitslosenquote und die Unterbeschäftigungsquote dargestellt. Die Einflussfaktoren auf die Arbeitskräftenachfrage (Wirtschaftswachstum, Arbeitsproduktivität, Arbeitszeit) werden erläutert. Der Einfluss der Technisierung auf die Arbeitsproduktivität und die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Kontext des Wirtschaftswachstums und der globalen Finanzkrise werden analysiert. Die unterschiedlichen Rechtskreise des SGB III und SGB II und deren Auswirkungen auf die Arbeitsmarktdynamik werden ebenfalls beleuchtet.
Theoretische Positionen zur Erreichung der Vollbeschäftigung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen theoretischen Positionen zur Vollbeschäftigung, insbesondere mit der neoklassischen Theorie und den Thesen von Jeremy Rifkin zum „Ende der Arbeit“. Die neoklassische Theorie wird kritisch beleuchtet, ihre Therapieansätze (Lohnsenkungen, Abbau von Kündigungsschutz und Lohnersatzleistungen) und ihre Grenzen im gesamtwirtschaftlichen Kontext werden diskutiert. Das „Saysche Theorem“ und die Annahme des „Homo oeconomicus“ werden ebenfalls kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Vollbeschäftigung, Arbeitsmarkt Deutschland, Arbeitslosigkeit, Neoklassik, Jeremy Rifkin, Agenda 2010, Arbeitsproduktivität, Technisierung, Wirtschaftswachstum, Staatliche Interventionen, SGB III, SGB II.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Vollbeschäftigung in Deutschland?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit der Wiederherstellung der Vollbeschäftigung in Deutschland, vergleichbar mit der Situation Ende der 1950er Jahre. Die "Agenda 2010" und aktuelle politische Entwicklungen bilden den Kontext der Analyse. Die Arbeit analysiert den aktuellen Arbeitsmarkt, theoretische Ansätze zur Vollbeschäftigung, die historische Entwicklung der Arbeitslosigkeit und staatliche Maßnahmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die aktuelle Lage des deutschen Arbeitsmarktes (Erwerbstätigenzahl, Arbeitslosenquote, Unterbeschäftigung), relevante theoretische Positionen zur Vollbeschäftigung (insbesondere neoklassische Theorie und Rifkins These vom "Ende der Arbeit"), die Entwicklung der Arbeitslosigkeit seit der Nachkriegszeit, staatliche Interventionen zur Senkung der Arbeitslosigkeit (inkl. SGB III und SGB II), den Einfluss von Faktoren wie Technisierung und Wirtschaftswachstum auf die Arbeitslosigkeit sowie eine kritische Auseinandersetzung mit dem "Sayschen Theorem" und dem Konzept des "Homo oeconomicus".
Welche theoretischen Ansätze werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die neoklassische Theorie der Vollbeschäftigung kritisch, einschließlich ihrer Therapieansätze wie Lohnsenkungen und Abbau von Kündigungsschutz. Darüber hinaus werden die Thesen von Jeremy Rifkin zum "Ende der Arbeit" behandelt.
Wie wird der deutsche Arbeitsmarkt im Jahr 2013 beschrieben?
Das Kapitel zum deutschen Arbeitsmarkt 2013 beschreibt die Erwerbstätigenzahl, Arbeitslosenquote und Unterbeschäftigungsquote. Es analysiert Einflussfaktoren auf die Arbeitskräftenachfrage (Wirtschaftswachstum, Arbeitsproduktivität, Arbeitszeit), den Einfluss der Technisierung und die Auswirkungen der globalen Finanzkrise. Die unterschiedlichen Rechtskreise des SGB III und SGB II und deren Auswirkungen auf die Arbeitsmarktdynamik werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielt die "Agenda 2010"?
Die "Agenda 2010" und die damit verbundenen politischen Maßnahmen bilden einen wichtigen Kontext für die Analyse der Möglichkeit, in Deutschland wieder Vollbeschäftigung zu erreichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vollbeschäftigung, Arbeitsmarkt Deutschland, Arbeitslosigkeit, Neoklassik, Jeremy Rifkin, Agenda 2010, Arbeitsproduktivität, Technisierung, Wirtschaftswachstum, Staatliche Interventionen, SGB III, SGB II.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zur aktuellen Lage des deutschen Arbeitsmarktes, zu theoretischen Positionen zur Vollbeschäftigung, zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit seit der Nachkriegszeit und zu staatlichen Interventionen. Sie schließt mit einem Fazit ab und enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
- Arbeit zitieren
- Frank Harper (Autor:in), 2013, Arbeitsmarkt in Deutschland. Ist Vollbeschäftigung bloß eine Illusion?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319427