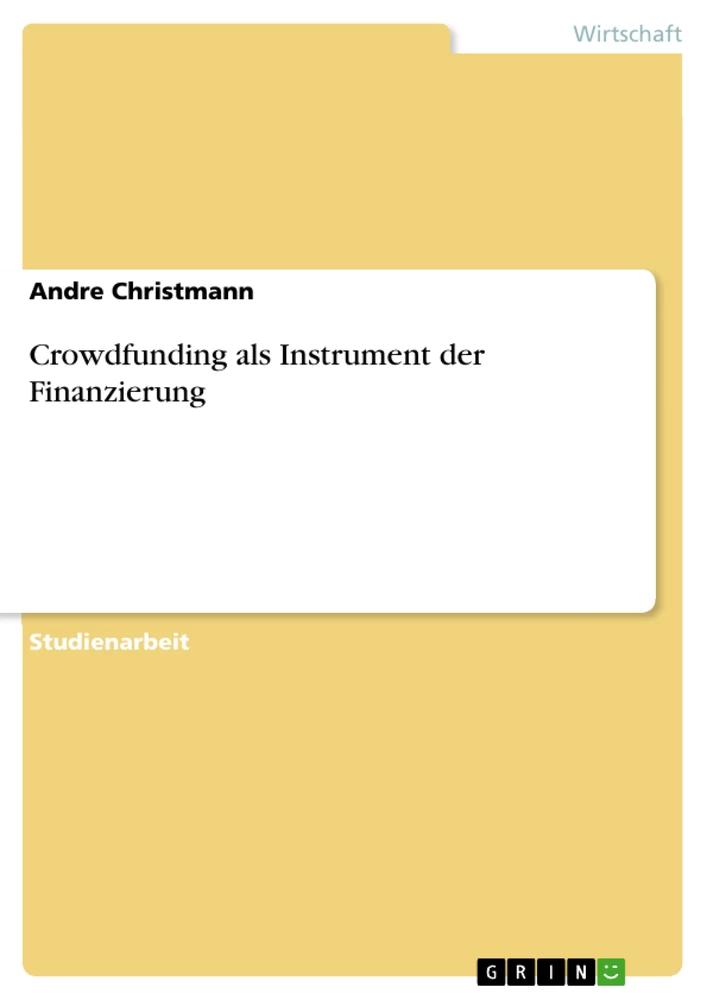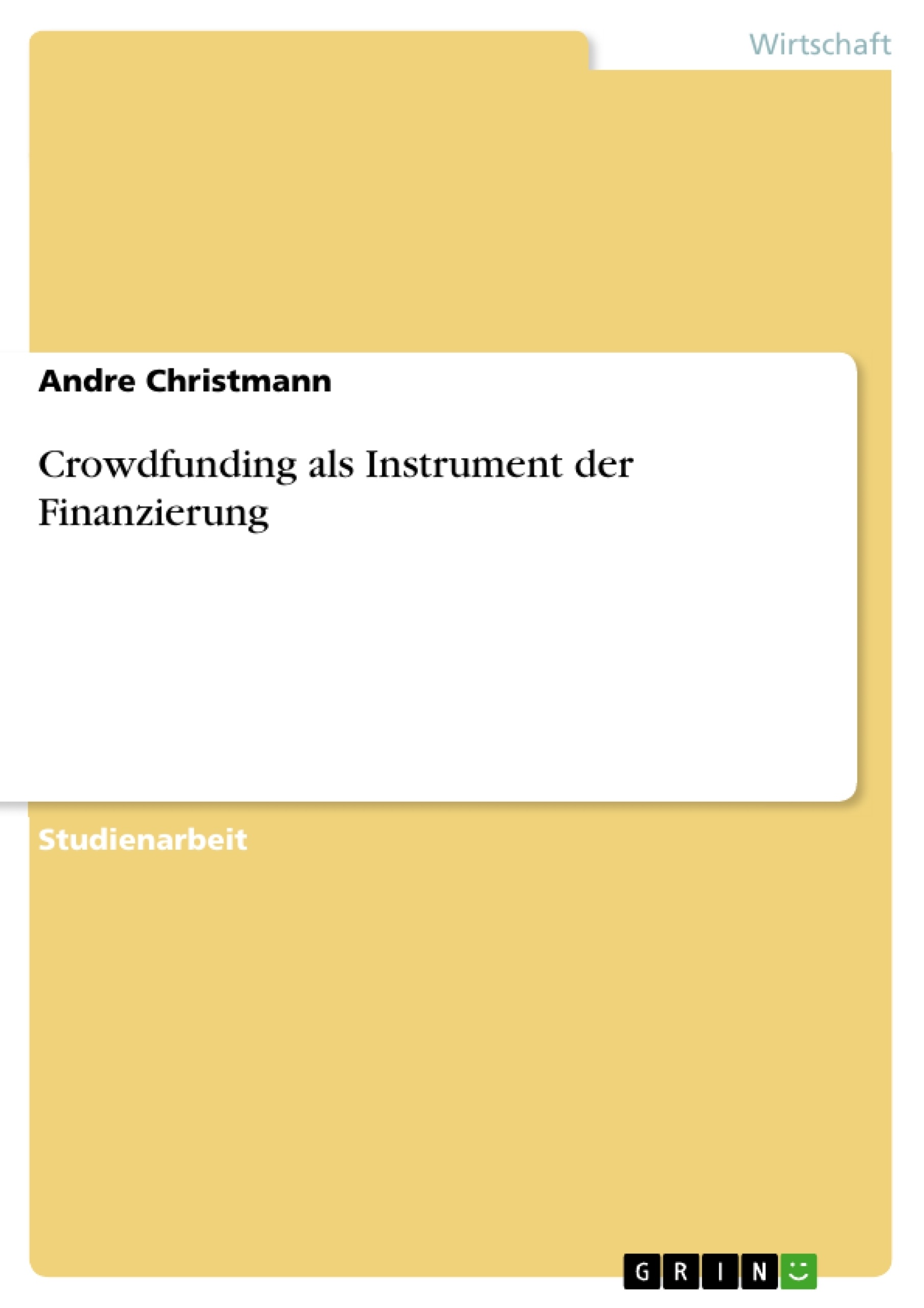Ziel dieser Hausarbeit ist es, Crowdfunding als Instrument der Finanzierung von Startups zu untersuchen sowie dessen Chancen und Risiken auf dem deutschen Markt zu analysieren.
Zum Einstieg in die Thematik werden zunächst die Grundlagen sowie die verschiedenen Modelle betrachtet. Darauf aufbauend wird ein Einblick in die Motive der Investoren und der Initiatoren gegeben, um deren Gründe für Crowdfunding zu erörtern. Diese Chancen/Motive bilden das Gerüst von Crowdfunding sowie dessen Zukunft.
Eine kritische Würdigung wird anschließend die Risiken von Crowdfunding aufzeigen. Aufbauend auf diese Erkenntnisse erfolgt die Betrachtung von Crowdfunding als Instrument der Finanzierung von Startups. Zum Abschluss werden die Zukunftsaussichten für Crowdfunding in Deutschland aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Crowdfunding
- Entstehung und Geschichte
- Konzept und Ablauf
- Modelle des Crowdfundings
- Equity-based Crowdfunding
- Lending-based Crowdfunding
- Rewards-based Crowdfunding
- Donation-based Crowdfunding
- Motive der Crowdfunding Akteure
- Motive der Investoren
- Motive der Initiatoren
- Crowdfunding - eine kritische Würdigung
- Aus Sicht der Investoren
- Aus Sicht der Initiatoren
- Crowdfunding als Instrument zur Finanzierung von Startups
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für Startups und analysiert dessen Chancen und Risiken auf dem deutschen Markt. Die Arbeit beleuchtet die Grundlagen und verschiedenen Modelle des Crowdfundings und analysiert die Motive von Investoren und Initiatoren. Des Weiteren werden die Chancen und Risiken von Crowdfunding aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.
- Die Entstehung und Geschichte des Crowdfundings
- Die verschiedenen Modelle des Crowdfundings
- Die Motive von Investoren und Initiatoren beim Crowdfunding
- Die Chancen und Risiken von Crowdfunding für Investoren und Initiatoren
- Die Eignung von Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für Startups
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Crowdfunding ein und erläutert den aktuellen Stand der Entwicklung in Deutschland. Sie beschreibt die Zielsetzung der Hausarbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau.
- Grundlagen des Crowdfundings: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Geschichte des Crowdfundings sowie das Konzept und den Ablauf von Crowdfunding-Kampagnen.
- Modelle des Crowdfundings: Hier werden verschiedene Crowdfunding-Modelle vorgestellt und in ihren Besonderheiten erläutert, darunter Equity-based Crowdfunding, Lending-based Crowdfunding, Rewards-based Crowdfunding und Donation-based Crowdfunding.
- Motive der Crowdfunding Akteure: Dieses Kapitel untersucht die Motive von Investoren und Initiatoren, die sich an Crowdfunding-Kampagnen beteiligen. Es analysiert die Gründe für die Teilnahme und die Erwartungen der jeweiligen Akteure.
- Crowdfunding - eine kritische Würdigung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Chancen und Risiken von Crowdfunding aus der Perspektive von Investoren und Initiatoren. Es beleuchtet die Vor- und Nachteile dieses Finanzierungsmodells.
- Crowdfunding als Instrument zur Finanzierung von Startups: Dieses Kapitel analysiert die Eignung von Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für Startups und untersucht die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten für diese Unternehmen.
Schlüsselwörter
Crowdfunding, Startup-Finanzierung, Investoren, Initiatoren, Equity-based Crowdfunding, Lending-based Crowdfunding, Rewards-based Crowdfunding, Donation-based Crowdfunding, Chancen, Risiken, deutscher Markt.
- Arbeit zitieren
- Andre Christmann (Autor:in), 2016, Crowdfunding als Instrument der Finanzierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319432